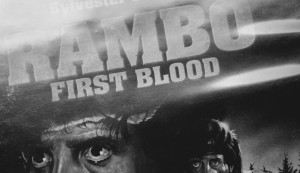Moers ist ganz woanders – eine Nachlese zum Festival
Mit Sorge sahen langjährige Besucher der Zukunft ihres Festivals entgegen. Im vorigen Jahr waren der Künstlerische Leiter und der Geschäftsführer des Moers Festivals nach Querelen mit den Stadtobersten vorzeitig aus ihren Verträgen ausgestiegen. Es ging um Geld, um einen Anteil der Stadt an dem von vielen Seiten geförderten Festival, aber auch, wie schon öfter in der wechselvollen 45-jährigen Geschichte, um die Vermittlung zwischen den hohen künstlerischen Ansprüchen der Festivalmacher und den Interessen der Stadtbewohner.
Diese begegneten mitunter nie gesehenen Gestalten, von denen manche den Namen ihrer Stadt „Mars“ aussprachen und ihrerseits von einem fremden Planeten, auf dem man ein seltsames Verständnis von Musik hatte, zu stammen schienen. Während der Parkplatz vor der Haustür, eine der verständlichen Hauptsorgen der Anwohner, eher von Fahrzeugen aus Münster, Bonn oder den benachbarten Niederlanden zugestellt war.
From Mars to Moers
„Jemand, der sich schon lange aus dem Jazz verabschiedet hat (…) und der ganz woanders ist“, diese Worte wählte Tim Isfort, der neue Künstlerische Leiter, als er am Samstagabend den Ausnahmekomponisten Anthony Braxton ankündigte. Ganz woanders sein, zumindest für die Dauer von vier Tagen, das möchten auch viele der Moers-Pilger – nicht in einer mittelgroßen Stadt am Niederrhein, sondern auf einem den Kosmos musikalischer Möglichkeiten erkundenden Raumschiff. So treffen seit Anbeginn diejenigen, die Moers als Metapher der Grenzenlosigkeit verstehen, auf Menschen, die ganz konkret hier leben.
Vom neuen Festivalleiter erwarten die Stadtväter nicht mehr und nicht weniger, als die verschiedenen Welten einander näherzubringen. Seinem ersten Programmheft stellt Tim Isfort ein 1978 entstandenes Foto voran, das ihn, auf seinem Bonanzarad stehend, mit seiner Familie am Bretterzaun des Festivals zeigt: Er ist ein Kind der Stadt; hier, ganz nah am jährlichen Festival, ist er aufgewachsen.
Auch Anthony Braxton ist in Moers ein alter Bekannter – in den Jahren von 1974 bis 1978 trat er hier regelmäßig auf – und zugleich ein noch zu entdeckender großer Unbekannter. Braxton schreibt täglich Musik, hat mehr als zweihundert Alben aufgenommen, ist mit Jazz und Neuer Musik gleichermaßen vertraut, kombiniert Notation und Improvisation und ist vor allem ein Freigeist.
Braxton-Projekt so komplex wie Stockhausens „Licht“-Zyklus
Braxtons Opernprojekt mit 36 Teilstücken ließe sich in Dauer und Komplexität mit Stockhausens Zyklus „Licht“ vergleichen. Seine Kompositionen Nr. 169 aus dem Jahr 1992 und Nr. 199 von 1997 aus dem Konvolut „Ghost Trance Music“ wurden am 20. Mai dieses Jahres im Großen Sendesaal des WDR vom Ensemble Musikfabrik in Braxtons Abwesenheit, aber mit seinem langjährigen Mitarbeiter, dem Trompeter Taylor Ho Bynum, als Gastmusiker, der die schwierigen Passagen auch dirigierte, aufgeführt.
Eingerahmt waren seine Stücke von Werken ähnlich anspruchsvoller Komponisten, Harrison Birtwistle und Richard Barrett. Keine leicht zugängliche Musik, aber wohl wenige Erdenbewohner fassen die Welt so durch und durch musikalisch auf wie der Verfasser des 1.700-seitigen Manifests mit dem Titel Tri-Axium Writings. Entsprechend groß waren die Erwartungen an sein einziges Konzert in Europa in diesem Jahr, und sie wurden nicht enttäuscht.
Anthony Braxton reiste mit dem ZIM Sextet aus den USA an; ein Gastauftritt der Saxophonistin Ingrid Laubrock erweiterte die Formation an diesem Abend zum Septett. Zur Aufführung kam ein hochkomplexes Werk für zwei Harfen, Cello, Tuba, verschiedene Saxophonformen einschließlich des riesigen Kontrabasssaxophons und Klarinetten sowie mehrere Blechblasinstrumente (Trompeten, Posaune, Flügelhorn, Kornett), die Taylor Ho Bynum spielte. Eine Komposition mit Noten und Freiräumen zur Improvisation, zusammengehalten durch ein gestisches System der Verständigung. Ein Konzert der Meisterklasse.
Empfehlung: Swans leise hören
Als Anthony Braxton nach einer kurzen Zugabe seinen Auftritt beendete, bereit, mit einigen Freunden in seinen zweiundsiebzigsten Geburtstag hineinzufeiern, waren die Swans auf ihrer Abschiedstour soeben aus Barcelona eingetroffen. Trotz längerer Umbaupause und Soundcheck konnte der Auftritt zur angekündigten Uhrzeit 23:11 beginnen (fast alle Anfangszeiten im Programmheft wirkten wie gewürfelt).
Zuvor hatten die Zuhörer ausreichend Gelegenheit, sich mit Ohrstöpseln zu versorgen. Der Schaumstoff in den Ohren ließ das Gewitter aus drei Gitarren, zwei Keyboards und einem unentwegt wirbelnden Schlagzeuger zwar dumpfer, jedoch nicht spürbar leiser klingen. Im Publikum vor der Bühne sah ich eine einzelne Frau ausgelassen tanzen. Vielleicht reagierte sie angemessener auf die in der Lautstärke angelegte physische Destruktion als wir Vorsichtigen in den hinteren Stuhlreihen, die wir uns von den vibrierenden Lehnen den Rücken massieren ließen. Auch der Sänger der Swans arbeitete wie Braxton mit Gesten, aber die seinen dienten weniger der Kommunikation mit den Mitmusikern; er schien vielmehr seine Fans beschwören oder verhexen zu wollen.
Ich verließ die Festivalhölle nach etwa einer halben Stunde und schaffte es, zu Hause im Livestream nicht nur das Ende des Auftritts, sondern auch die während der Autofahrt verpassten Teile nachzuhören – und stellte bei selbstbestimmter Lautstärke fest, es steckten sehr wohl Feinheiten in dem massiv wirkenden Sound, die mir zuvor mit Ohrstöpseln und zusätzlich zugehaltenen Ohren entgangen waren. Swans-Fans werden mich für den wohlmeinenden Rat, ihre Musik in Zimmerlautstärke zu hören, steinigen wollen, denn, wie der Frontman der Gruppe, Michael Gira, im Programmheft zitiert wird, wirke die Musik durch ihre Energie, „seelisch beflügelnd und körperlich zerstörend“.
Kommerzielles Kalkül und künstlerisches Konzept
Diese beiden gegensätzliche Auftritte am Samstagabend – die schnell gespielten kleinen, feinen Töne Anthony Braxtons und die betäubende Lautstärke der Swans – mögen stellvertretend stehen für eine nur allzu auffällige Eigenart des diesjährigen Festivals, die mindestens ebenso sehr kommerzielles Kalkül sein dürfte wie künstlerisches Konzept. Um es in der Sprache von Online-Shops zu sagen: Wer Anthony Braxton mag, dem wird vermutlich auch Miller’s Tale gefallen, das Trio mit der großartigen Pianistin Sylvie Courvoisier aus der Schweiz, dem britischen Saxophonisten Evan Parker, der zuletzt 2012 mit Rocket Science in Moers auftrat, und der Japanerin Ikue Mori an der Elektronik (sie war hier 2013 mit John Zorns „Electric Masada“ zu erleben).
Und wer sich Karten für diese beiden Auftritte kaufen würde, ließe sich sicherlich auch für die beiden Kompositionen „Vogelfrei“ und „Contemporary Chaos Practices“ von Ingrid Laubrock begeistern, die am Pfingstmontag mit dem EOS Kammerorchester Köln aufgeführt wurden, das erste Stück zusätzlich mit zwei Chören, das zweite als Kompositionsauftrag der Kunststiftung NRW eine Welturaufführung.
Verschiedene Schnittmengen im Publikum
Das gleiche Zielpublikum wird auch bereits am Freitagabend dem Auftritt des Streichquartetts um Carolin Pook mit Genuss gelauscht haben, das mit seinem Programm „cosmic string time travel“ auf das New Yorker Powertrio Spacepilot traf. Vier großartige Konzerte für einen bestimmten Teil des Publikums, eventuell auch fünf, wenn man das medidativ-minimalistische Saxophonquartett Battle Trance aus New York hinzunimmt. Bezeichnenderweise fanden diese Konzerte an vier verschiedenen Tagen statt, sodass das Festivalticket die preisgünstigste Option war.
Unmittelbar vor oder nach solchen Höhepunkten standen Musiker auf der Bühne, die eine andere Schnittmenge im Publikum ansprachen. Ich kann mir vorstellen, dass Verehrer der Swans dem Auftritt der belgischen Crust Punks von Cocaine Piss mehr Lustvolles abgewannen als manche Hörer neuer Kammermusik, für die Aurélie Poppins‘ Kreischen geklungen haben könnte, als habe sich die Sängerin einen Finger in der Autotür eingeklemmt, vierzig Minuten lang. Doch freilich schickt der Künstlerische Leiter nicht einfach irgendeine Punkband auf die Bühne. Er brachte die vier Crusties aus Liège mit der dänischen Saxophonistin Mette Rasmussen zusammen, die ihr Instrument so punkgemäß malträtierte, dass beides gut zueinander passte.
Jedem sein eigenes Moers
„Ich bin sicher, dass nach den vier Festivaltagen jeder ‚sein eigenes Moers‘ erlebt haben wird“, schreibt Tim Isfort in der Einleitung des Programmhefts. Die Vielfalt an musikalischen Stilen war auf dem Festival selbstverständlich sehr viel reicher, als die bisher genannten Beispiele vermuten lassen. Da war das Dub Trio aus den USA, das genau die Musik spielte, die der Name der Band versprach. Es waren neue Kostproben aus der Singer-Songwriter-Szene zu hören, von der 21-jährigen Julien Baker in der Kirche St. Josef, oder von Brian Blade, der eigentlich Schlagzeuger ist, aber für sein Projekt Mama Rosa als Sänger mit Gitarre auf die Bühne der Festivalhalle kam, begleitet von fünf Musikern.
Stimmgewaltig und theatralisch präsentierte sich Dorian Wood am Piano, der seine ersten Auftritte in der Gay-Bar-Szene von Los Angeles hatte. Er sang, vielmehr: er performte seine Songs auf Spanisch, Englisch und Bulgarisch, unterstützt von dem sechsköpfigen Ensemble CRUSH, bestehend aus vier Streichinstrumenten, Akkordeon und E-Gitarre. Einen bewegenden Song widmete er den 43 in Mexiko verschwundenen Studenten.
Und es war auch weiterhin gediegener Altherren-Jazz auf dem Festival vertreten, etwa von der isländischen Formation ADHD oder von The Bad Plus aus den USA.
Dagegen hoben sich erfrischend einige jüngere deutsche, österreichische oder belgische Jazzer ab, das Quartett Philm des Berliner Saxophonisten Philipp Gropper etwa, das Trio De Beren Gieren und nicht zu vergessen: der diesjährige „Improviser in residence“ in Moers, John-Dennis Renken. Mit seiner Gruppe „Tribe“ spielte er unter anderem drei Stücke, die er für seine kleine Tochter geschrieben hat, die am Samstag ihr erstes Konzert besuchte. Eines der Stücke heißt „Quatschkopp“ und klingt ziemlich chaotisch, ein anderes, „Charlie‘s Lullaby“, langsamer und sehr emotional. Dennoch: Charlotte muss ein ganz besonderes Kind sein, wenn es ihr gelingt, zu der Musik ihres Papas einzuschlafen. Moers war, für diejenigen, die lange genug im Saal blieben, ein Wechselbad der Gefühle.
Likembe ekuba und die Bohrmaschine
Zu den temperamentvollsten Auftritten gehörte am späten Sonntagabend die kongolesische Gruppe Radio Kinshasa mit der kraftvollen Sängerin und Trommlerin Huguette Huguembo und dem ausdrucksstarken Sänger und Performer Strombo, der seine Instrumente selbst baut. Sie tragen Namen wie likembe ekuba, clavier mesa oder guitard miliki.
Die beiden und drei weitere afrikanische Perkussionisten/Drummer spielten zusammen mit FM Einheit, alias Frank-Martin Strauß, langjähriges Mitglied der Einstürzenden Neubauten, der seine Instrumente ebenfalls selbst herstellt, meterlange Metallspiralen, die er auf der Bühne mit dem Elektrobohrer bearbeitet, oder ein Blech mit Steinen. Dazu spielte der Tenorsaxophonist und Pianist Pavel Arakelian, der an seinem Wohnort Minsk nicht allein von der Musik leben kann und sich ein Zubrot als Bodybuilder verdient. Der Trompeter Markus Türk vervollständigte den energiegeladenen Auftritt von Radio Kinshasa, der im Programm an der Stelle stand, an der früher die African Dance Nights stattfanden. Die Musik lädt nicht nur ein, sie treibt das Publikum geradezu zum Tanzen.
Ausblick
Viele gute Ideen sind in der kurzen Vorbereitungszeit von nur fünf Monaten realisiert worden, und das bei spürbaren finanziellen Einschnitten, die Tim Isfort auf der Bühne ansprach. Aber auch die eingangs erwähnten Sorgen sind nicht unberechtigt. Freunde des Festivals hoffen, dass Moers keine ähnliche Entwicklung wie das benachbarte Traumzeit-Festival nehmen wird, dessen künstlerische Leitung nach der Trennung von Tim Isfort 2012 vom Festivalbüroleiter der Duisburger Marketing Gesellschaft zusätzlich zur kaufmännischen Leitung übernommen wurde und seitdem mit erheblichen Zugeständnissen an den Mainstream fortgeführt wird. Für dieses Jahr jedenfalls erwies sich die Befürchtung, das Moers Festival könnte zu viele Kompromisse eingehen, als unbegründet. Doch andererseits sollte der Wunsch nach Besonderheit nicht in einem Kuriositätenkabinett sämtlicher Musikstile münden.
Deutlicher noch als Vorgänger Reiner Michalke hat die neue Programmleitung das Festival an verschiedene Spielorte verlagert, in die Innenstadt, in den Park, wo Kunstinstallationen zu sehen waren, ins Festivaldorf; moersify nennt sich eine der Reihen. Auch innerhalb der Festivalhalle sucht Isfort neue Formen, wie die discussions, Sessions, die in einer Art Boxring im unteren Teil der Tribüne stattfanden.
Auf der Startseite des Moers Festivals ist im Newsletter zu lesen, das gesamte Team freue sich sehr darauf, „nächstes Jahr mehr Zeit zu haben für – – – Alles!“ Das lässt hoffen.
Das vollständige Programm kann auf der folgenden Website nachgelesen werden: www.moers-festival.de/programm/programmuebersicht/