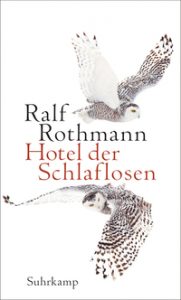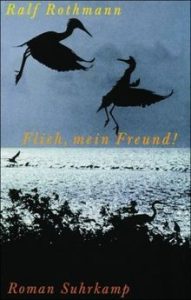Die Wahrheit hinter der Wahrheit – Ralf Rothmanns „Museum der Einsamkeit“
Als Prosaautor debütierte Ralf Rothmann 1986 mit der Erzählung „Messers Schneide“, sein erster Roman, „Stier“, kam 1991 heraus und wurde gleich im „Literarischen Quartett“ besprochen. Seitdem sind 20 weitere Bücher des in Schleswig geborenen, im Ruhrgebiet aufgewachsenen und seit vielen Jahren in Berlin lebenden Autors erschienen. Jetzt legt er unter dem Titel „Museum der Einsamkeit“ eine Sammlung von Erzählungen vor.
Menschen hadern mit ihrem Leben, brechen auf in neue Ungewissheit, fürchten sich vor dem Tod, verfallen in existenzielle Einsamkeit. Rothmann erzählt von den Mühen des Alltags, der Furcht vor dem Alter, dem Ärger mit Berufskollegen und Nachbarn, der Trauer um eine kaputte Ehe, von Ratlosigkeit und Verzweiflung eines Jungen, der allein zu Hause ist und auf seinen kleinen Bruder aufpassen muss, während seine Eltern sich eine Auszeit vom Arbeitsalltag gönnen und die Nacht durchtanzen.
Einmal beschreibt Rothmann, wie jemand zeitlebens von den Furien einer Kindheits-Erinnerung geplagt wird, sich nach 50 Jahren aufmacht, um einen einst von ihm drangsalierten Mitschüler um Verzeihung und Vergebung zu bitten – und damit eine Kette von Ereignissen lostritt, die nur neues Leid und neue Schuld bewirken. Oder er schildert das Leben einer enttäuschten Frau, die aus der Einsamkeit der Provinz in die Anonymität der Großstadt geflohen ist. Jetzt, an der Schwelle zum Alter, begleitet sie ihre greise Mutter beim Kauf eines Apartments in einer Senioren-Residenz mit Meeres-Blick: Die Mutter hat nach dem Tod ihres Mannes ihr Haus in Süddeutschland verkauft und hofft, die Einsamkeit des Alters in einer idyllisch verklärten Umgebung am Meer vertreiben zu können, natürlich vergeblich.
Kleine Episoden aus dem Leben einzelner Protagonisten, verdrängte Erinnerungen, kurz und knapp erzählt; Stories, die einen romanhaften Schatten werfen und genügend Freiraum und Luft für die Fantasie des Lesers lassen. In der finalen Erzählung, „Psalm und Asche“, geht es dann um viel mehr: die Vernichtung der europäischen Juden, darum, wie die Opfer in Vieh- und Güterwagen in die Vernichtungslager transportiert werden, die Mörder später ihre Taten leugnen, verdrängen und schön reden. Die Verteidigungsrede des Nazi-Täters, der meint, immer nur seine Pflicht getan und Befehle ausgeführt zu haben, wird collagiert mit der Stimme einer jüdischen Frau, die auf dem Transport in den Tod ist und sich um das Baby einer Verstorbenen kümmert, die Reste einer Schokolade mit ihrem Speichel verdünnt und dem greinenden Baby als süßlichen Ersatz für fehlende Muttermilch in den zahnlosen Mund gibt.
Einer anderen Frau im Waggon, die sich immer noch von irgendwo her Hilfe erhofft, entgegnet sie: „Wieso sollte uns jemand helfen? Nichts und niemand wird das tun. Auch Klagen hilft nichts. Es raubt dir die Kraft, die du dafür brauchst, das Ende zu akzeptieren. Das Letzte im Innern, die Wahrheit hinter der Wahrheit, kann dir sowieso niemand nehmen. Wenn du das verstehst, bist du frei, und das Leben ist wieder wunderbar, auch hier, auch in diesem Moment.“ Wen das kalt lässt, dem ist wahrlich nicht zu helfen. Rothmann ist ein Meister der sprachlichen Magie, ein großer Erzähler, der ein tief-trauriges, wunderbares Buch geschrieben hat.
Ralf Rothmann: „Museum der Einsamkeit“. Erzählungen. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025, 268 Seiten, 25 Euro.