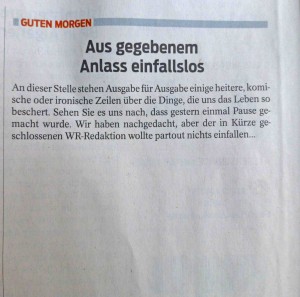Hat Literaturförderung eine Zukunft? Oder: Ein Interview als Selbstversuch
Zum 1. April 2018 habe ich im Literaturbüro Ruhr e.V. als wissenschaftlicher Leiter gekündigt. Kein Wunder, dass ich des Öfteren gefragt werde, ob ich zum vorzeitigen Abgang ein Interview gäbe. Angeregt durch die Sammlung „Unmögliche Interviews“ des Wagenbach Verlags und David Foster Wallaces „Kurze Interviews mit fiesen Männern“ habe ich mich heute endlich dazu entschlossen, mich – mir nichts, dir nichts – selbst zu interviewen. Denn, so sagt Novalis, „Jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft.“

Beim „Kaputten Abend 1“ im Maschinenhaus der Zeche Carl – Maria Neumann (Theater an der Ruhr), geschultert von Gerd Herholz; Foto: Jörg Briese
Drei Jahrzehnte Literaturbüro Ruhr? Wie hält man das aus?
Sie hatten doch intelligente Fragen versprochen. Naja …
Heute scheint tatsächlich jeder verdächtig, der sich über längere Zeit einer Sache widmet. Die Beschäftigung mit Literatur in all ihren Facetten aber bleibt ein Leben lang inspirierend und bereichernd. Man kann übrigens hier- und dennoch nicht zurückbleiben.
Empfinden Sie Wehmut zum Abschied?
Mut und Weh zugleich. Von Meister Eckhart stammt der Satz: „Wer werden will, was er sein sollte, der muss lassen, was er jetzt ist.“ Da stimme ich gottloser Humanist dem begnadeten Mystiker zu, spät und wahrscheinlich auch zu spät.
Wahrlich mystisch! Das heißt konkret?
Innehalten. Es braucht Muße, um wieder zu sich zu kommen. Als Rollenspieler im Hamsterrad der Literaturförderung war ich zu oft außer mir, eingespannt bei der Suche nach Fördermitteln, medialer Aufmerksamkeit, Publikum, aber auch in die bitter notwendige Kritik öffentlicher Kulturpolitik, war also Teil eines zwar noch nicht rasenden, aber rasanten Stillstands. Die Literatur, das Lesen, das Dem-Gelesenen-Nachsinnen, all das kommt eindeutig zu kurz. Ein Literaturbüro ist zwar immer auch ein Biotop für Literaturbekloppte, aber eben viel zu selten.

Hate Poetry-Abend des Literaturbüros im Essener Katakombentheater – u.a. mit Hasnain Kazim & Doris Akrap; Foto: Jörg Briese
Das war’s jetzt mit dem Weh?
Nein. Weh tut im Moment des Abschieds, dass es so scheint, als ob die Zukunft des Literaturbüros als Komplize literarischen Eigensinns verramscht würde. Da machen gedankenlose Vordenker wohl schon länger obskure Planspiele zum Um- oder Abbau des Trägervereins, ohne dessen Vorstand und Mitglieder oder mich als Leiter des Büros überhaupt zu informieren. Insbesondere aus dem Umfeld des Regionalverbands Ruhr hört man, dass sich das Literaturbüro Ruhr mehr zu vernetzen habe, umzustrukturieren, vielleicht seine Landeszuschüsse in ein neues „Literaturzentrum“ überführen, sich gar einen neuen Standort außerhalb Gladbecks suchen solle.
Wäre denn Veränderung so schlecht?
Die behutsame Entwicklung des Literaturbüros, sein Ausbau wären mir lieber. Die Selbstständigkeit des Vereins, seine Souveränität müssen geachtet werden. Ich lege seit vielen Jahren beharrlich, aber vergeblich auch dem RVR Konzepte dazu vor, wie ein Literaturhaus, ein Literaturnetz Ruhr, Residenzen/Stadtschreiberstellen und der Literaturpreis Ruhr zukünftig aussehen könnten.

Programmveröffentlichung bei der lit.RUHR.
(von rechts nach links): Rainer Osnowski (Festivalleiter lit.RUHR), Jolanta Nölle (Mitglied des Vorstandes Stiftung Zollverein), Dr. Traudl Bünger (Künstlerische Leiterin lit.RUHR), Daniela Berglehn (Pressesprecherin der innogy Stiftung),Eva Schuderer (Programm lit.RUHR),Bettina Böttinger (Moderatorin), Dr. Thomas Kempf (Mitglied des Vorstandes der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung), Tobias Bock (Programm lit.RUHR)
Foto: © Heike Kandalowski, lit.RUHR
Der RVR allerdings zeichnete sich bisher nicht durch eine ideenreiche und die Region vehement unterstützende Literaturförderung aus, im Gegenteil: Er hat sie eher verschleppt. Noch planloser sind nur die großen Stiftungen des Ruhrgebiets. Sie geben ab 2017 jährlich eine halbe Million Euro an Kölner Veranstalter, um von dort aus jeweils im Herbst die lit.RUHR organisieren zu lassen. Diese ‚lit.KOLONE‘ ist aber nichts weiter ist als eine schlichte Kopie der lit.COLOGNE: Das Ruhrgebiet – ein starkes Stück Köln! Am grünen Planertisch der hiesigen Eliten-Darsteller denkt man leider nur noch in Kategorien wie Kulturtourismus, Veranstaltungstaumel oder „Dachmarkenmarketing“ – und landet eher bei einem Dachschaden-Marketing.
Das klingt ziemlich aggressiv und verbittert.
Aggression, das heißt auch: sich auf etwas zubewegen. Meinen kleinen Zorn möchte ich mir bewahren. Den Anschein von Einstimmigkeit zu durchbrechen, das macht auch Spaß.
Verbittert? Nein. Aber enttäuscht, vor allem extrem gelangweilt von der immer gleichen größenwahnsinnigen Kulturkampagnenpolitik im Ruhrgebiet, die nicht einmal nach der Loveparade-Katastrophe gründlich infrage gestellt wird. Ich muss mir aber auch selbst vorwerfen, dass ich mich angesichts der kargen Mittel des Literaturbüros Ruhr und der fehlenden kulturpolitischen Unterstützung verschlissen habe bei dem Versuch, Literatur- und Leseförderung auf möglichst hohem Niveau zu gestalten. Man kommt sich vor wie ein Bastard aus Sisyphos, Don Quichotte und Freigänger.

Textrevolte – eine Reihe des Literaturbüros Ruhr
Wie sieht die Zukunft der Literaturförderung im Ruhrgebiet aus? Hat sie überhaupt eine?
Ein Großteil des geistigen Lebens im Alltag der Region wird auf der Strecke bleiben, wenn die Sparpolitik bei der kulturellen Infrastruktur – etwa bei den öffentlichen Büchereien – so fortgesetzt wird. Das dürfte hier aber kaum jemandem auffallen.
Die vielen selten subventionierten Enthusiasten und kleinen Initiativen wird es weiter geben. Solides ehrenamtliches Engagement gegen anämische Festivalitis und Eventitis. Ansonsten: Die hoch bezuschusste lit.RUHR als Festivalzirkus der Beliebigkeit wird das große Geld und vieles an Energie binden. Also immer öfter: Promis als Programm, Kunstsimulation als Konzept. So etwas kann man aber auch von den Ruhrfestspielen sagen: ein Kessel Buntes, Culture-to-go.
Dem Publikum scheint’s zu gefallen.
Man kann dennoch versuchen, nicht populistisch zu werden, wenn man Populäres macht. Und es gibt ein Publikum, das wünscht sich auch im kleineren Rahmen des Alltags das gekonnte Gespräch, den Vortrag guter Literatur auf der Bühne, neue Formate und vor allem politisch-kulturelle Intervention – abseits allen Talkshow- und Marketing-Gesumses. Stattdessen wird es seit Jahren vor allem von der Krimi-Flut überrollt. Ein Wellenreiter wie Sebastian Fitzek wird dabei tatsächlich als Schriftsteller gehandelt und ist doch bloß einer, der in Serie Sprache killt. Allerdings sieht man auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten auch viele Kulturpolitiker und –‚manager‘, sogenannte Intendanten, Experten, Hobby-Moderatoren, Dichterdarsteller, die sich so vor die gekonnte Literatur, die Literaten schieben, dass man diese gar nicht mehr sieht.
Wieso setzt sich die Festival-Blase überall durch, wenn sie doch nur einfallslose Mono-Kultur bietet?
Es gibt – wie gesagt – die Begierden der Festivalmacher, immerhin agieren sie in sehr gut bezahlten Jobs. Dazu jede Menge offene und verdeckte Politik-, Verwaltungs- und Sponsorinteressen. Alle wünschen sich den Abglanz glitzernder Kunst-Fassaden, den Imagetransfer. ‚Social washing‘: Da lässt sich halt ein Kulturfestival von ‚Gönnern‘ wie VW oder Mercedes sponsern und die Auto-Patriarchen sind erfreut, sich für ein paar Peanuts abseits aller Abgas- und Affenversuchsskandale in veritable ‚Kultur‘ einzukaufen – eine Kultur, die sie selbst nicht besitzen. Und während des Festivals wird dann dreist von Literatur als Widerstand gesprochen, ein Widerstand, der längst verraten und verkauft wurde. Das Großformat erstickt per se aufrechte Haltung und Integrität.
Und wenn man von der öffentlichen Hand gefördert wird, dann bleibt man sauber?
Mitnichten. Öffentlich geförderte Einrichtungen werden nicht nur ins Abseits gespart, sondern zunehmend mit Zielvereinbarungen, Evaluationen usw. gegängelt. Die Landesrechnungshöfe würden im Gegenzug für öffentliche Förderung gern Mindestzahlen beim Publikumsbesuch fixieren. Quotenwahn statt künstlerischer Freiraum. Um so Quote zu machen, werden Kulturförderer sich schlechtem Massengeschmack weiter anpassen müssen und ihn damit selbst immer neu erzeugen. Das wäre die Selbstaufgabe kritischer Literatur- und Leseförderung. So hechelt sie dem Markt nur noch hinterher, statt dessen Korrektiv zu sein und Freiheitsübungen zu ermöglichen.

Harald Welzer plädiert für eine offene Gesellschaft; Foto: Jörg Briese
Denken ist ein großes Vergnügen, meinte Brecht, aber eben auch anarchisch und gefährlich. Dieser ganze sinnentleerte Kulturtrubel, der nur noch dem Profit, den Zuschauerzahlen und der Standortkonkurrenz verpflichtet ist, das ganze sich totlaufende Eventkarussell als austauschbare Fun-Fassade scheinen mir gewollt. Da sollen sich die Leute zu Tode amüsieren, statt über die Zukunft des Gemeinwesens zu diskutieren.
Wüssten Sie ein Gegengift?
Manchmal wünsche ich mir, ein zweijähriges Moratorium, wie es Hans Magnus Enzensberger 1993 in der FAZ gefordert hat, würde endlich umgesetzt und wir lassen den ganzen hypernervösen, von Sponsoren und öffentlichen Förderern abgerichteten Literaturbetrieb zwei Jahre ruhen, um Literaturförderung neu auszurichten. Das Geld sollte stattdessen dem Erhalt und Ausbau der Bibliotheken zugutekommen. Wer dennoch Literatur auf die Bühne bringen will: okay! Aber das soll man bitte aus der eigenen Tasche oder der der Zuhörer zahlen. Wie viel Zeit wir gewinnen würden fürs Lesen, Nachdenken und für Gespräche!