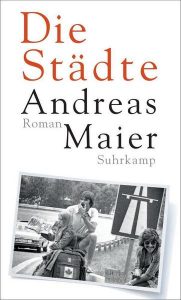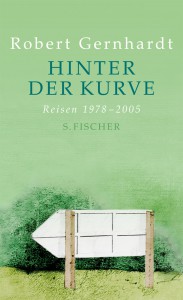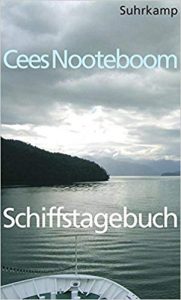Unterwegs fast nichts erlebt – Andreas Maiers Anti-Reise-Roman „Die Städte“
Zählen wir mal kurz auf: Wer Andreas Maiers kompakte Romane wie „Das Zimmer“, „Das Haus“, „Die Straße“, „Der Ort“, „Der Kreis“, „Die Universität“ und „Die Familie“ (puh!) goutiert hat, meint vielleicht, im Leben des Autors quasi heimisch geworden zu sein. Doch das ist wohl ein Trugschluss. Wer weiß schon, welchen Anteil Findung und Formung an all dem haben.
Und überhaupt hat ja vieles seine Kehrseite – wie auch im neuen, abermals wortkarg benannten Buch „Die Städte“. Gewiss, da kommen einige Orte namentlich vor, doch falls man markante Reiseerlebnisse erwartet, wird man düpiert – oder auf andere Fährten geführt. Andreas Maier hält bei all dem einen lakonisch registrierenden Tonfall, der das Groteske an äußerer Mobilität bei innerer Unbeweglichkeit erst recht hervortreten lässt.
Bloß schnell an Nürnberg vorbei
Schon das Kapitel „Nürnberg, Brenner, Brixen“ hat es (nicht) in sich. Es erweist sich als Schilderung der alljährlichen, ungemein öden Familien-Anreise zum Sommerurlaub in Südtirol, die einer seltsamen Flucht gleicht, auf der man es unbedingt früh an Nürnberg vorbei geschafft haben muss. Da geht’s um irrwitzig eingerastete Rituale – wie und wann die Mutter im Auto etwas zum Verzehr anbietet, wie der Ich-Erzähler sich als Kind in seine Asterix-Hefte vergraben hat, wie die immergleichen Parkplatzmanöver und Einkäufe für die Ferienwohnung verlaufen sind. So sehen die gerafften Notizen zum „Geschehen“ denn auch aus:
„Tage drei Ausflug Kalterer See, Fahrtzeit eine Stunde hin, eine zurück.
Tag vier einkaufen, Mittagessen beim Stremnitzer, Sanitärgeschäft.
Tag fünf Fahrt zur Seiser Alm (45 min), dort parken auf einem riesigen Parkplatz…“
Ganz schön was los.
Von derlei Ferienreisen hält der Junge prinzipiell nichts: „…der Urlaub ist lang, und ich fürchte mich schon im voraus vor ihm, wie vor jedem Urlaub. Ich fürchte mich davor, wochenlang das Haus und mein Zimmer verlassen zu müssen und an einen anderen Ort zu kommen, wo ich mich zu anderen Menschen verhalten und mit ihnen reden soll…“
Im nächsten Kapitel geht es nach Athen. Schon aufregender? Von wegen. Der Erzähler, inzwischen ein paar Jahre älter, hat sich noch einmal hinreißen lassen, mit den Eltern zu fliegen und sich zugleich vorgenommen, ihnen die Reiselaune zu versauen.
Ouzo „wie ein Grieche“ schlürfen
Es geht also kaum um die Städte, sondern um Pein und Peinlichkeit des Reisens. Einigermaßen tragfähige Erfahrungen, so ahnen wir, macht höchstens der Sohn, wenn er stundenlang in einer Bar abhängt und sich – nach Landessitte Ouzo schlürfend – „wie ein Grieche“ fühlt, während die Eltern den Reiseführern zu den antiken Stätten nachhecheln. Oder sind das allseits nur Einbildungen? Sind das allesamt fruchtlose Unterfangen?
Sodann Biarritz. Nunmehr, mit 16 Jahren, unterwegs mit einem verkorksten Typen, der überall nur auf Brüste und Pos starrt, sich aber nicht traut, Mädchen anzusprechen. Ein kurzes, aber starkes, sozusagen leichthin verdichtetes Stück über klägliche Orientierungslosigkeit, aber auch Lässigkeit in diesem Lebensalter. Es weht einen geradezu an.
Und was ist mit Oulx (Skiort bei Turin)? Nun, da ist der Erzählende allein hingereist, fest entschlossen, sich dort umzubringen. Aber es wird nichts draus, das Ansinnen versandet. Und dann ist da ja noch diese verwirrend Schöne in der Pizzeria… Das Ganze mündet in eine einwöchige Sauferei und Fresserei. Auch keine Offenbarung. Aber doch irgendwie tröstlich.
Alles nur schön und eindrucksvoll
Der merkwürdige Dreiklang „Bangkok, Friedberg, Marrakesch“ verheißt gleichfalls abstruse Nicht-Erlebnisse. Eine Bekannte präsentiert Fotostapel von ihrer gerade mal fünftägigen Bangkok-Reise und vermag zu jedem Bild nicht mehr zu sagen, als dass dies und jenes schön und eindrucksvoll gewesen sei. Quälend für den Zuhörer.
Sich daran erinnernd, hebt der Erzähler, damals Student der Altphilologie, zu einer kleinen Suada über inhaltslose, sinnfreie Reise-Erinnerungen an: „Diese Erzählungen können zum Prahlen dienen, dann sind sie am unangenehmsten. Oft führen sie schlicht zur Förderung des Selbstwertgefühls beim Erzählenden (…) Die Zuhörer reagieren, indem sie Dinge ausrufen wie: Das ist ja schön, das ist ja toll, daß du das erlebt hast…“ Und so weiter, desillusioniert bis auf den Grund. Da grinst einen das Nichts an.
Schließlich Weimar, wo der Berichtende als junger Schriftsteller eintrifft – in der damaligen „Kulturstadt Europas“ (1999). Ein wahnwitziger Massentourismus ergießt sich (vermeintlich „auf Goethes Spuren“) in die kleine Stadt, dazwischen lungern immer wieder Neonazi-Trüppchen und Einheimische, die sich bedrängt fühlen, alle Fremden misstrauisch beäugen oder gar anblaffen. Nochmals eine Karikatur des Reisens und seiner Wirkungen.
Das bleibt man doch besser gleich zu Hause, oder?
Andreas Maier: „Die Städte“. Roman. Suhrkamp. 192 Seiten. 22 Euro.