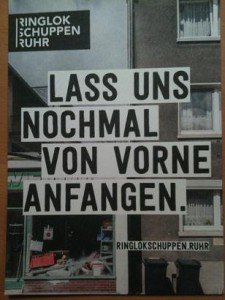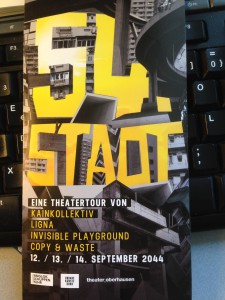Ringlokschuppen Mülheim: Pleite, Party oder Perspektive für Kunst und Kultur?
Die Lokalpresse in Mülheim hatte apodiktisch getitelt: „‘Ringlokschuppen‘ vor dem Aus“. Doch ob das Zentrum im MüGa-Park zum 31. Dezember 2014 tatsächlich seine Arbeit beendet oder ihm – nach personell-finanziellem Umbau – ein Neustart gelingen könnte, scheint zum Glück wieder offen. Und das ist gut so.
Für den Nikolaussamstag lud deshalb Holger Bergmann, als Künstlerischer Leiter zurückgetreten, zum Gespräch ein: „morgen um 19h im ringlokschuppen für alle, die mit uns reden möchten über das was war – was ist und was sein könnte…“
„Dem Volke zum Wohlgefallen“
Nicht ein Parkplatz war abends zu finden – dies aber war nicht regem Interesse an der Ringlok-Zukunft geschuldet. Nebenan am Schloss Broich feierte man die „Schloss Weihnacht“. „In mittelalterlichem Ambiente erleben die Besucher (…) besinnliche Stunden mit Mittelaltermarkt und dem einzigartigen Krippenspiel.“ „Für weiteren Zeitvertreib und ‚dem Volke zum Wohlgefallen‘ sorgen die Gaukler …“
Nicht ganz so besinnlich, sondern besonnen-sachlich ging es beim öffentlichen Gespräch mit Holger Bergmann zu – ihm zur Seite Matthias Frense, Geschäftsführender Dramaturg und wohl bald neuer Leiter des Hauses. Etwa 50 Interessierte waren gekommen, um zu hören, was die beiden (parallel zum Tanzstück „Solidarität“ von Gudrun Lange) zu sagen hatten.
Um den heißen Brei wurde nicht lang herumgeredet – und einiges hatte die WAZ zuvor aktuell berichtet. Ja, trotz kaufmännischer Geschäftsführung und Controlling seien handwerkliche Fehler gemacht worden. Nach Großprojekten wie dem Stadtjubiläum 2008 und der Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr.2010 sei der Personalstamm nicht rechtzeitig reduziert worden. Zudem wären Entlassungen auch arbeitsrechtlich nicht ganz einfach zu machen gewesen. Tatsächlich sei es wohl so, dass die Schulden von rund 400.000 Euro (davon allein ca. 130.000 Euro Mietschulden bei der Stadt Mülheim) nicht rechtzeitig in dieser Größenordnung zu sehen gewesen wären. Der kaufmännische Geschäftsführer Peter Krause habe die Verantwortung für diese handwerklichen Fehler übernommen (und einem Auflösungsvertrag zugestimmt – so die WAZ.)
Von Peter Krause selbst konnte man in der WAZ vom 6.12. lesen: „‘Die finanzielle Situation war schon immer prekär‘, erklärte Krause gestern. Häuser wie der Ringlokschuppen, der schon seit Jahren kein soziokulturelles Zentrum, sondern ein Produktionshaus ist, seien chronisch unterfinanziert. Man erhalte zwar eine Förderung der Stadt (netto, abzüglich Miete für die MST 500.000 Euro) und vom Land, das reiche aber nicht, um die Fixkosten zu decken.“
Kulturschirmchen oder im Regen stehen?
Natürlich wunderten sich die Gäste am Nikolausabend über diese Bescherung, und wollten wissen, wann, wie, wo genau diese Schulden sich angehäuft hätten. Da müsse Transparenz her, auch, um ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Viel Verständnis gab es dennoch für die prekäre Lage von Produktionsorten wie dem Ringlokschuppen. Und sicher wäre es nicht die erste Kulturinstitution, deren strukturelles Defizit durch Retter aus Stadt, Region, Land aufgefangen werden könnte, wenn es denn nur politisch gewollt wäre. Wo es für Bankenschirme in Milliardenhöhe reiche, da werde doch ein solches Defizit abzufedern sein, durch zinsgünstige Kredite, Zahlungsaufschübe, Ratenzahlung, Benefiz, Teil-Schuldenerlass und Personalabbau sowieso.
So viel wurde aber auch deutlich: Vor einem Neuanfang steht nicht nur Ursachenforschung, sondern viele Gespräche sind nötig – vielleicht im Rahmen eines Planinsolvenzverfahrens. Besser wäre jedoch, ein solches Verfahren könnte abgewendet werden, weil andere Lösungen gefunden würden.
Kurzschlüsse und „Licht aus“
In Mülheim aber wollen viele die Möglichkeiten eines Neustarts gar nicht erst prüfen. Da wird in Internet-Kommentaren nach dem Staatsanwalt gerufen, da wird die Rückkehr des Ringlokschuppens zur Event-Zone gefordert, wird behauptet, die exzellente Kunst- und Kulturarbeit des Zentrums sei ein Flop gewesen, da sei gekungelt und geprasst worden, Massenkompatibilität müsse jetzt her, überhaupt der ganze Laden solle Partylocation, Studentenwohnheim oder gleich durch einen Investor zu Lofts zerstückelt und verhökert werden. Die üblichen Besserwisser-Sprüche also. Das antikünstlerische und antiintellektuelle Ressentiment lebt sich aus und fühlt sich im Recht.
Perspektiven
Die Frage ist aber, ob die Diskussion um die Zukunft des Ringlokschuppens sich in populistischen Posen bereits erschöpft hat oder Perspektiven noch halbwegs sorgfältig durchdacht werden können. Und da gäbe es einige, wobei die Abwicklung des Hauses wohl die gedankenloseste Alternative wäre. Zwar „sparte“ die Stadt damit zukünftig städtischen Zuschuss, verzichtete aber auch auf Mieteinnahmen durchs Ringlok in sehr respektabler Höhe. Auch die aufgelaufenen Mietaußenstände könnten für den Gläubiger Stadt weitgehend verloren sein. Und nicht zu vergessen, selbst ein geschlossenes Haus verursacht erhebliche Kosten: Instandhaltung, Heizung, Strom, Wachdienst, Versicherungen, Ausbesserung der Schäden durch Leerstand und Vandalismus.
Hinzu käme bei einer Schließung das blamable Eingeständnis, dass in Mülheim als Stadt am Fluss vieles nicht mehr im Fluss ist. Als Theaterstadt verlöre Mülheim an Bedeutung, die renommierten, auch ins Land ausstrahlenden Produktionen des Ringlok fielen aus, das reichhaltige Kulturangebot in den Sparten Musik, Tanz, Kabarett, Literatur , Cross-Over ginge verloren, es gäbe einen Szene- und Jugendtreff weniger in der Stadt, eine zunehmend verödende Mitte.
Verwandlung – aber bitte nicht nur im Ringlokschuppen
Der Ringlokschuppen wird sich hoffentlich neu erfinden. Aber mit welchem Konzept genau? Der Ringlokschuppen ‚nur‘ noch als profilierter Theater-Produktionsort (neben dem Theater an der Ruhr und den Stücke-Tagen)? Warum nicht. Dennoch: Mülheim braucht das Haus auch als Ort gesellschaftlichen Lebens, als Ort geistigen Austausches, als Experimentierfeld für Kunst und Kultur insgesamt.
Es wird Zeit, dass die Kulturpolitiker in Mülheim hier ihrer eigenen Verantwortung gerecht werden und die in Mülheim – wie auch anderswo – längst überfällige kulturpolitische Diskussion über einen Kulturentwicklungsplan in ihrer Stadt zumindest organisierten – wenn sie denn schon nicht in der Lage sind, sie selbst zu führen. Und wer, wenn nicht die Kommunalpolitik, weiß, wie man Schulden macht und gelassen weiterlebt?
Unter dem Druck des Ringlok-Defizites und der Rahmenbedingungen einer überschuldeten Kommune darf Politik nicht die Gelegenheit beim Schopfe fassen, bloß noch abzuwickeln und Zuschüsse zu kürzen. Dies bedeutet den weiteren Niedergang einer Kulturpolitik im Ruhrgebiet, die übers Defizit im Ringlok nur ihre eigenes Politik-Defizit überspielt.
Dass mittlerweile vor und hinter den Kulissen um die Rettung des Ringlokschuppens gekämpft wird, machten Äußerungen Matthias Frenses gegenüber der WAZ deutlich. Man hofft auf „Hilfen des Landes oder einer Stiftung, um das Überleben zu sichern. Die Stadt, so viel steht fest, kann finanziell nicht helfen, zumindest nicht in der geforderten Größenordnung. Das hat die Bezirksregierung auf Anfrage des Kämmerers schon klar gemacht…“
Lehrstück Ringlokschuppen
Der Ringlokschuppen hat mit seine urbanen Eingreifprojekten, mit seinen Interventionen ins und Impulsen fürs städtische Leben Maßstäbe gesetzt. Wie sehr das national und international beeindruckt, kann man in den Solidaritätsbekundungen nachlesen, die der Ringlokschuppen zurzeit erhält. Nun ist er also selbst als urbanes Projekt in den Fokus geraten und aus dem Spiel um die Zukunft der Stadt wird bitterer Ernst. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob der Ringlokschuppen als Kulturzentrum und Produktionsort der Künste verschwindet oder sich eine neue Perspektive erstreitet – und diese absichert. Zeitdruck und Geldmangel dürfen dabei nicht alles bestimmend sein. Am Umgang mit dem Ringlokschuppen in Mülheim selbst, aber auch in der Region, im Land wird sich zeigen, ob man sich längs der Ruhr in Zukunft die Gestaltung von kulturellen und künstlerischen Prozessen immer öfter erspart, oder ob man gemeinsam daran arbeitet, dass aus der einstigen Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr.2010 nicht die kommende Kulturnekropole Ruhr.2020 wird. Eine, die jetzt schon zu viel hat: zu viel Brot und Spiele, Feuerwerk und Stelzenläufer, zu viel Mittelalter und Krippenspiel. Vielleicht werden die Menschen hier bald nur noch ‚bespielt‘ und keiner weiß mehr, wie das geht, selbst spielen, selbst denken.