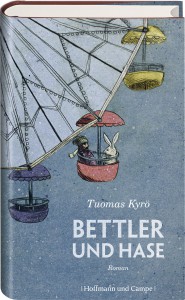Warum das Zigeunerleben gar nicht lustig ist – eine moralische „Odyssee“ in Essen
Vorn auf der Bühne sitzt eine Gruppe übermütiger, weiß gekleideter Männer und Frauen um den Tisch herum, isst, trinkt und schwadroniert – stets im Chor – über ihre Reise, die andauert, weil sie sich ziemlich verpeilt haben. Die Gruppe ist in ihrer Gesamtheit offenbar Odysseus, nämlicher Held der Odyssee, der auf seiner zehn Jahre währenden Rückreise von Troja nach Ithaka einer Menge verstörender Wesen und Gesellschaften begegnete.

Von links: Axel Holst, Ines Krug, Jan Jaroszek, Thomas Meczele, Stephanie Schönfeld, David Simon (Foto: Theater Essen/Thilo Beu)
Weiter hinten auf der Bühne finden im Verlauf des Stücks die Begegnungen mit den Fremden statt. Hier kommen die Zigeuner ins Spiel, die der Titel ankündigte. „Die Odyssee oder: Lustig ist das Zigeunerleben“ heißt die Produktion, die jetzt im Essener Grillo-Theater ihre Uraufführung erlebte und für die Regisseur Volker Lösch („nach Homer mit Texten von Roma, Sinti und Gadsche“) auch die Textfassung erstellte.
Man sieht: Dem Projekt liegt ein konzeptioneller Gedanke zugrunde, nämlich der, dass Homers Begegnungen mit dem Fremden in unseren Begegnungen mit den „Zigeunern“ eine Analogie haben. Lustig ist das Zigeunerleben bei den Lotophagen, gefährlich aber sind diese Leute, wenn sie als menschenfressende Zyklopen daherkommen. Und ihr skandalöser Umgang mit Frauen – aber auch das skandalöse Verhalten der Frauen selbst – findet Entsprechungen in den Episoden mit Circe, Calypso oder den Sirenen.
Die exotischen Völker und Figuren spielt eine sechsköpfige Roma-und-Sinti-Gruppe, die ihre Rollen in jeder Episode jedoch zügig verlässt, um mit trotziger Attitüde vorzutragen, wo und wie sie benachteiligt werden – in der Schule, bei der Arbeit, bei der Wohnungssuche und so fort. Insbesondere die Behandlung der Sinti und Roma in südosteuroäischen Ländern wird gegeißelt, und die just am Tag der Uraufführung beschlossene Änderung des Asylrechts, die Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina per Gesetz zu „sicheren Herkunftsstaaten“ macht, wird als Ungeheuerlichkeit geschmäht.
Die politischen Mißstände sollen nicht bestritten werden, doch das macht die Inszenierung nicht besser. Leider gilt wie oft auch hier, daß gut gemeint nicht immer gut gemacht ist. Die Verknüpfung von Odyssee und Roma-und-Sinti-Problematik wirkt weit hergeholt, Aha-Erlebnisse bleiben aus; der Duktus der Aufführung ist trotz der munteren weißen Partytruppe hölzern, der ermüdende Textvortrag ausschließlich im Chor hat daran erheblichen Anteil. Zudem monologisieren die jungen Roma und Sinti fast ausnahmslos von der Rampe in das Publikum hinein. Auch wenn sich „Schwarz“ und „Weiß“ auf der Bühne manchmal ziemlich nahe kommen, Rollen und Kostüme zum immer besseren Verständnis in einer Szene gar getauscht sind, finden Dialoge praktisch nicht statt.

Von links: Faton Mistele, David Simon, Axel Holst, Sandra Selimović, Slaviša Marković, Melanie Joschla Weiß, Thomas Meczele, Ines Krug, Nebojša Marković, Stephanie Schönfeld (Foto: Thilo Beu/Schauspiel Essen)
Die zornige Selbststilisierung der jungen Roma-und-Sinti-Darsteller als Opfer von Ausgrenzung, Ausbeutung, Rassismus und so weiter in Vergangenheit und Gegenwart wirkt selbstgefällig und wenig produktiv. Dem Regisseur sollte zu denken geben, dass die Jugend mit ihrem manchmal recht feinen Gespür für Richtig und Falsch das Wort „Opfer“ vor Jahren schon zu einem Schimpfwort gemacht hat, wahrscheinlich nicht zuletzt wegen seines inflationären Gebrauchs. Eine stanzenhafte Aufteilung der Gesellschaft in Opfer und Täter, wie Lösch sie unterschwellig vornimmt, ist auch aus diesem Grund geradezu kontraproduktiv. Überdies bestätigte sie übelwollenden Teilen des Publikums (falls vorhanden) auf perfide Weise, dass Zigeuner eben anders sind.
In späteren Szenen erzählen die sechs Sinti-und-Roma-Schauspieler von sich persönlich, ihrer Selbstwahrnehmung und ihrem Selbstverständnis in einer Welt der „Weißen“ (Nicht-Sinti-und-Roma), von ihren Berufswünschen (Filmemacher, Musiker, Schauspieler…), vom Stress untereinander und in archaischen Familienstrukturen. Unübersehbar besteht hier die inszenatorische Absicht, Vorstellungen von grundlegender Andersartigkeit ad absurdum zu führen. Nur war die Andersartigkeit bis dahin lediglich eine Behauptung, der man folge konnte oder auch nicht. Und mit der Odyssee hat das alles gar nichts zu tun, eher mit dem brachialen Welterklärungsdrang dieser Inszenierung.

Von links: David Simon, Thomas Meczele, Axel Holst, Ines Krug, Jan Jaroszek, Stephanie Schönfeld (Foto: Thilo Beu/Schauspiel Essen)
Ein Lob verdient die Ausstattung von Carola Reuther (Bühne, Kostüme, Projektionen), die ein halb offenes, auf einer Drehbühne installiertes weißes Haus in hübscher dialektischer Manier zur Spielstätte der Fremden wie auch zur Projektionsfläche spießbürgerlicher Sehnsüchte wie auch Überfremdungsängste macht. Erst ganz am Schluss werden hier statt bunter Hintergrundbeleuchtungen richtige Farben auf die Wand geworfen. Wenn Odysseus und seine Mannen sich anschicken, Penelope von ihren „Freiern“ zu befreien und ein gnadenloses Blutbad anrichten, zerplatzen blutrote Farbbeutel auf der weißen Wand. Eine feinsinnige Klimax, immerhin.
Die nächsten Termine: 26. Sept., 10. und 19. Okt.
Telefon: 02 01 / 81 22-200
Info-Hotline: 02 01 / 81 22-600
E-Mail: tickets@theater-essen.de
Infos: http://www.schauspiel-essen.de/stuecke/die-odyssee.htm