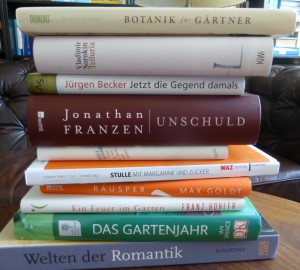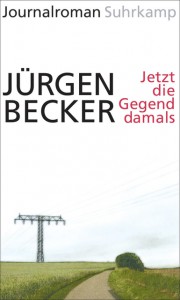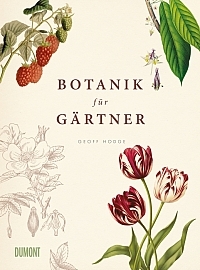Wunderbare Vielfalt in Frankfurt: Aspekte der Romantik bei Scartazzini, Britten und Flotow

Vor der Bücherwand: Nathanael (Daniel Schmutzhard) und seine unheimlichen Gäste, der Vater (Thomas Piffka) und sein Kumpel Coppelius (Hans Jürgen Schöpflin). Foto: Monika Rittershaus
Was für eine Vielfalt! An der Oper Frankfurt lässt sich in den ersten Wochen der neuen Spielzeit nicht nur die ungewöhnliche „Carmen“ Barrie Koskys und demnächst die Verdi-Rarität „Stiffelio“ besichtigen. Im Bockenheimer Depot, einer gründerzeit-lichen Straßenbahn-Remise, wurde Benjamin Brittens selten aufgeführte amerikanische Operette „Paul Bunyan“ neu inszeniert. Und das Große Haus eröffnete den Premierenreigen mit einer Deutschen Erstaufführung, Andrea Lorenzo Scartazzinis „Der Sandmann“ – vor vier Jahren in Basel uraufgeführt.
Dazu kommt noch Friedrich von Flotows „Martha“, nicht als verlegener Tribut ans naiv-komische Genre, sondern als Chefstück prominent gewürdigt: GMD Sebastian Weigle selbst dirigiert und fügt damit seiner Beschäftigung mit der deutschen romantischen Oper einen weiteren wichtigen Aspekt hinzu.
Wenn man so will, lassen sich aus den drei Frankfurter Inszenierungen unterschiedliche Aspekte der Romantik herauslesen: Flotows unterhaltsames Werk steht für die Verniedlichung des Romantischen, wie es sich bis heute in Herzchenkitsch und Liebesschnulzen gehalten hat – ungeachtet der stillen Ironie, die man in „Martha“ hinter biedermeierlicher Camouflage entdecken kann.
Brittens „Paul Bunyan“ thematisiert einen spezifischen Aspekt eines „american dream“, einen riesenhaften Holzfäller, zu Beginn des 20. Jahrhunderts popularisiert durch einen Journalisten und eine Werbekampagne. Scartazzinis „Der Sandmann“ dagegen baut auf E.T.A. Hoffmanns vor 200 Jahren erschienener Erzählung, kreist um krankhafte wie metaphysische Aspekte der deutschen Romantik und stellt letztlich die Frage, wie zuverlässig unsere Erkenntnis von Wirklichkeit ist.
Christof Loys Inszenierung – die Übernahme der Uraufführungsproduktion aus Basel – hält den Sandmann-Stoff in der Schwebe: Der Lichtrahmen der Bühne von Barbara Pral lässt das Innere des Raum-Kastens von Anfang an diffus erscheinen; das Licht von Stefan Bolliger changiert zwischen den unheimlichen Lichteffekten des film noir, schemenhaft ausgeleuchteten Stimmungsbildern und hartkantiger Helle.
Scartazzinis Librettist Thomas Jonigk kombiniert einige Motive aus Hoffmanns „Sandmann“, um zu schildern, wie der Schriftsteller Nathanael jegliche Gewissheit von „Realität“ verliert. Tote erscheinen, Getötete stehen wieder auf. Ob Nathanael sein Werk je vollendet hat oder nicht über ein paar Zeilen hinausgekommen ist, bleibt unklar. Er ist jedenfalls von gestapelten Büchern umgeben.

Barbara Prals Bühne für Scartazzinis „Der Sandmann“ gibt dem Unheimlichen und Uneindeutigen Raum. Foto: Monika Rittershaus
Ob seine hellsichtig argumentierende Partnerin Clara real ist oder sein gespaltenes Bewusstsein repräsentiert, bleibt ebenso ungreifbar wie die Existenz der automatenhaften Clarissa, die am Ende mit Claras Erscheinung verschmilzt und sich vervielfältigt. Der Begriff des „Realen“ verschwimmt auch bei den beiden sinistren Gespenstern, dem Vater (Thomas Piffka) und seinem Kumpel Coppelius (Hans Jürgen Schöpflin), die es in Nathanaels Kindheit bei alchemistischen Experimenten in einer Explosion zerrissen hat. Sind die halb komödiantischen, halb unheimlichen Figuren materialisierte Traumata, sind sie Boten aus einer dunklen Anderswelt?

Agneta Eichenholz (Clara) und Daniel Schmutzhard (Nathanael) in der E.T.A.-Hoffmann-Oper „Der Sandmann“ von Andrea Lorenzo Scartazzini an der Oper Frankfurt. Foto: Monika Rittershaus
Der Zuschauer kann sich genauso wenig wie Nathanael selbst orientieren, die Ebenen überlagern sich, der Spuk mag eine transzendente Wirklichkeit haben oder sich aus einem wahnbefallenen Geist gebären. Loys Regiekunst transzendiert den scheinbaren Realismus in eine albtraumhafte Sphäre, in der das Groteske selbstverständlich und das Alltägliche absurd wirkt. Er hat mit Daniel Schmutzhard einen ausdrucksstark singenden und überzeugend agierenden Darsteller des Nathanael; Agneta Eichenholz wandelt als Clara und Clarissa virtuos auf der Trennlinie zwischen der besorgten, bestürzten Frau und der automatenhaften Kunstfigur.
Hartmut Keil und das Orchester leuchten die Facetten von Scartazzinis vielgestaltiger Musik mit der in Frankfurt üblichen Sorgfalt aus. Die Modernität der Romantik – hier wird sie nachvollziehbar. Das ist Oper von heute, packend, überzeugend, relevant. Zum Nachspielen empfohlen!
Im Falle von Benjamin Brittens „Paul Bunyan“ dürfte es schwieriger sein, die „Operette“ ohne Weiteres fürs Repertoire zu empfehlen. Das liegt nicht so sehr an dem 1941 uraufgeführten und von Britten erst 1975 in einer überarbeiteten Version wieder aus der Schublade geholten Stück. Sondern eher an den Bedingungen der Rezeption: Der Zuschauer muss schon sehr vertraut sein mit der säkularen amerikanische Mythologie des Super-Helden, mit dem Kolonisten-Optimismus der Gesellschaft und mit Klischees amerikanischer Populärerzählungen, um die Geschichte um den gigantischen Holzfäller – und die leise Ironie des Librettos von Wystan Hugh Auden – attraktiv zu finden.
Brigitte Fassbaender hat in ihrer Regie kluge Brücken gebaut und das Stück damit kurzweilig und vielschichtig erzählt. Ein riesiger, schrundiger Baum verdeckt zunächst die Bühne, bis das Licht die Spielfläche von Johannes Leiacker freigibt: ein Haufen löcheriger, zerbeulter Campbell’s Konservendosen (ein amerikanischer Konsum- und seit Andy Warhol auch ein Kunst-Mythos).
Paul Bunyan selbst bleibt körperlos; er manifestiert sich wie eine quasi-göttliche Stimme aus dem Irgendwo, mit wissender Ironie gesprochen von Nathaniel Webster. Zu sehen ist nur ein Mund, auf den Riesenstamm projiziert, mit blendend weißem Trump-Gebiss.
In den Kostümen Bettina Münzers wird das amerikanische Cowboy-Klischee ebenso zitiert wie Bunnies aus der Show oder Tiere aus dem Comic. Zwei unverfrorene Katzen – Julia Dawson und Cecelia Hall – tragen Mäusebälger als Handtaschen und singen lapidar-frivole Duette, aber ihre Kleidchen erinnern an Hausfrauen-Kittelschürzen. Sebastian Geyer verkörpert mit der Figur des Hel Henson den wortkargen Macho, dem man gerne abnimmt, dass er erst schießt und dann denkt.

Tiere auf der Bühne kommen immer gut: Julia Dawson (Moppet), Sydney Mancasola (Fido) und Cecelia Hall (Poppet) in Brittens „Paul Bunyan“. Foto: Barbara Aumüller
Die vielleicht spannendste Person aus Brittens groß besetztem Werk ist Johnny Inkslinger: ein Intellektueller, der sich zunächst um Geld und materielle Absicherung nicht schert. Doch auch er muss essen, und die pure Notwendigkeit macht ihn von Paul Bunyan abhängig: Er muss sich als Buchhalter verdingen und wird schließlich, als er den geisttötenden Job hinter sich lassen will, nach „Hollywood“ gelockt. Michael McCown macht deutlich, wie ein unabhängiger Geist seine Autonomie verliert. In der Unterhaltungsindustrie wirkt der frei sich wähnende Geist effektiv im Dienst kapitalistischer Verwertung. Brittens Blick auf das Amerika der Weltkriegszeit dürfte nicht zuletzt seinem eigenen und dem Schicksal anderer europäischer Komponistenkollegen geschuldet sein.
Einer dieser Kollege war Kurt Weill – und Brittens „Paul Bunyan“ erinnert streckenweise an die lehrstückhaften Werke aus Weills amerikanischer Zeit, etwa den „braven Soldaten“ Johnny Johnson. Britten setzt als Zwischenspiele Balladen im Country-Stil ein, in Frankfurt stilsicher vorgetragen und selbst auf der Gitarre begleitet von Biber Herrmann, einem Folk- und Blues-Sänger und Songwriter aus dem Rhein-Main-Gebiet.Tanz

Tanz auf der Dose: Johannes Leiackers attraktive Bühne für Brigitte Fassbaenders kluge Regie, hier eine Szene mit Michael McCown (Inkslinger) und Ensemble. Foto: Barbara Aumüller
Brittens Musik, vom Orchester beweglich, rhythmisch sensibel und mit Sinn für die leuchtkräftigen Farben und subtilen Zwischentöne gespielt, hat in Dirigent Nikolai Petersen einen aufmerksamen Anwalt gefunden. Sie erinnert an Weill, Gershwin und Cole Porter, an anglikanische Kirchenhymnen und Gilbert-and-Sullivan-Couplets, an melancholische Blues-Balladen und kernigen Folk. Vor allem aber behält sie in ihrer ironischen Zuspitzung und ihrem humorvoll gebrochenen Blick auf die Vorbilder ihren unverwechselbaren Britten-Charakter. „Getriebe, die knirschen“, nannte Leonard Bernstein diesen vertraut-verfremdeten Stil – und „Paul Bunyan“ ist reich an gekonnten Beispielen dafür.
Von daher gehörte diese amerikanische Operette dann doch hin und wieder in die Spielpläne, vor allem dann, wenn sich das eine oder andere Haus auf seine Britten-„Zyklen“ oder die „Pflege“ seines Werkes etwas einbildet.
Abgelegene Opern wie „Gloriana“ (vor Jahren in Gelsenkirchen), „Owen Wingrave“ (eindrucksvoll in Frankfurt und höchst gelungen am Theater Osnabrück) oder eben „Paul Bunyan“ eröffnen aufschlussreiche Blicke auf Brittens musikalische Kosmos und lassen sich, werden sie so wissend und bildmächtig inszeniert wie durch Brigitte Fassbaender in Frankfurt, auch dann verstehen, wenn der historische oder gesellschaftliche Background nicht mehr so unmittelbar einleuchtet wie etwa in „Peter Grimes“. Frankfurt erweitert damit seine Befassung mit Brittens Werk um eine faszinierende Facette.
Information und Aufführungstermine: www.oper-frankfurt.de