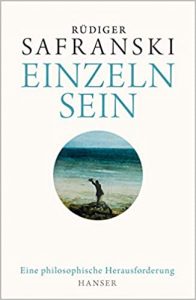Abstand von der Gesellschaft gewinnen – Rüdiger Safranskis philosophisches Buch „Einzeln sein“
Der vielfach bewanderte Gelehrte Rüdiger Safranski hat sich ein Thema von geradezu universellem Gewicht vorgenommen: Wie verhalten sich Individuen und Gesellschaft zueinander, wie steht überhaupt das Einzelne zum großen Ganzen? Hierzu unternimmt Safranski einen Streifzug, der vornehmlich durch die abendländische Philosophie-Geschichte führt.
Die Geistes- und Gedankenreise geleitet uns zunächst in die Renaissance mit ihrer nicht zuletzt geldwirtschaftlich bedingten Freisetzung des Individuums, und zu Martin Luther, der den Gottesglauben als Sache des Einzelmenschen betrachtete, unabhängig von (kirchlichen) Institutionen. Sodann gelangt Safranski zu Michel de Montaigne, der im höchst persönlichen Denken eine Zuflucht vor gesellschaftlichen Zumutungen suchte. Er wollte im Denken schlichtweg seine Ruhe finden und Abstand gewinnen. Jean-Jacques Rousseau schwankte später zwischen den Extrempolen einer völligen Preisgabe an den Staat („Du contrat social…“) und einer Absolutsetzung des Selbst („Émile“).
So geht es fort und fort mit all den individuellen Selbstbehauptungen und – Achtung, Modewort! – Selbstermächtigungen. Im Wesentlichen seien noch genannt: Diderot, Stendhal, Kierkegaard, Max Stirner, Henry D. Thoreau, Stefan George, Max Weber, Ricarda Huch, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre und Ernst Jünger. Bemerkenswert, dass beispielsweise Kant, Hegel, Schopenhauer und Nietzsche oder auch Karl Marx und Ernst Bloch keine oder wenigstens keine nennenswerten Exkurse gewidmet sind. Auch Stimmen aus der angloamerikanischen Welt kommen kaum vor. Vielleicht waren sie aus Safranskis Sicht im Sinne der Fragestellung nicht ergiebig genug?
Noch erstaunlicher, dass diese geistesgeschichtlichen Recherchen mit einem wie Ernst Jünger aufhören und keine neuere Fortsetzung mehr finden. Was mag Safranski zu dieser Entscheidung bewogen haben? Hat er Auswahl und Bewertung gescheut, weil die Rangstellung im Kanon noch nicht ausgemacht ist? Wollte er es sich mit gegenwärtig Philosophierenden nicht verderben? Oder hält er sie nicht für satisfaktionsfähig?
Freilich mündet das Buch auch in die akute Frage nach dem Internet, das (via Algorithmen) gleichzeitig passgenau die Einzelnutzer bedient und doch ein übermächtiges Ganzes verkörpert. Hat das Allgemeine und Gesellschaftliche sich damit endgültig und unumkehrbar der Individuen bemächtigt – und das ausgerechnet im Gewand je besonderer, individueller Ansprache? Oder können die Einzelwesen – wie es der Existentialist Sartre postulierte – auch jetzt noch in jedem Augenblick ihre Freiheit ergreifen?
Nun gut, es liegen fürwahr schon einige andere Philosophiegeschichten vor. Doch selbstverständlich bietet auch dieses Buch immer wieder interessante Perspektiven und Passagen; schon deshalb, weil es stets Gewinn verheißt, Gedanken reger Geister wenigstens ansatzweise nachzuvollziehen. Zwar macht Safranski auf innere Widersprüche gewisser Theorien aufmerksam, doch lässt er eigentlich allen Protagonisten Gerechtigkeit widerfahren. Mehr noch: Es ist allemal ein Kapitel wert, welch hochanständige und couragierte Haltung Ricarda Huch zur NS-Zeit bewiesen hat. Distanz zum Gesellschaftlichen kann durchaus eine Widerstandshandlung sein.
Noch heute wird einem hingegen unbehaglich zumute, wenn manche Gedankengänge Georges, Stirners, Heideggers und Jüngers zur Sprache kommen. Gleichwohl bleiben auch Um- und Abwege des Geistes aufschlussreich. Überdies ist es um so erhebender, wie Hannah Arendt dem Sein zum Tode ihres vormaligen Gefährten Heidegger eine Philosophie der stets neu beginnenden „Geburtlichkeit“ entgegengesetzt hat. Sollte dies etwa ein spezifisch weiblicher Ansatz gewesen sein?
Rüdiger Safranski: „Einzeln sein“. Eine philosophische Herausforderung. Carl Hanser Verlag. 286 Seiten, 26 Euro.
P. S. Vielleicht hat ihn auch dies zum neuen Buch motiviert: Zwar nicht als Einzelner, jedoch als einer, dem einiger Unmut entgegenschlug, dürfte sich auch Rüdiger Safranski selbst erfahren haben, als er sich in der Debatte über Geflüchtete mit kritischen Anmerkungen zur „Willkommenskultur“ hervortat – ein Themenfeld, das derzeit wieder von dringlicher Aktualität ist.