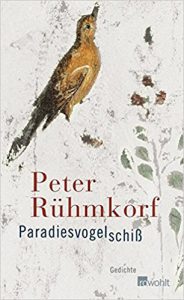Westfalen – das Land der wenigen Dichter
Seien wir ehrlich: Eine literarische Traditionslandschaft von hohem Rang ist Westfalen leider nicht. Zum Vergleich: Schwaben kann mit Wieland, Schiller, Hölderlin, Mörike, Hegel und etlichen anderen prunken – und wen haben „wir”?
Seit kurzem gibt es eine neue, umfangreiche Internetseite zur westfälischen Literatur – und selbst da muss man sehr intensiv suchen, um aufs Feld ganz großer Dichtung zu gelangen. Über 2000 Autoren sind verzeichnet, doch selbst Fachleute dürften die allermeisten kaum kennen.
Vielleicht liegt’s, wie Goethe gesagt hätte, am Fehlen von „Basalten und Schlössern”. In klassischen Zeiten blühte die Literatur vor allem im Umfeld des Adels. Westfälische Autorenschaft entwickelte sich hingegen vor allem in Kirchen- und Juristen-Kreisen. Vielfach lief es freilich auf Heimatdichtung mit engerem Horizont hinaus. Nach der Industrialisierung kamen entschieden linke Positionen hinzu – bis zum zeitweise wirksamen Dortmunder Werkkreis Literatur der Arbeitswelt (ab 1961).
Ein Kritiker, ein
Sozialist und ein
erschlagener Bischof
Doch in der NS-Zeit neigten manche Schriftsteller auch zu schrecklichen Blut- und Boden-Ergüssen; allen voran Josefa Berens-Totenohl, die in Meschede-Grevenstein aufwuchs.
Es ist lehrreich, auf www. literaturportal-westfalen.de die Funktion „Schauplätze” aufzurufen. Hier kann man – Ort für Ort – erfahren, wo Autoren gelebt und wo Dichtungen gespielt haben. Beispiele:
In Altena wurde 1893 Friedhelm Sieburg geboren, der als „Großkritiker” der FAZ von sich reden machte. Er war sozusagen der Reich-Ranicki der 50er und frühen 60er Jahre.
Der Romantiker Karl Leberecht Immermann hat sich über Arnsberg so geäußert: „…die Gegend um Arnsberg ist die schönste, die ich je gesehen habe…” Später wurde vor allem der von hier stammende Sozialist Wilhelm Hasenclever (1837-1889) bekannt, der für die Rechte der Arbeiter kämpfte und schrieb.
Dortmund könnte sich rühmen, dass der kürzlich verstorbene Peter Rühmkorf 1929 hier geboren wurde. Doch der große Lyriker wurde Hamburger aus Passion. Immerhin: Der Dadaist Richard Huelsenbeck (1892-1974) hat in Dortmund seine Jugend verbracht und liegt hier begraben. Nicht zu vergessen Max von der Grün („Irrlicht und Feuer”), Inbegriff engagierter Arbeiterdichtung in der Nachkriegszeit.
In Gevelsberg haben keine großen Autoren gelebt, aber hier wurde anno 1225 Engelbert I. (Kölner Erzbischof) durch den Grafen Friedrich von Isenburg ermordet. Dieser ungeheuerliche Vorfall war ein nachwirkendes literarisches Motiv – für den mittelhochdeutschen Dichter Walther von der Vogelweide wie für die Vorzeige-Westfälin Annette von Droste-Hülshoff.
Größter literarischer Sohn von Hagen war der Lyriker Ernst Meister (geboren 1911 in Haspe, gestorben 1979 in Hagen), eine prägende Gestalt deutscher Dichtung.
Das doch recht kleine Hilchenbach wächst auf der literarischen Landkarte zur veritablen Größe heran – wegen Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817). Goethe war es, der (nach einem Treffen in Elberfeld) ein Manuskript von Jung-Stilling unter dem Titel „Heinrich Stillings Jugend” herausbrachte. Der Hilchenbacher beschreibt darin das einfache, schlichte Leben Siegerländer Bauern, Eisenschmelzer und Schmiede.
Auf Schloss Cappenberg, wo der preußische Reformer Freiherr vom Stein lebte, fand sich häufig der romantisch-patriotische Dichter Ernst Moritz Arndt ein. Zudem spielt eine Ballade von Annette von Droste-Hülshoff („Die Stiftung Cappenbergs”) dort.
Unna steht in den literarischen Annalen wegen Philipp Nicolai (1556-1608), der hier ein paar Jahre Stadtpfarrer war und berühmte Kirchenlieder wie „Wachet auf, ruft uns die Stimme” schuf. Vor allem aber verdankt Unna Heinrich Heine einigen Ruhm. In „Deutschland. Ein Wintermärchen” (1841) fügte Heine die unsterblichen Zeilen: „Dicht hinter Hagen ward es Nacht . . . / Ich konnte mich erst / Zu Unna im Wirtshaus erwärmen . . .”
Einem Studiengenossen aus Westfalen schrieb Heine Verse ins Stammbuch, die auf ein literarisches Defizit der Region hindeuten könnten:
„Mein Fritz lebt im Vaterland der Schinken, / Im Zauberland, wo Schweinebohnen blühen, / Im dunklen Ofen Pumpernickel glühen, / Wo Dichtergeist erlahmt und Verse hinken . . .”
__________________________________________________
INFO:
- http://www.literaturportal-westfalen.de/
- Der Netz-Auftritt steht unter Regie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und wurde maßgeblich von der Stiftung Westfalen-Initiative finanziert.
- Angeblich gibt es für keine andere deutsche Region eine ähnliche Netz-Präsenz.
- Man kann auf einer Zeitleiste suchen, aber auch nach Autoren- oder Orts-Alphabet („Schauplätze”).
- Außerdem lässt sich nach Verlagen, Archiven usw. fahnden.
- Anmerkung: Münsterland, Bielefeld/Ostwestfalen und Lippe-Detmold fallen in diesem Beitrag unter den Tisch. Einfach mal so.