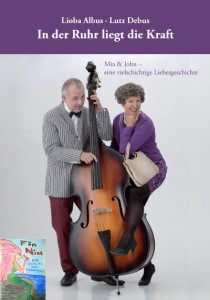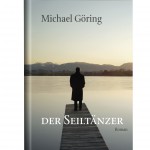Vom Alltag einer Arbeiterfamilie zwischen Ruhrgebiet und Sauerland – Martin Beckers Roman „Marschmusik“
Sowohl der Buchtitel „Marschmusik“ als auch das Sujet, nämlich die Geschichte einer Arbeiterfamilie, sind auf den ersten Blick wohl nicht zugkräftig genug, um Leser für einen Roman zu gewinnen.
Was hat schon der Alltag von Menschen zu bieten, die erst vom Bergbau und später von anderer Industrie lebten? Eine solche Frage ist zweifellos berechtigt, doch wer einmal mit dem Buch von Martin Becker begonnen hat, der legt es so schnell nicht wieder aus der Hand. Denn der Autor beherrscht die Kunst des Erzählens. Auch wenn er im klassischen Sinn keine Spannungsbögen aufbaut, sorgt er für echten Lesegenuss.
Beckers Hauptdarsteller sind die Mitglieder seiner fünfköpfigen Familie, wobei man in der wichtigsten Nebenrolle noch einen Mann namens Hartmann erwähnen sollte, einen im wahrsten Sinne „Kumpel“ des Vaters. Nachdem die beiden anfangs durch Dick und Dünn gegangen sind, treten aber dann doch die Eigenwilligkeiten Hartmanns immer stärker hervor und schließlich landet er auf der schiefen Bahn.
Doch damit ist das Kapitel dieser Männerfreundschaft noch lange nicht beendet, denn Hartmann findet wieder auf den rechten Weg zurück – zumindest so einigermaßen. Er meldet sich auch wieder bei der Familie des Erzählers. Begeisterung sieht allerdings anders aus.
Ohne nostalgische Verklärung
Dem Verfasser gelingt es nicht nur, ein sehr klares Profil von den Menschen zu zeichnen, die ihn seit der Kindheit umgeben haben, auch die Beschreibungen über die Schufterei in den Tiefen des Bergwerks sind anschaulich, präzise und lebendig. Dabei verfällt Becker keineswegs in Nostalgie und seine Texte sind auch weit davon entfernt, die Bergbau-Ära als die gute alte Zeit zu klassifizieren. Schon die Mühsal der Arbeit spricht dagegen. Dass die Jahre aber durchaus ihre Vorzüge hatten (wirtschaftliche Sicherheit, Zusammenhalt untereinander), schildert Becker ebenfalls.
Ob es nun der Vater schon früh vorhergesehen hat oder die Plackerei ihm doch zu viel war, jedenfalls zieht die Familie nach einigen Jahren in ein Städtchen, das sowohl am Rande des Sauerlands als auch des Ruhrgebiets liegt und einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten hat. Hier kauft man sich schließlich auch ein Haus und schlägt Wurzeln, wobei der Erzähler ein vielschichtiges Portrait von seinem Vater vorlegt.
Der Vater ist, wie wohl viele Männer aus der Arbeiterschaft in den 70er und 80er Jahren, zwar ein knorriger und äußerst distanzierter Mensch, der tagein tagaus in einem Metallbetrieb schuftet und keine wirklichen Freunde hat. Doch es lassen sich auch andere Seiten erkennen. Dazu gehört beispielsweise die liebevolle Sorge um die Neugeborenen in der Familie oder ein lockerer Umgang mit dem Sohn, als dieser ins Jugendalter kommt.
Kleinbürgerliche Enge
Der in Plettenberg (Sauerland) aufgewachsene Autor selbst hatte sich derweil schon als Kind in den Kopf gesetzt, ein berühmter Musiker werden zu wollen. Er schließt sich einem Orchester an, das die Art von Musik spielt, die nun im Buchtitel steht. Mit feiner Ironie blickt der Verfasser auf sein eigenes Schaffen zurück und mit ebenso hintersinnigem Humor beschreibt er auch das Leben seiner Eltern und die kleinbürgerliche Enge, die ein Wohnort in dem kleinen Städtchen so mit sich bringt. Ein Einzelfall sei der Ort keineswegs betont der Autor, davon gebe es überall viele.
Martin Becker beobachtet sehr genau, was um ihn herum passiert, damals und heute. Mal schildert er die Fährnisse des Alltags, so wie sich in der Vergangenheit ereignet haben, dann wieder beschreibt er, wie es in heutiger Zeit bei Besuchen im Elternhaus zugeht und blickt dabei zurück in jene längst vergangenen Jahre. Mittlerweile ist der Vater verstorben, die Mutter lebt nun allein. Eines hat sie sich nie abgewöhnt oder auch nicht abgewöhnen wollen. Sie raucht – aus Leidenschaft.
Martin Becker: „Marschmusik“. Roman. Luchterhand, 288 Seiten, 18 Euro.