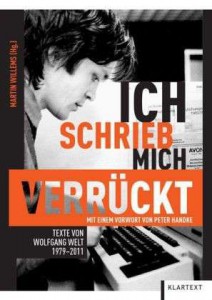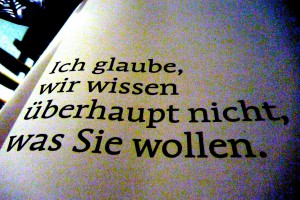Altes Lied ganz neu: Die Nibelungen am Schauspielhaus Bochum
Die Männer sitzen ums Feuer und singen ein altes Lied in einer fremden Sprache, einer spielt Gitarre dazu. Hin und wieder versteht man sogar ein Wort: Denn die Sprache ist Mittelhochdeutsch und die Geschichte, über die sie singen, erzählt von Siegfrieds Heldentaten und Kriemhilds Rache. Regisseur Roger Vontobel hat für das Schauspielhaus Bochum Hebbels „Die Nibelungen“ inszeniert und das Stück buchstäblich als „Nibelungenlied“ kongenial an seine Ursprünge zurückgeführt.
Die Gesangseinlagen beschwören den mittelalterlichen Mythos herauf und legen die archaischen Grundzüge der Heldengeschichte frei, so dass sie uns heute wieder etwas sagt. Überhaupt: Wie Vontobel es schafft, die Nibelungen-Sage als packende Sex-and-Crime-Story zu erzählen, so dass der Theaterabend trotz fünfeinhalbstündiger Spieldauer keine Sekunde langweilig, sondern extrem kurzweilig und spannend daherkommt, das ist wirklich eine großartige Regieleistung.
Dabei wirkt Vontobels Erzählweise, die mit einer großen Rückblende arbeitet, in der Siegfried und Kriemhilds Vorgeschichte inklusive Drachentötung und Mord entfaltet werden, keineswegs verflachend. Sehr genau erlebt man die Psychologie der Figuren, erkennt ihre Motive, ihre Schuld-, Eifersuchts- und Rachegefühle und kann verfolgen, wie diese Emotionen letztlich in grausame und tödliche Verstrickung führen.
Im Zentrum des Geschehens steht Kriemhild: Jana Schulz legt diese Figur als ein burschikos-naives Mädchen an, das erleben muss, wie ihre reine, große Liebe zu Siegfried durch Gier und Machtkalkül ihrer Brüder und Hagen funktionalisiert und letztlich zerstört wird. Kriemhilds Rache folgt aus gebrochenem Herzen und der Erfahrung, dass ihre engste Familie sie verraten hat. Darum ist sie umso grausamer und gibt sich erst zufrieden, nachdem sie alle in den Tod getrieben hat.
Diese Charakterentwicklung nimmt man der großartigen Schauspielerin jede Sekunde ab, ebenso wie man ihre sinnliche Bühnenpräsenz nur bewundern kann. Die lange Szene, in der sich Kriemhild die Asche Siegfrieds mit Schwamm und Waschkrug vom Körper reibt markiert sinnfällig die Zäsur. Hier wird aus der Trauernden die eiskalte Rächerin, die im Diven-Outfit ihre Erotik gezielt dazu einsetzt, den zweiten Ehemann Etzel (Matthias Redlhammer) ins Mordkomplott einzuspannen.
Doch auch die Handlungsmotive der übrigen Figuren sind klug herausgearbeitet: Hagen (Werner Wölbern) ist mitnichten nur der Bösewicht, der Siegfried aus Mordlust tötet. Als treuer Gefolgsmann und Berater König Gunthers geht es ihm um Machtpolitik: Er will das Haus Burgund in die Zukunft führen und scheut dabei vor keiner List zurück. Siegfried dagegen ist Mitwisser und Störenfried für ihn, denn er setzt Gerechtigkeit über Treue. In Hagens Welt muss er dafür sterben.
Nun der Held selbst, im Drachenlederanzug: Fast blass und verkopft kommt dieser Siegfried (Felix Rech) daher. Seine Macht von Zauberschwert und Tarnkappe ist ihm eher unheimlich, er wollte lieber für sich und Kriemhild ein kleines Glück, statt ein großer Held zu sein. Doch das Heldentum legt ihm Pflichten auf, die er scheut und das wird ihm zum Verhängnis. König Gunther (Florian Lange) dagegen will mehr, als seine Fähigkeiten erlauben: Er ist scharf auf Brunhild (Minna Wündrich), aber sie ist eindeutig eine Nummer zu groß für ihn, das bringt dieser Ehe nur Verdruss. Richtig komisch sind die Szenen, in denen das Vollweib Brunhild den armen Pantoffelhelden mit Verlaub „zusammenscheißt“ – ach hätte er doch ein nettes Mädchen von nebenan geheiratet anstatt dieser kraftstrotzenden Walküre, deren Wildheit niemand bändigen kann, weil sie aus eisigeren Gefilden stammt und das ganze Rheinland ihr einfach zu lieblich ist.
Die politisch heikle Rezeptionsgeschichte des Nibelungenstoffes hat Vontobel sehr dezent integriert: In Ausstattung und Kostüm sind Anklänge an die Mode und Frisuren der vierziger Jahre zu finden, ohne allzu sehr die abgegriffene 3.-Reich-Symbolik zu bemühen. (Kostüme: Tina Kloempken). Auch die Idee, den berüchtigten Hunnenkönig Etzel als kultivierten Klavierspieler im weißen Anzug zu zeigen, hat Charme. So ist nicht von vorneherein klar, wer eigentlich hier die Barbaren sind und die Deutung gerät offener.
Selbst mit der Gewalt im Stück findet Vontobel einen klugen Umgang: Sicher, es fließt Blut, aber die schlimmsten Szenen lässt er hinter dem geschlossenen eisernen Vorhang spielen. So entstehen die Bilder des Schreckens durch bloße Geräuschkulisse im Kopf des Zuschauers – was sie umso eindringlicher macht (Bühne: Claudia Rohner).
Zeit nehmen, unbedingt hingehen: Wenn draußen vor dem Schauspielhaus Bochum ein Lagerfeuer brennt, gibt’s drinnen die Nibelungen zu sehen.
Weitere Infos und Karten:
http://www.schauspielhausbochum.de/spielplan/die-nibelungen/