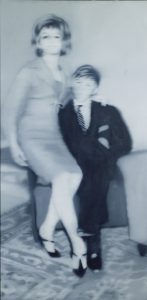Geschichtenerzähler im Videokabinett – Kunstsammlung NRW präsentiert den britischen Künstler Isaac Julien

Isaac Juliens Zehnkanalinstallation „Lessons of The Hour“ über den ehemaligen Sklaven, Freiheitkämpfer und Fotografen Frederick Douglass. (Foto: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Achim Kukulies)
Überall Videos. Abgedunkelte Räume voll von unterschiedlich großen Projektionsflächen, auf denen in bunten Farben Bewegtbilder ablaufen. Alles sehr ordentlich, professionell und, ja, so kann man durchaus sagen: schön. Natürlich ordnet sich der überwältigende erste Eindruck zügig, die realen Räume sind eben auch Themenräume, in denen auf drei, fünf, zehn Bildflächen, je nachdem, Geschichten erzählt werden.
Große Werkschau
Der Schöpfer dieser Arbeiten, den Videokünstler zu nennen es nur zum Teil trifft, ist Isaac Julien, Jahrgang 1960, Brite, Documenta- und Biennale-Teilnehmer und für sein künstlerisches Schaffen bereits hoch geehrt. Zu sehen sind nun elf Video-Installationen sowie eine Reihe von Fotografien in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, im K21, dem Haus für das Zeitgenössische, das früher mal den Landtag beherbergte.

Videokünstler, Filmemacher, Fotograf: Isaac Julien (Foto: Theirry Bal/Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen)
Schwarz und schwul
Seit Julien in den frühen 80er Jahren, mit Amateurvideo-, 8- und 16-Millimetermaterial zunächst, zu arbeiten begann, sind „schwarz“ und „schwul“ zentrale Motive. Von Anfang an ist da der Zorn über die ungerechten Verhältnisse. „Who Killed Colin Roach?“ aus dem Jahr 1983 etwa thematisiert den Mord an einem Farbigen vor einem Londoner Polizeirevier, „Territories“ (1984) Erfahrungen junger farbiger Frauen in England, und der Titel des Zehnminüters „This Is Not An AIDS Advertisement“ (1987) ist quasi selbsterklärend. „Western Union: Small Boats“ (2007) erzählt von afrikanischer Migration, verwebt die Dokumentation auf unerhörte Weise mit einer Tanzperformance Russell Maliphants. Altchinesische Mythen wiederum und die zu Anfang des 20. Jahrhunderts glamouröse Filmstadt Shanghai sind Thema von „Ten Thousand Waves“ (2010), werden thematisch in Zusammenhang gebracht mit dem tragischen Tod von chinesischen Wanderarbeitern in England. Es gibt der Themen etliche mehr.

Harlem Renaissance: Szene aus „Looking For Langston“ von 1989 (Foto: Isaac Julien, Courtesy the artist and Victoria Miro/Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen)
Geschichte
Seit dem Ende der 80er Jahre, jedenfalls vermittelt die Düsseldorfer Schau diesen Eindruck, verlagert sich Juliens Interesse stärker hin zu historischen Themen. „Looking for Langston“ (1989), ein zwischen schwelgerischer Reinszenierung, Spielhandlung und eleganter Erotik meisterlich changierendes Werk in Schwarzweiß, thematisiert die „Harlem Renaissance“, die selbstbewußte Manifestation schwarzen homosexuellen Lebens in den 20er Jahren. „Ein wichtiger Beitrag zur Erforschung schwarzen, queeren Begehrens“ ist „Looking…“ laut Pressetext, „die wichtigste Arbeit der Ausstellung“ in den Worten von Kuratorin Doris Krystof.
Sklave, Freiheitskämpfer, Fotograf
Auch das üppigste Werk der Schau hat ein historisches Thema. „Lessons of The Hour“ (2019) – 10 Bildkanäle, Surroundsound, knapp eine halbe Stunde lang – portraitiert Leben und Werk des ehemaligen Sklaven Frederick Douglass, der sich selbst befreite und zum Freiheitskämpfer wurde. Douglass befaßte sich intensiv mit Fotografie, schrieb über sie, gilt überdies „als die meistfotografierte Persönlichkeit in den USA im 19. Jahrhundert“. „Der moralische und soziale Einfluß des Bildermachens“, noch einmal sei mit diesem Terminus der Pressetext zitiert, hat Isaac Julien in seinem eigenen Schaffen tief und nachhaltig motiviert. Und das Video (wenn man es denn doch einmal so nennen darf): schöne Bilder aus einer versunkenen Zeit, lange Kleider, Samt und Seide. Bilder gerade so, wie sie seinerzeit in den Fotoateliers entstanden.

In einem Fotoatelier des 19. Jahrhunderts; Szene und Still aus „Lessons of The Hour“ von 2019 (Foto: Isaac Julien, Courtesy the artist and Victoria Miro/Kunstsammlung Nodrhein-Westfalen)
Bildergalerie
Vier Stunden 35 Minuten braucht man, um alle in Düsseldorf gezeigten Filme vollständig anzuschauen. Aber dazu muß man sich schon zwingen, denn die Gleichzeitigkeit vieler Bildbotschaften nebeneinander vermittelt einen paradoxen Eindruck von Bewegungslosigkeit, von Gemäldeausstellung mithin. Das scheint ein wenig auch gewollt zu sein, ähnelt die Bildpräsentation doch sehr jener der brasilianischen Architektin und Designerin Lina Bo Bardi, die in von ihr geplanten Museumsbauten Alte Meister gerade so im Raum platzierte wie Isaac Julien in seinen Ausstellungen die Videoflächen. „Lina Bo Bardi – A Marvellous Entanglement“ (2019) heißt sein Film über sie, der übrigens nur über drei Videoflächen läuft.
Freiheit bedeutet, keine Furcht zu haben
Je länger man in der Schau verweilt, im Untergeschoß des K21, desto mehr verflüchtigt sich der Eindruck von „Oberflächlichkeit“ (ich stelle das mal in Tüttelchen, um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen), den die formal makellose, technisch aufwendige Präsentation zunächst hervorgerufen hatte. In der zeitgenössischen Kunstproduktion begegnet man einem gewissen Mißverhältnis zwischen Aufwand und Botschaft häufiger, da hat sich beim Betrachter vielleicht eine falsche Erwartungshaltung herausgebildet. Isaac Julien jedenfalls erzählt ganze Geschichten, die trotz ihrer Opulenz nur zu einem Teil über die Videowand laufen und ihre Ergänzungen in den Köpfen der Betrachter finden. Und vielleicht erzählt er auch nur eine Geschichte. „I’ll tell you what freedom is to me. No fear” zitiert er die amerikanische Jazz-Sängerin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone. Aus ihrem Satz ist der Titel der Ausstellung, die vor Düsseldorf übrigens in der Londoner Tate-Gallery zu sehen war, abgeleitet.
- „Isaac Julien. What Freedom Is To Me“
- Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21, Ständehaus, Ständehausstr. 1
- Bis 14. Januar 2024
- Geöffnet Di-So 11-18 Uhr
- www.kunstsammlung.de
- Katalog 207 Seiten, 46 €