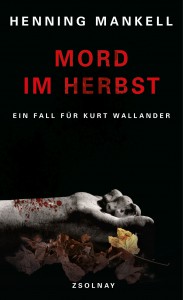Frauenfußball: Weniger Dynamik, Aggression und Anmaßung – mehr Fairness und mehr Hymne…
Was ist das wohl für ein Ereignis, bei dem selbst die Ränge im übersichtlichen Stadion des niederländischen Breda nur zur Hälfte gefüllt sind? Welches Turnier können sogar die gebeutelten öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch übertragen, während sonst fast alles ins Bezahlfernsehen abwandert? Richtig, es ist die Fußball-Europameisterschaft der Frauen, die sich mit dem Hashtag #WEURO (Women’s Euro) anpreist.

Deutscher Spielerinnenkreis vor der Partie gegen Schweden. (Eigenhändig vom ARD-Fernsehbild abgeknipst)
Lang, lang ist’s her, dass in den 1970 er Jahren der Frauenfußball von oben herab noch derart verspottet wurde, dass es nur so seine Unart hatte. Den YouTube-Link zur unsäglich feixenden Herablassung eines Wim Thoelke (ZDF) ersparen wir uns diesmal, obwohl er aus heutiger Sicht ein Schenkelklopfer unfreiwilligen Humors ist. Googelt halt einfach Wim Thoelke und Frauenfußball, dann habt ihr den Salat.
Doch auch heute noch gibt es zahlreiche Verächter, die dem Damenfußball keinerlei Qualität zubilligen. Sie trauen sich nur nicht mehr ganz so ungeniert hervor. Okay, ich geb’s zu, ich sehe meist auch lieber die Kerle spielen; wenn sie’s denn können.
Gestern hat also die Frauen-EM begonnen, heute ist das deutsche Team gegen Schweden angetreten und hat mir mit einem 0:0 meinen Siegtipp gründlich versaut. Wen aber reißt es vom Sessel, wenn ich jetzt sage, dass die verletzte Svenja Huth durch die Ruhrgebiets-Pflanze und Bundesliga-Torschützenkönigin Mandy Islacker (Enkelin der Essener RWE-Fußball-Legende Franz Islacker) ersetzt wurde? Bei den Männern würden sie sich über solch einen Vorgang die Köpfe heiß reden. Anderntags wären die Zeitungen voll davon.
Ja, gewiss, die Männer gehen noch athletischer und dynamischer zu Werke, der sportliche Unterschied dürfte sich – etwa analog zum 100-Meter-Lauf – im Maßverhältnis von Zeiten unter 10 Sekunden (Männer) und unter 11 Sekunden (Frauen) bewegen, von unerlaubten Hilfsmitteln mal abgesehen.
Vor allem aber sind die Männer weitaus aggressiver. Zudem versuchen sie gar häufig, den Schiri durch Schauspielerei zu beeinflussen – und sei es nur, um einen läppischen Einwurf oder eine Ecke herauszuschinden. Wie wohltuend, dass es derlei Mätzchen bei den Frauen kaum gibt, wie es denn bei ihnen überhaupt deutlich fairer zugeht. Und sie machen erheblich weniger Getue um sich selbst. Freilich kann man sich auch nur schwer vorstellen, dass hier Legenden geboren werden. Vielleicht gehört ja die arrogante Anmaßung dazu, wenn man „unsterblich“ werden will?
Schwachmaten der Boulevardblätter haben sich schon in aller Breite darüber ausgelassen, ob ein Tor im Männerfußball mit dem Penis erzielt worden sei. Nun gut, das geht hier in der Regel nicht. *hüstel* Ansonsten spielen aber auch die Frauen schon mal Traumpässe und schlagen hin und wieder herrlich abgezirkelte Flanken. Und sie können zuweilen sehr entschlossen grätschen. Meine Lieblingsspielerin im EM-Auftaktmatch war denn auch in dieser Hinsicht die abwehrstarke Anna Blässe.
Während Männer schon mal pro Nase 300.000 Euro für einen Turniersieg erhalten (und den Betrag als Trinkgeld erachten), stehen bei den Frauen (die weitaus mehr EM-Titel errungen haben, nämlich nahezu alle) nicht einmal 40.000 Euro zu Buche. In den 80er Jahren gab’s mal für einen EM-Sieg der Frauen – ungelogen – einen feuchten Händedruck und – ein Porzellan-Service…
Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass anteilig offenbar deutlich mehr Frauen als Männer die deutsche Nationalhymne mitsingen? Nein, ich mag daraus gar nichts schlussfolgern. Und kommt mir jetzt bloß nicht mit albernen Buchstabendrehern, ihr Machos!
_____________________________________
P.S.: Satz des TV-Abends, den der ARD-Kommentator Bernd Schmelzer vom Stapel ließ: „Gar nichts ist ja immer sehr wenig.“