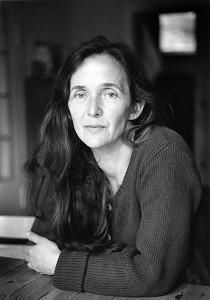Willi Sitte – ein durchaus widersprüchliches Leben als Maler und DDR-Kulturfunktionär
Gastautor Heinrich Peuckmann erinnert an den umstrittenen DDR-Maler Willi Sitte:
Mit Willi Sitte ist 2013 auch der letzte der vier großen DDR-Maler gestorben. Werner Tübke zählte dazu, dessen Bauernkriegs-Panoramabild in Bad Frankenhausen sicherlich zu den großen malerischen Leistungen des letzten Jahrhunderts gehört. Werner Mattheuers Skulptur „Der große Schritt nach vorn“ über die politischen, vor allem blutigen Illusionen des letzten Jahrhunderts steht in Leipzig direkt vor dem Eingang zu Auerbachs Keller. Und Bernhard Heisig wurde im Westen bekannt, weil er Helmut Schmidt gemalt hat, als dessen Kanzlerschaft endete.

Der Maler Willi Sitte begrüßt den Staats- und Parteichef Erich Honecker (rechts) zur Eröffnung der X. Kunstausstellung der DDR im Jahr 1987. (Foto: Bernd Sattnik / ADN / Bundesarchiv Bild 183-1987 – Wikimedia Commons, Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)
Sitte war der umstrittenste von ihnen, was einerseits an seiner kraftvollen, mit viel Sinnlichkeit gewürzten Malerei, hauptsächlich aber an seiner Tätigkeit als Kulturfunktionär lag. Sitte war von 1974 bis 1988 Präsident des Verbandes bildender Künstler, war Volkskammerabgeordneter und Mitglied im ZK der SED, alles Tätigkeiten, die ihm nach der Wende heftig vorgeworfen wurden.
Dabei wurde jedoch oft verschwiegen, dass Sitte in den fünfziger und sechziger Jahren selbst erhebliche Konflikte mit der DDR-Führung hatte. Seinem „Lidice-Bild“, gemalt in Erinnerung an die Gräueltaten der Nazis, fehlte nach Ansicht der Kulturverantwortlichen das Heroische, weil es Sitte um die Brutalität anonymer Mörder gegenüber den Opfern ging: Mehrfach wurde er zur Umarbeitung gedrängt, bis man das Bild schließlich aus dem Verkehr zog. Heute ist es verschollen.
Für gewisse Freiräume gesorgt
Die Graphikerin Lea Grundig war vor Sitte Verbandschefin, formale und inhaltliche Neuerungen waren ihr suspekt. Sitte erzählte mal, dass sie schon bei seinem Erscheinen zu einer Sitzung gerufen hätte: abgelehnt! So wurde er später von einigen seiner Freunde gedrängt, selber für das Amt zu kandidieren und für Freiraum in der DDR-Malerei zu sorgen. Selbst seine Gegner bestätigen heute, dass er diesem Auftrag gefolgt ist. Vieles wurde unter seiner Regie möglich, was vorher undenkbar war, zum Beispiel auch, dass Heisig Helmut Schmidts Bitte, ihn zu malen, annehmen durfte. Aus Sicht der DDR-Betonköpfe war das immerhin der Auftrag des reaktionären Feindes.
Sitte stammte aus einer einfachen Bauernfamilie. Im böhmischen Kratzau, heute Chrastava, wurde er 1921 geboren. Mehrfach hat er seine Eltern gemalt, immer in verschiedenen Lebensabschnitten. Es sind sehr warmherzige Darstellungen, die die Armut seiner Herkunft nicht verschweigen, aber auch die menschliche Zuneigung zeigen. Sie gehören zu den großen Zeugnissen der Porträtkunst.
Orientierung an Expressionismus und Kubismus
Am Ende des Krieges wurde er an die Front nach Italien verlegt, wo Sitte desertierte und sich den Partisanen anschloss. Noch heute genießt er deshalb südlich der Alpen höchstes Ansehen. Diesem Land seiner Zuneigung ist er Zeit seines Lebens verbunden geblieben. Der ursprünglichen Absicht, dort zu bleiben, folgte er jedoch nicht, sondern ließ sich in Halle nieder. Dort holte er in den fünfziger Jahren vieles in seiner Ausbildung als Maler nach, was vorher nicht möglich gewesen war.
Sitte orientierte sich den Großen des letzten Jahrhunderts, an Picasso vor allem, dessen kubistische Formgebung ihn stark beeindruckte, aber auch an Léger und Corinth. Mit der Zeit fand er seinen Stil, und wer dabei genau hinschaute, der entdeckte weniger sog. „Sozialistischen Realismus“, was immer das gewesen sein mag, sondern Bezüge zum Expressionismus.
„Ich bin ein dramatischer Typ“
Sitte malte und zeichnete gerne kraftvolle Körper, meistens nackt, weil Kleidung mit Zeit identifiziert wird, und Sitte das Typische und Grundsätzliche im menschlichen Leben darstellen wollte. Er löste den Strich auf, setzte differenziert Farbflecken an seine Stelle und zeigte auf diese Weise genau die Facetten eines Körpers. „Ich bin ein dramatischer Typ“, hat er mal seine prallen Liebesakte erläutert, die manchmal an einen Ringkampf erinnern. Daneben teilte er seine Bilder in Flächen auf, zeigte in einem Teil das Hauptthema, auf nebengeordneten Flächen Teilaspekte, einen Betrachter der Szene etwa, oft sich selber.
Großartig sind seine Wasserbilder, in denen er das Durchsichtige wie mit leichter Hand sichtbar macht. Dazu gehört etwa der kraftvolle Schwimmer, ein Motiv, das anlässlich der Moskauer Olympiade 1980 eine Briefmarke zierte.
Kein platter Sozialistischer Realismus
Wer seine Bilder sieht, merkt schnell, dass Sitte keinen platten Sozialistischen Realismus malte, wie ihm das oft unterstellt wurde. Die Themen waren politisch, gelegentlich zudringlich, das stimmt, aber in der formalen Umsetzung war er sehr modern. Manchmal so modern, dass er auch noch in der Zeit seiner Präsidentschaft Anstoß in der DDR erregte.
Angesichts seiner großen, auch als Triptychen anlegten Bilder werden oft Sittes Zeichnungen vergessen. Er war ein großartiger Zeichner, sehr genau in der Darstellung und auch dort findet man wieder Bezüge zu den Großen der Malerei. „Hommage an …“ steht unter vielen seiner Zeichnungen. Sie beziehen sich auf Goya, Camille Claudel und andere. Diese Zeichnungen sind noch nicht genügend in der Beurteilung von Sitte gewürdigt worden.
Tiefer Sturz nach der „Wende“
Der Sturz nach der Wende war jedenfalls für tief für ihn. Gestern noch geachteter Staatsmaler, wollten nun selbst enge Freunde nichts mehr von ihm wissen. Freunde, denen er nachweislich geholfen hatte. Sitte war darüber enttäuscht, aber nicht verbittert. Zu optimistisch hat er das Leben gesehen, die Vitalität, die seine Bilder vor und nach der Wende ausstrahlen, bestätigt das.
Die ursprüngliche Absicht, nicht mehr in den neuen Bundesländern, also der alten DDR auszustellen, hat er am Ende aufgegeben. Zu seinem 90. Geburtstag erinnerte sich Halle an seinen großen Künstler und organisierte eine große Ausstellung, bei der den Zeichnungen breiter Raum gegeben wurde. Sitte war da schon so krank, dass er sie nicht mehr hingehen konnte.
Chance auf spannende Dialoge vertan
Gesehen hat er aber noch das eigens für ihn geschaffene Museum in Merseburg, die Willi-Sitte-Galerie am Domplatz, die einen Besuch wert ist. Neben Sitte-Bildern gibt es dort immer auch Wechselausstellungen.
Die bildende Kunst in Deutschland hat nach der Wende eine große Chance vertan. Zu schnell und zu oberflächlich wurden die DDR-Maler niedergemacht, so dass es gelegentlich wie ein Konkurrenzkampf um Marktanteile wirkte. Die deutsche Malerei hatte plötzlich zwei Wurzeln. Die westliche, die sich an der amerikanischen Moderne, vor allem der abstrakten Kunst orientierte. Und die östliche, die an den Expressionismus anknüpfte und das Gegenständliche bevorzugte. Hier hätte es zu einem spannenden Dialog kommen können, denn Vielfalt ist Reichtum.