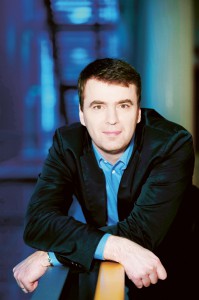Reizendes Kaleidoskop: Anna Vinnitskaya ist Porträtkünstlerin der Essener Philharmonie

Die Pianistin Anna Vinnitskaya. (Foto: Marco Borggreve)
Sergej Rachmaninow ist einer der Komponisten, zu denen Anna Vinnitskaya immer wieder zurückkehrt – und das dürfte nicht alleine daran liegen, dass sie einst am Rachmaninow-Konservatorium in Rostow am Don unterrichtet wurde. Mit dem eher selten gespielten Ersten Klavierkonzert in fis-Moll stellte sich die aus Russland stammende Pianistin als Porträtkünstlerin der Essener Philharmonie dieser Saison im Alfried-Krupp-Saal vor, begleitet von den Philharmonikern unter ihrem GMD Andrea Sanguineti.
Anna Vinnitskaya hat sich für die laufende Saison einen gewichtigen Rachmaninow-Schwerpunkt gesetzt und wird in Essen und der Region viel Präsenz zeigen. Bevor sie am 4., 5. und 9. Februar 2025 mit Rachmaninows Dritten, dem d-Moll-Konzert, nach Münster kommt, spielt sie im November die vier Konzerte plus die Rhapsodie über ein Thema von Paganini op. 43 in zwei Konzerten mit der Dresdner Philharmonie unter Krzysztof Urbanski im Kulturpalast Dresden. Danach, am 6., 7. und 8. März 2025 tritt sie unter Joana Mallwitz mit den Berliner Philharmonikern mit dem Dritten Klavierkonzert auf. Prominente Engagements also für die Preisträgerin des renommierten Concours Reine Elisabeth in Brüssel, den sie 2007 als zweite Frau in der Geschichte des Wettbewerbs gewann und in dessen Jury sie im Mai 2025 sitzen wird.
Herbert Grönemeyer als Dirigent
In Essen ist Anna Vinnitskaya noch mehrfach in unterschiedlichen Formaten zu erleben. Die beiden Herbstkonzerte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen im RWE Pavillon liegen bereits hinter ihr, aber am 3. Oktober präsentiert sie in der Philharmonie mit Dmitri Schostakowitsch einen ihrer dezidierten Lieblingskomponisten: Mit dem Brahms Ensemble Berlin spielt sie das Klavierquintett op. 57, solistisch lässt sie sich mit den „Puppentänzen“ hören, die sie auch 2024 auf ihrem jüngsten Album „Piano Dances“ eingespielt hat.
Das Zweite Klavierkonzert Schostakowitschs erklingt dann mit dem Mahler Chamber Orchestra zum 50. Todesjahr des Komponisten 2025 – am 14. Februar in Dortmund, am 15. in Essen und am 16. in Köln. Noch einmal ist Anna Vinnitskaya am 22. März in der Philharmonie Essen Solistin eines Orchesterkonzerts, diesmal mit dem Tonhalle Orchester Zürich unter Paavo Järvi und dem a-Moll-Konzert Robert Schumanns, bevor sie am 14. Juni mit Rachmaninows populärem c-Moll-Konzert op. 18 und den Bochumer Symphonikern nach Essen zurückkehrt. Als Dirigent des Konzerts, das am 13. und 15. Juni auch in Bochum auf dem Programm steht, ist Herbert Grönemeyer angekündigt.
Leuchtende Frische für Rachmaninow
Mit dem Ersten Klavierkonzert, das Sergej Rachmaninow als Moskauer Konservatoriumsstudent 1891 schrieb und 1917 überarbeitete, bestätigte Anna Vinnitskaya ihren viel gerühmten Rang als Solistin: Mit dem oft unterschätzten Werk ließ sie ein reizendes Kaleidoskop der Stimmungen aufleuchten. Nach dem kraftvollen Statement des Beginns nimmt sie den Ton des weiträumig in den Streichern exponierten Themas auf, der sich bald in lockerer Spielfreude verliert. Kein Wunder, dass dieses Konzert so wenig beachtet wird: Man muss wie Anna Vinnitskaya Freude daran haben, die eher rhapsodisch gereihten Momente brillanter Leichtigkeit, sentimentalen Verträumens und melodischer Melancholie elegant, frei und natürlich darzustellen.
Die Pianistin versucht nicht, die Wechsel illustrativ einzufangen. Sie bewahrt einen stetigen, freundlich leuchtenden, eher frischen als elegisch verschatteten Ton – den gönnt sie sich, gewürzt mit feinsinnigen Rubati, nur im lyrischen Teil des letzten Satzes. Ihr kurzes Duett mit dem Fagott im zweiten Satz wird zum poetischen Zwiegespräch, die Energie des Finales wird zupackend, aber kontrolliert freigesetzt. Die Philharmoniker unter Andrea Sanguineti sind mal näher, mal weiter von der Pianistin entfernt, wollen sich aber nicht vordrängen, sondern begleiten mit Noblesse, feinen Abstufungen und stellenweise zu diskreten Holzbläsern. Ein bezaubernder Einstand, der gespannt macht auf die weiteren musikalischen Facetten dieses Porträts.
Weitere Infos:
https://annavinnitskaya.com/de/home
https://www.theater-essen.de/philharmonie/