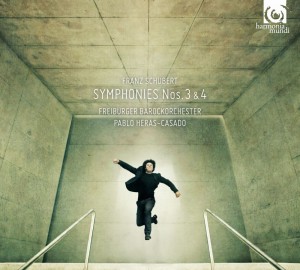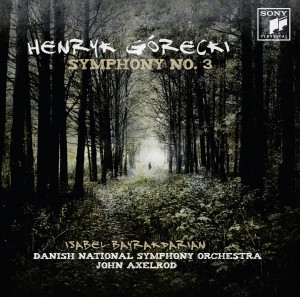Die Bewältigung einer Überwältigung – Wagner und Mahler an einem Abend mit dem Mariinsky Orchester und Valery Gergiev
Der Mann ist wahnsinnig. Setzt zwei Stücke für einen Konzertabend an, die für sich allein schon wie gewaltige Monolithe im Raum stehen. Platziert den ersten Aufzug aus Richard Wagners „Die Walküre“ neben Gustav Mahlers sechste Sinfonie.
Beide Male geht es um Leben und Tod, insgesamt bald zweieinhalb Stunden lang, geht es also wieder einmal ums Ganze. Das scheint dem Manne am Pult, dem Dirigenten Valery Gergiev, gerade das rechte Maß. Mit dem Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg ist er nach Essen gekommen, in die Philharmonie. Es wird ein Abend, der insgesamt beeindruckt, im Einzelnen aber manche Schwäche offenbart. Kein Wunder.
Gergiev wirkt als Dirigent immer ein wenig archaisch. Wie er dasteht mit seinem Zahnstochertaktstock, wenig Körperlichkeit zeigt, nur ab und an einen Einsatz aus den Armen rüttelnd. Manchmal raunt er in sich hinein, zischt oder bläst hörbar die Luft durch die Backen. Von ihm geht eine gewisse Zuchtmeister-Aura aus, die letzthin auch bedeutet, dass seine Disziplin die des Orchesters sein muss. Musizierende „Indianer“ zeigen eben keine Schwächen, sei ein Konzert auch noch so lang. Doch Heldentum ist das eine, die physische Belastbarkeit eines Instrumentalisten die andere Seite der Medaille. Und dann kann schon Mal etwas aus dem Ruder laufen.
So wie im „Walküre“-Aufzug. Der ruppige Streicherbeginn, die Sturm- und Gewittermusik, von höchster Not kündend, wirkt ein wenig holprig und nicht wirklich tief schwarz. Überhaupt scheint Gergiev in erster Linie in Strukturen zu denken, was die zunehmende musikalische Raserei bisweilen ausbremst. Andererseits gönnt sich der Dirigent die feine psychologische Ausdeutung des personellen Beziehungsgeflechts und agiert betont sängerfreundlich. Die wiederum danken es mit klarster Diktion und einem unaufdringlichen Spiel, das die Spannung allein durch Blickkontakte hält.

Anja Kampe (Sieglinde) und Mikhail Vekua (Siegmund), einander noch fremd, im 1. Aufzug von Wagners „Walküre“. Foto: Hamza Saad/Philharmonie Essen
Denn dieser Teil aus Richard Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ handelt nicht zuletzt vom Wiedererkennen. Siegmund flieht vor Feinden und Wetter in Sieglindes Heim. Beide ahnen zunächst, erlangen zunehmend Gewissheit, dass sie einst als Zwillingspaar auseinandergerissen wurden. Die Freude über das Wiedersehen steigert sich zur inzestuösen Liebesbeziehung. Wenn da nur nicht der widerliche Hunding wäre, Sieglindes Gatte durch Zwangsheirat und Siegmunds Todfeind.
Dies alles untermalt Wagner mit rauschhafter Glut und sehrendem Melos, das sich förmlich beißt mit der archaischen, dunklen Akkordik des Hunding-Motivs. Lyrische Episoden, die von Liebe künden, stehen neben exzessiver Leidenschaft, neben Parlando- und Belcanto-Elementen. Ja, ausdrucksstark und schön darf hier gesungen werden, oder, im Falle Hundings, arg bedrohlich. Das löst Mikhail Petrenko in großer Finsternis ein, wie andererseits die wunderbare Anja Kampe eine Sieglinde gibt, die jugendliche Unbekümmertheit ausstrahlen kann wie auch die weit gefächerte Emphase. Ihr Sopran ist gut fundiert, blüht herrlich auf, schillert in verführerischen Farben. Nur schade, dass Mikhail Vekua (Siegmund) sich vor allem mit den deutschen Vokalen arg müht. Der Tenor verfügt über jede Menge Metall und Kraft, sucht aber oft sein Heil in der gekünstelten Exaltation, im Affekt.
Sei’s drum: Nach einer guten Stunde dieses emotionalen Aufbegehrens hat das Publikum – und das Orchester – eine Pause redlich verdient. Einige wollen sich das Schwelgen in Wagners Leitmotiven auch nicht zerstören lassen und verzichten auf Mahlers 6. Das ist durchaus nachvollziehbar. Denn es folgen weitere 75 Minuten wild hämmernde Rhythmik, Destruktion und Endzeitstimmung, nur kurz unterbrochen von einer vermeintlichen Idylle, die alsbald schon ins Dramatische abgleitet. Ja, Mahler wollte mit seiner Musik eine Welt zimmern, doch vom puren Paradies war dabei nie die Rede. Schon Schönberg erkannte in der 3. Sinfonie die nackte Seele eines Menschen, „wie eine geheimnisvolle, wilde Landschaft“, mit „grauenerregenden Untiefen“ und „idyllischen Ruheplätzen“.
Und so ist auch die Nr. 6 ein in musikalische Tableaus gegossener Daseinskampf, der indes in der Katastrophe endet. Zwei wuchtige Hammerschläge im Finale besiegeln das Desaster eines imaginären Helden, zugleich stehen sie für den Zerfall tönender Struktur. Es ist ein Schlagen und ein Toben, Aufjaulen und Zerbröseln im Orchester, dass wir den Wagner vom Beginn des Konzerts nur noch einer fernen Vergangenheit zuordnen wollen.
Fast stoisch allerdings steht Valery Gergiev das alles durch, legt auch hier Strukturen frei, nimmt dem Ganzen jedoch die letzte Entäußerung. Das Orchester gerät konditionell und in puncto Genauigkeit ohnehin an seine Grenzen. Mahlers Raumklangeffekte wollen sich nicht einstellen. Und den wenigen, von Herdenglocken durchtränkten Idyllen, fehlt die Nähe zur Transzendenz, zur Erhabenheit.
Am Ende (natürlich) jede Menge Applaus, doch ein wenig darf sich das Publikum auch selbst feiern. Für die Bewältigung einer Überwältigung.