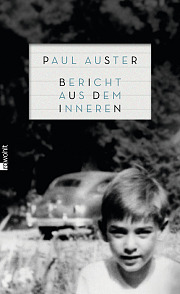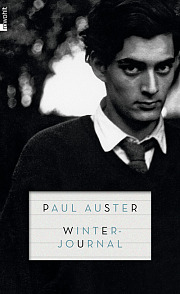Fiktion und Realität der Geschlechterrollen: Siri Hustvedts „Die gleißende Welt“
Ein Roman als fingierte Spurensuche und literarische Schnitzeljagd: Die Autorin Siri Hustvedt verkleidet sich als Herausgeberin und präsentiert Dokumente, Notizhefte, Interviews, um Leben und Werk der (fiktiven) Künstlerin Harriet Burden zu rekonstruieren.
Die 2004 verstorbene Harriet Burden hat zeitlebens mit Geschlechterrollen und Identitäten jongliert und kurz vor ihrem Tod ein entlarvendes künstlerisches Experiment gemacht: Um zu zeigen, wie frauenfeindlich die Kunstwelt ist, wie sehr die öffentliche Wahrnehmung von Kunst vom Geschlecht und der vermeintlichen Berühmtheit des Künstlers abhängt, hat sie mit Hilfe von Strohmännern ein Kunst-Projekt mit dem Titel „Maskierungen“ entworfen: Hinter den von drei männlichen Künstlern in New York ausgestellten Werken hat sich in Wahrheit Harriet Burden verborgen.
Was hat die Künstlerin umgetrieben, wie funktionierte ihr Experiment, und was haben all die unter dem Titel „Die gleißende Welt“ veröffentlichten (fiktiven) Dokumente mit der fast vergessenen (realen) englischen Schriftstellerin, Philosophin und Herzogin von Newcastle, Margaret Cavendish, zu tun, die 1666 einen utopischen Roman über „Die gleißende Welt“ herausbrachte?
Siri Hustvedt (geboren 1955) ist eine der bedeutendsten amerikanischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Verheiratet ist sie mit dem – nicht minder bekannten – Autor Paul Auster. Mit „Was ich liebte“ gelang ihr der Durchbruch als international anerkannte Schriftstellerin. Auch mit brillanten Essays sorgt sie immer wieder für Aufsehen: In ihrem autobiografischen Buch „Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven“ versucht sie mit Hilfe von Neurologie und Psychologie der Ursache ihres Zitterns auf die Spur zu kommen.
Ihr neuer Roman „Die gleißende Welt“ ist ein Konzert widerstreitender Stimmen und führt uns in die New Yorker Kunstwelt. Es geht um Macht und Begierde, Geld und Ruhm und darum, dass die Realität oft nicht so ist, wie wir sie gern hätten und uns mit unseren Vorurteilen zurechtzimmern.
Siri Hustvedt zieht alle Register postmoderner Erzählweisen, tut es ihrer fiktiven Heldin Harriet Burden gleich und verbirgt sich hinter immer neuen Masken: ein furioses Spiel mit Rollenklischees und ästhetischen Kategorien, utopischen Fantasien und dem alltäglichen Sexismus, der unsere Wahrnehmungen und Wünsche beherrscht. Heute wie zu Zeiten von Margaret Cavendish, die nicht wegen des Inhalts ihrer Bücher angefeindet wurde, sondern weil sie es wagte, als Frau in eine Männerwelt einzudringen.
„Alle intellektuellen und künstlerischen Unterfangen, sogar Witze, ironische Bemerkungen und Parodien“, schreibt Siri Hustvedt alias Harriet Burden, „schneiden in der Meinung der Menge besser ab, wenn die Menge weiß, dass sie hinter dem großen Werk oder dem großen Schwindel einen Schwanz und ein paar Eier ausmachen kann.“
Siri Hustvedt: „Die gleißende Welt“. Roman. Aus dem Englischen von Uli Aumüller. Rowohlt Verlag, 491 S., 22,95 Euro.