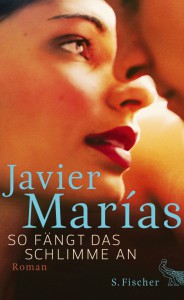Darf man über Untaten schweigen? Javier Marías‘ Roman „So fängt das Schlimme an“
Warum sprechen wir ständig über Dinge, die wir eigentlich gar nicht wissen können? Warum wühlen wir in Gerüchten und Lügen und präsentieren sie als vermeintliche Wahrheiten? Könnte es nicht manchmal sinnvoll sein, über mögliche Verbrechen zu schweigen und Untaten mit dem Mantel des Vergessens zuzudecken, mithin das Schlimme zu vermeiden, damit das hinter der Szenerie lauernde noch noch Schlimmere gebannt bleibt?
Mit solchen Fragen zur Psychologie des politischen und philosophischen Erkenntnisinteresses beschäftigt sich Javier Marías in seinem neuen Roman „So fängt das Schlimme an“. Schon der Titel des Buches spielt auf Shakespeare an, der einmal sagte: „Thus bad begins ans worse remains behind“.
Das Spiel mit Shakespeare ist beim spanischen Autor, der sich mit Romanen wie „Mein Herz so weiß“ oder „Morgen in der Schlacht denk an mich“ in die Weltliteratur schrieb und eine zeitlang in Oxford lebte und lehrte, nichts Neues. Immer wieder kommt er in seinen vielschichtigen Erzähl-Variationen über die Schwierigkeit, die Wahrheit von der Lüge, die Fiktion von der Realität und das Wunschdenken von den Fakten zu unterscheiden, auf den englischen Literatur-Giganten zurück.
Diesmal gibt Marias seinem Ich-Erzähler sogar einen anspielungsreichen Namen: Denn Juan, der von heute aus auf eine Zeit zurückschaut, als er noch ein 23jähriger Film-Freak war und sich naiv in ein Gespinst aus Lug und Trug, Liebe und Hass, Leidenschaft und Tod verwickeln ließ, trägt den Nachnamen de Vere – ist also ein literarischer Nachfahre von Edward de Vere, Earl of Oxford, Abenteurer, Duellant und Dichter, den manche für den wahren Shakespeare halten. Dessen Vorname – Edward – aber trägt im Roman die Person, die für den Erzähler Juan zum Vater-Ersatz wird: Eduardo Muriel, Film-Regisseur und Ikone des spanischen Kinos, bei dem Juan als Assistent anheuert.
Wir schreiben das Jahr 1980, vor wenigen Jahren ist General Franco gestorben und die klerikal-faschistische Diktatur sang- und klanglos verschwunden. Um ohne Blutvergießen den Aufbruch in die Demokratie zu ermöglichen, wird allen Tätern und Mitläufern eine Amnestie gewährt.
In diesem Milieu des Schweigens und Verdrängens gedeihen Gerüchte, deren Wahrheitsgehalt niemand überprüfen kann. Hat Doktor Jorge van Vechten seine Karriere und seinen Reichtum wirklich nur der Tatsache zu verdanken, dass er williger Helfer der Faschisten war? Benutzt er sein Wissen über die Geheimnisse der Menschen tatsächlich, um sie zu erpressen und Frauen sexuell zu nötigen?
Juan soll das im Auftrag seines Chefs herausbekommen. Denn van Vechten ist ein Freund des Film-Regisseurs und vielleicht sogar ein Liebhaber von Muriels Gattin Beatriz. Juan wird zum Spion wider Willen: Ihm ist das Geschnüffel widerlich, und peinlich ist ihm auch, dass er sich auf eine kurze Affäre mit Hausherrin Beatriz einlässt.
Doch als Juan endlich der ganzen Wahrheit über den dubiosen Arzt und über die Ehehölle der Muriels nahekommt, gebietet ihm der Regisseur zu schweigen. Er will das Schlimme doch lieber nicht wissen, um das noch Schlimmere zu bannen.
Dass die verwickelte, von literarischen Anspielungen, filmhistorischen Hinweisen, politischen Abgründen und erotischen Vergnügungen durchwirkte Geschichte nicht gut ausgehen kann, ist klar. Doch wie Javier Marías auf ein furioses Finale zusteuert und das gefährliche Intrigen-Spiel zu einem (halbwegs) versöhnlichen Ende bringt, ist ganz großes Erzähl-Kino.
Javier Marías: „So fängt das Schlimme an“. Roman. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. S. Fischer Verlag, Frankfurt, 638 Seiten, 24,99 Euro.