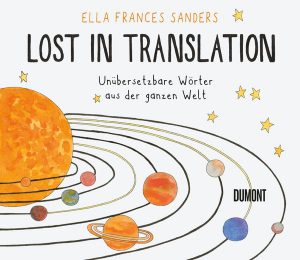Nabelschau (und das durchaus im eigentlichen Sinn des Wortes) können Leser betreiben, die sich an der Seite eines Sozialarbeiters aus dem Ruhrgebiet Zugang zu einer speziellen gesellschaftlichen Spezies verschaffen. Die Wege werden ihnen in dem Buch „Schantall, tu ma die Oma winken“ geebnet.
Der Titel lässt erahnen, welche Zeitgenossen hier observiert werden. Der Band hätte auch genauso gut die Überschrift „Mach dem Mä mal Ei“ vertragen. Schantall Pröllmann, die vor allem in knalligen Farben auftritt, würde an solch einem Satz nichts Falsches oder Verstörendes finden, ihr kleiner Schastin, also Justin, wüsste auf Anhieb, was gemeint ist.

Willkommen also in einer Familie, die zu betreuen dem Jochen wohl nie in den Sinn gekommen wäre, hätte es da nicht im Rathaus des Städtchens Bochtrop-Rauxel diesen Frauentausch, pardon Rollentausch gegeben. Jochen ist eigentlich für die Kulturbehörde tätig, soll aber – wie übrigens auch andere aus der Verwaltung – mal Tapetenwechsel betreiben und andere Ämter kennenlernen. So kommt er schnurstracks in den Bereich Soziales und von dort – ohne über Los zu gehen – als Betreuer zu den Pröllmanns samt Anhang.
Jochen findet sich wieder in einem Land, das die Kevinisten regieren, das seinen Bewohnern unendlich viele Freiheiten gewährt, beispielsweise sprachlich schon längst alle grammatikalischen Einfriedungen beseitigt hat, Jobsuche und finanzielle Grenzen als unerbetene Einmischung in innere Angelegenheiten betrachtet. Da werden dann halt an der Kirmesbude 197 Euro gelassen, Hauptsache man kann eine Grünpflanze sein Eigen nennen. Wenn’s Geld nicht reicht, zeigt Vater Pröllmann eben, was seine Fäuste noch können. Dumm nur, dass die 200 Euro Gewinn ausbleiben, weil der Gegner ein routinierter Kirmesboxer ist und der „Vadder“ der Familie sich eine blutige Nase holt. Mit seinem Gewinn, einer Küchenrolle, zum Abtupfen gedacht, lässt sich das Grünzeug vielleicht noch nett einwickeln.
Apropos einwickeln: Männer umgarnen ist wohl so etwas wie der Breitensport der Weibchen in diesen Kreisen. Ob im Fitness-Studio, zu Karneval oder in Lloret de Mar, Austragungsort der Urlaubssommerspiele mit Sohn und Freundin Cheyenne, wie auch immer dieser Name ausgesprochen werden will: Der Jagdtrieb bestimmt Sein und Bewusstsein. Natürlich funktioniert das Prinzip auch in gegensätzlicher Richtung. Die Männer sind auf der Suche nach paarungswilligen Geschöpfen für den Augenblick. So ist auch Schastin das Ergebnis einer Liaison, deren andere Hälfte längst wieder in Ostdeutschland untergetaucht ist.
Aber das ist nun mal das Schöne an dieser Klientel. Es gibt ja noch Familie, die gefallene Engel auffängt, und angesichts des Verhältnisses von „Quotientenkurve des Intellekts“ und „Anzahl der in die Welt gesetzten Kinder“ nimmt sich die Keimzelle der Gesellschaft nicht gerade klein aus. Entsprechend sind auch die Wohnungen gestaltet, den Begriff Dekoration würde hier – nach Jochens Erfahrungen – wohl niemand verstehen. Gelsenkirchener Barock hat dagegen glatt noch Stil, wobei die Verantwortung für wahllos vollgepfropfte Wohnzimmer eindeutig bei der Industrie liegt, wie der Sozialarbeiter erkennen muss. Ihren Verheißungen, sei es in Prospekten oder Werbespots, kann sich kaum einer und schon keiner vom Schlage Pröllmann entziehen.
Kaufen gehört ohnehin zu den Lieblingsbeschäftigungen von Schantall und ihrer Cheyenne, bei der die Bezeichnung Busenfreundin eine gesonderte Berechtigung hat. Shoppen, wie man auch sagen könnte, rangiert mit wenig Abstand hinter dem Begehren, einen Mann zu kaschen. Die Freude an den Konsumtempeln wird auch durch Anglizismen wie Sale nicht getrübt, sondern eher noch angeheizt, selbst schrille Musik wirkt antörnend. Wenn es mal zu geschmälertem Amüsement kommt, dann schon eher aufgrund der Komplexität von Sonderangeboten wie „Drei für zwei“. Wie soll man sich nur entscheiden, wenn es nicht drei, sondern vier T-Shirts sein sollen?
Bei den Kerlen wiederum belässt es Schantall (vorübergehend) bei einem Exemplar, Cedrik sein Name. Wie man es aus Film und Fernsehen kennt, darf ein Happyend nicht fehlen. Da das Traumpaar schon drei Monate zusammen ist, wird es höchste Zeit, den Bund fürs Leben zu schließen. Getreu dem Motto, „Wenn man schon kein Geld hat, lässt sich doch das am besten ausgeben“, ehelichen die beiden in einem Etablissement, in dem an diesem Tag mal der übliche Betrieb ruht, das Personal aber fröhlich mitfeiert.
Mögen manche Szenen am Ende auch ein wenig überzeichnet wirken, der Autor, der sich in die Rolle des Sozialarbeiters versetzt, beschreibt gesellschaftliche Wirklichkeiten, mal bissig, mal ironisch, oftmals aber auch mit ganz ernsthaftem Ton. Ihm ergeht es so wie vielen Lesern: Erstaunen und Sprachlosigkeit machen sich breit. Letzteres würde man sich auch bei den beschriebenen Kreisen vorstellen können. Hat da jemand von wünschen gesprochen?
Kai Twilfer: „Schantall, tu ma die Oma winken“. Schwarzkopf & Schwarzkopf, 219 Seiten, 9,95 Euro