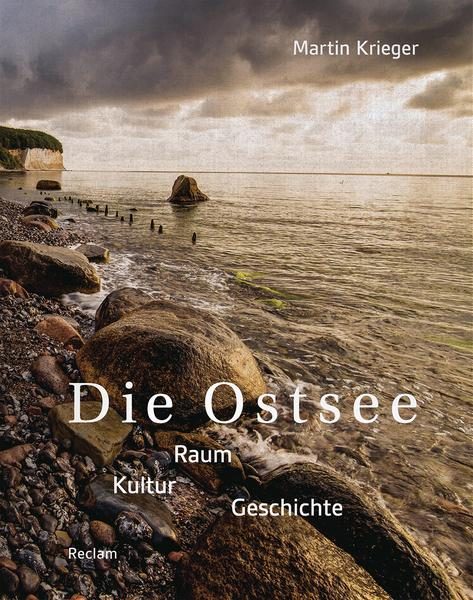„Stonehenge“ in Herne: Der Mythos lebt – sogar in Styropor

Bis zu 7 Meter hoch und denkbar wuchtig: Nachbau des inneren Steinkreises von Stonehenge in Herne (Teilansicht). (Foto: Bernd Berke)
Betritt man den zentralen, hallenhohen Raum des LWL-Museums für Archäologie in Herne, so kommt man sich ziemlich klein vor. Ringsum ragen gigantische „Steine“ auf – just wie im berühmten südenglischen Stonehenge. Tatsächlich hat man den inneren Kreis des über 4000 Jahre alten Megalith-Monuments mit modernster Laserscan-Technologie vermessen und in Originalgröße nachgebaut.
Nun gut, die bis zu sieben Meter hohe Rekonstruktion mit 17 Repliken des inneren Steinkreises besteht aus Styropor, doch die Außenhaut (sanftes Berühren erlaubt!) soll sich ähnlich anfühlen wie jener Sandstein, aus dem das Vorbild besteht. Mehr noch: Während das englische Original an etlichen Stellen von Moos und Flechten bewachsen und überhaupt verwittert ist, sieht man Stonehenge in Herne gleichsam im frischen Zustand der Entstehungszeit, wie die Ausstellungs-Kuratorin Kerstin Schierhold erläutert. Mit etwas Phantasie ist es also vorstellbar, dass die Steinzeitmenschen soeben erst ihre Werkzeuge beiseite gelegt haben.
Doch natürlich verhält es sich anders. Der weltbekannte Steinkreis, etwa um 2500 v. Chr. (also bereits gegen Ende der Steinzeit) errichtet und bis um 1600 v.Chr. vor allem als Kultstätte und Versammlungsort genutzt, ist in Wahrheit das wandelbare Werk von Generationen und Jahrzehnten gewesen. Klar ist auch: Jeder noch so liebevoll gefertigte und raffiniert illuminierte Nachbau vermag zwar zu beeindrucken, besitzt aber bei weitem nicht die Aura des Originals.
Steinkolosse über viele Kilometer transportiert – aber wie?
„Stonehenge – Von Menschen und Landschaften“ heißt die in ihrem Zentrum gleichwohl imposante, an den Rändern ins Kleinteilige sich verästelnde Zeitreisen-Schau, die ziemlich genau ein Jahr lang in Herne zu sehen sein wird. Der Titel lässt es schon ahnen: Eine grundsätzliche Fragestellung lautet, wann und wie Menschen begonnen haben, die sie umgebende Landschaft willentlich und nachhaltig umzugestalten. Im Falle Stonehenge haben sie dabei jedenfalls keine Mühen gescheut und die ungeheuer schweren Sandsteine nach Kräften herbeigeschafft – selbst noch die gewichtigsten (bis zu 40 Tonnen wiegend) über rund 25 Kilometer hinweg, wie Gesteinsvergleiche belegen. Die kleineren, auch noch um die 4 Tonnen schweren Blausteine kamen sogar aus dem späteren Wales – rund 240 Kilometer weit entfernt.
Wie die Menschen die Transporte und noch dazu die Aufrichtung der Kolosse vollbracht haben, wird wohl nie restlos aufgeklärt werden. Man kann es heute höchstens durch Experimente und Mutmaßungen nachvollziehen. Womöglich wurden die Steine von ganzen „Hundertschaften“ mit Hilfe von Seilen und schlittenartigen Vorrichtungen sowie Gleitschienen bewegt und/oder auf runden Holzstämmen gerollt. Einmalig sind übrigens die passgenauen Zapfen- und Nutverbindungen, mit denen die Steine unverbrüchlich zusammengehalten wurden.
„Minimalinvasive“ Archäologie
Wie auch immer: Es war eine phänomenale Willens- und Kraftanstrengung der damaligen Menschen, die bereits einige Findigkeit, Intelligenz und handwerkliches Geschick besessen haben müssen. Kein Wunder, dass sich allerlei Mythen darum ranken. Und obwohl Wissenschaftler die eine oder andere Legende entzaubern, wird das große Ganze hoffentlich immer von Geheimnis umwoben bleiben.
Die Wissenschaft geht allerdings neue, verheißungsvolle Wege: Seit einigen Jahren ist es möglich, archäologische Forschungen auch ohne Grabungen zu bewerkstelligen, bei denen die Fundstücke zwangsläufig beschädigt werden. Mit geomagnetischen Radarmessungen, sozusagen „minimalinvasiv“, lassen sich Fundstellen sehr präzise und zerstörungsfrei aufspüren und virtuell „ausleuchten“. Europaweit führend ist auf diesem Gebiet das – Achtung, Bandwurmname! – Ludwig Boltzmann Institut für archäologische Prospektion und virtuelle Archäologie (LBI ArchPro) in Wien.
Nur zu gern kooperiert das Herner Museum mit dem LBI. Die Wiener Experten unter Leitung von Prof. Wolfgang Neubauer haben ein Gelände von rund 16 Quadratkilometern ausgelotet und konnten nachweisen, dass Stonehenge keine isolierte Kultstätte ist, sondern Bestandteil einer „rituellen Landschaft von gewaltigen Ausmaßen“. So wurden in Durrington Walls, knapp drei Kilometer vom Stonehenge-Steinkreis entfernt, die Relikte bislang unbekannter Bauwerke geortet. Dermaßen viele Terabytes an Daten hat man dazu gesammelt, dass die Auswertung noch Jahre dauern dürfte. Vielleicht kommt ja auch noch während der einjährigen Herner Ausstellungsdauer etwas Neues ans Licht.
Weit ausgreifende Ringe und Ovale von Gräben und Wällen dienten zumal als Begräbnisstätten, zunächst als Kollektivgräber, später (ab etwa 2200 v. Chr.) entstanden auch herausgehobene Einzelgräber, offenbar ein Zeichen gesellschaftlicher Ausdifferenzierung. Das ganze Stonehenge-Areal ist in der Jungsteinzeit vor allem eine Zone ritueller Praktiken, doch auch Versammlungsort für Handel und Tauschwirtschaft (man weiß von „Importen“ über Hunderte von Kilometern) sowie Verteidigungsanlage gewesen. Auch müssen die Menschen dort gemeinschaftlich gegessen, wenn nicht gar gefeiert haben. Reichlich vorgefundene Knochen verzehrter Tiere deuten darauf hin.
Vielfach digital ausgerichtete Präsentation
Das Museum gibt sich betont digital und breitet die Befunde mit ausgeklügelten Projektionen sowie an 25 Medienstationen virtuell aus, zudem werden (u. a. in Zusammenarbeit mit dem British Museum) Online-Führungen angeboten. Doch gibt es auf den 1000 qm Ausstellungsfläche auch einige Exponate in Vitrinen, beispielsweise Grabbeigaben, Werkzeuge, Tierknochen oder auch Gefäße der Glockenbecherkultur. Hier wird man nicht so sehr zum Staunen überwältigt, sondern darf sich auf Details konzentrieren. Doch auch dabei finden sich grandiose Einzelstücke, so etwa jener mit 140.000 winzigen Goldstiften verzierte Dolch aus der frühen Bronzezeit. Abermals ein Rätsel: Wie ist die Herstellung mit den damaligen Mitteln möglich gewesen?
Der Rundgang führt zurück in ein Zeitalter, in dem nomadisch lebende Menschen Zuwanderern vom kontinentalen Festland begegnet sind, die sich um 4000 v. Chr. ganz allmählich zur sesshaften bäuerlichen Gesellschaft zusammengefunden haben – die sogenannte neolithische Revolution. Das Stonehenge-Gebiet dürfte bereits seit etwa 8500 v. Chr. ein Anziehungspunkt für Jäger und Sammler gewesen sein, weil hier Quellen sprudelten, die auch im Winter nicht zufroren und daher nahrhaftes Getier anlockten. Dort haben sich auch rare Rotalgen gebildet, die aufgrund von biochemischen Reaktionen pink schimmerten und eine geradezu magische Wirkung ausgeübt haben dürften.
Vergleiche mit Westfalen und dem Ruhrgebiet
Recht kühn und eher aus regionaler Pflichtschuldigkeit zu erklären sind die Bögen, die das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu westfälischen Steingräbern schlägt. Vergleiche mit bretonischen Formationen lägen vermutlich näher. Mal waren die Vor-Vorläufer der Westfalen mit speziellen Errungenschaften früher an der Reihe als die Ur-Ur-Engländer, mal später. Nirgendwo in unseren Breiten hat es freilich ein Monument gegeben, das Stonehenge auch nur annähernd vergleichbar wäre. Ein Weltwunder und Weltkulturerbe sondergleichen. Etwa eineinhalb Millionen Touristen strömen jährlich dorthin, auch seltsam anmutende Druiden-Feiern finden dort gelegentlich statt, vor allem zu den Sonnenwend-Daten. Schon an normalen Tagen lassen Autostaus im weiten südenglischen Vorfeld ahnen, dass es hier etwas Besonderes geben muss… Apropos: Die Ausstellung schließt mit ein paar Kuriosa, darunter einer putzigen Stonehenge-Parodie aus „versteinerten Colaflaschen“ oder dem Hinweis auf eine aufblasbare Stonehenge-Hüpfburg. Was es nicht alles gibt.
Geradezu tollkühn muten schließlich die Vergleiche mit dem Ruhrgebiet und Landmarken wie der Halde Hoheward an, wo „der Mensch“ – aus ganz anderen Motiven – ja auch folgenreich in die Landschaft eingegriffen hat. Auch dies hatten die Ausstellungsmacherinnen im Sinn. Sollte demnach die Errichtung von Stonehenge ein frühzeitlicher Sündenfall gewesen sein, der Jahrtausende später ins industriell Monströse mündete? Oder anders herum: Wird man Teile des Reviers dereinst als rätselhaft magische Stätten bewundern?
„Stonehenge – Von Menschen und Landschaften“. 23. September 2021 bis 25. September 2022. LWL-Museum für Archäologie (Westfälisches Landesmuseum), Herne, Europaplatz 1. Tel.: 02323 / 94628-0
Geöffnet Di, Mi, Fr 9-17, Do 9-19, Sa/So/Feiertage 11-18 Uhr. Eintritt 7 € (ermäßigt 3,50 €), Katalog 34,95 €.
www.stonehenge-ausstellung.lwl.org