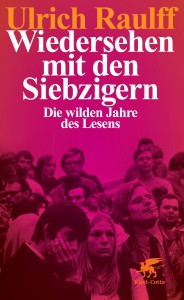Leben im Wildwuchs der Lektüren: Ulrich Raulff blickt in die 1970er Jahre zurück
Leicht kommen einem die eigenen Jugendjahre mitsamt den Zwanzigern wie die allerbesten Abschnitte der Geschichte vor. Das waren noch Zeiten. Da fühlte man sich noch (gelegentlich) kraftvoll und schier unverwundbar. Und wie man von Tag zu Tag immer klüger wurde, wie man allen die Stirn bieten wollte…
In solchem Sinne, wenn auch mit nachträglicher Skepsis ausbalanciert, hat Ulrich Raulff jetzt Bruchstücke seiner intellektuellen Autobiographie vorgelegt. Ein weiteres Beispiel fürs Genre „Wenn Großvater erzählt“?
Der 1950 in Meinerzhagen geborene Raulff hat seine historischen und philosophischen Studien vornehmlich in Marburg, Frankfurt und Paris betrieben, sich aber auch in Berlin, England, Italien und den USA umgetan. Man darf da wohl einen gutbürgerlichen Familienhintergrund mit entsprechendem Selbstbewusstsein vermuten.
Jedenfalls hat Raulff etwas aus sich gemacht: Er war zeitweise Feuilletonchef der FAZ sowie leitender Redakteur der „Süddeutschen Zeitung“ und ist schließlich 2004 Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach geworden. Alles vom Feinsten.
In dem Buch „Wiedersehen mit den Siebzigern“ erzählt er nun vornehmlich von seinen studentischen Lehr- und Wanderjahren. Der „Nach-68er“ Raulff, der somit an der vermeintlich großen Rebellion nicht beteiligt war, schildert die frühen 70er Jahre als Zeit des überaus heiligen Ernstes aus dem allmählich versiegenden Geiste marxistischer Strömungen und Grüppchen. Welch eine Rechthaberei herrschte da! Wie war man im Gehege des Zeitgeistes gefangen! In so mancher festgefahrenen Debatte ward den Sensibleren unbehaglich zumute. Hier drohte der Absturz ins Kleinbürgerliche, dort das Elend der Polit- und Psychosekten.
Ulrich Raulff beschreibt die vielen, vielen langen Tage, die er in den schönsten und ergiebigsten Bibliotheken verbracht hat. Er selbst baute an der Uni regelmäßig einen Büchertisch auf. Auch die erotische Neigung zu zartsinnigen Mädchen scheint sich allemal durch gehabte oder ersehnte Lektüren angebahnt zu haben. Büchereien, so lernen wir abermals, sind nicht zuletzt Stätten eines im weitesten Sinne erotischen Begehrens. Das Leben und das Lesen waren also nahezu eins.
Als große Befreiung hat der junge Mann es erlebt, im Paris der mittleren und späten 70er Jahre in ein ganz anderes intellektuelles Klima einzutauchen als vormals in Marburg, wo etwa Wolfgang Abendroth das Sagen hatte. In Frankreich waren es die großen Zeiten von Roland Barthes und Michel Foucault. Glückhafter Umstand für die weiteren Jahre: Von Foucault hielt Raulff alsbald ein Empfehlungsschreiben in den Händen, das seinerzeit in Paris und eigentlich weltweit alle Türen der Geisteswelt öffnete. Er und ein Freund hatten sich einfach getraut, den großen Meister anzusprechen…
Der Strukturalismus und seine Vernunftkritik, die etwas später als Import in Deutschland anlangten, erwiesen sich für Raulff als Vademecum gegen den bis dato stramm links dominierten Diskurs. Ideologische Spurwechsel wurden damals vielfach vollzogen. Vom „Auszug aus der Suhrkamp-Kultur“ ist bei Raulff die frohe Rede. Als weiterer Zweig des Bedenkenswerten kam u. a. Aby Warburgs und Erwin Panofskys Ikonologie (Lehre von den Bildern) hinzu, deren Impulse im deutschen Sprachraum von Denkern wie Klaus Theweleit und Ausstellungsmachern wie Harald Szeemann aufgenommen wurden.
Noch heute zeigt sich Raulff so beseelt von jener Zeit, dass er sich vielfach in Einzelheiten verliert. Der Punk kam damals auf und Raulff war Mitbegründer einer eher randständigen Zeitschrift namens „Tumult“. Man vernimmt hie und da Gestus und Duktus eines weltläufigen „Ich war dabei“, doch behält all das einen gewissen Charme und gerät nirgendwo zum Auftrumpfen. Gegen die Gefahren eines Bildungsphilistertums ist Raulff offenbar gefeit.
Auch kann man wahrlich die Wehmut nachvollziehen, mit der Raulff die schweifenden, wildwüchsigen Lektüren beschwört, deren Früchte sich in Zettel- und Karteikästen statt in Computer-Dateien ergossen haben. Jeder Lesende war sozusagen seine eigene Suchmaschine.
Wer damals (wenngleich begrenzter und glanzloser) ebenfalls studiert hat, kann zudem einigen geistigen Signaturen jener Jahre nachspüren, die einen selbst – so oder so – berührt haben. Auch in diesem Sinne sind Raulffs Erinnerungen ein aufschlussreiches Dokument der „Jahre, die ihr kennt“.
Ulrich Raulff: „Wiedersehen mit den Siebzigern. Die wilden Jahre des Lesens“. Klett-Cotta. 170 Seiten. 17,95 Euro.