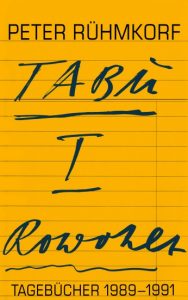Ich bin Raucher und Querulant!
Ich bin empört! Da saust mir der unsägliche Begriff „Wutbürger“ um die Ohren. Aber eins nach dem anderen.
Der Gesundheitsterror geht weiter. Wir werden reguliert! Alles, was krank macht, wird ausgelöscht. Die Grüne Partei entwickelt sich weiter zur Weltrettungsvereinigung, deren einziges Ziel es ist, die Selbstbestimmung des Menschen zu reduzieren, die Freiheit weiter runterzuregeln. Und das alles unter dem Mantel der Gesundheit und der Umwelt. Gesund – was ist das? Rein und sauber? Was macht krank? Alles, wenn man täglich Zeitung liest oder andere Medien verfolgt. Essen ist ungesund, trinken sowieso, atmen gar, je nachdem wo wir uns befinden und welche Verunreinigungen gerade unterwegs sind. In den USA gibt es Orte, da werden junge Leute ins Gefängnis gesteckt, weil sie auf der Straße geraucht haben. Das ist die dortige Sheriffs-Gesetzeslage.
In NRW will man jetzt wieder die Stigmatisierung der Raucher vorantreiben. Ich bin Raucher, aber selbst als Nichtraucher hätte ich Schaum vor dem Mund. Wer wird denn da geschützt? Wen schützt man, wenn derjenige oder diejenigen nicht geschützt werden will? Warum, zum Teufel, sollen separate Räume verboten werden, in denen geraucht werden darf? Das ist Kriminalisierung auf perfidestem Niveau. Ich weiß, dass ich hier einfach nur meine Wut ausdrücken kann. Bin ja der Wutbürger.Das Rauchen wird auf eine Stufe gestellt mit Heroin.
Den Menschen muss man offenbar vor sich selber schützen. Ich finde, dass auch das Händewaschen in öffentlichen Gebäuden zur Pflicht werden muss! Kameras in die WCs!
Die Zigarette ist das Übel unserer Gesellschaft. Das habe ich längst verstanden. Schon seit langem gehe ich kaum noch aus, im Sommer ja, im Winter fast gar nicht mehr, weil ich mich nicht wie ein Hund vor eine Tür stellen will, um zu rauchen. Erstens, weil ich es gerne tue und zweitens, weil ich süchtig bin, also eigentlich krank. Aber es ist mein Bier (!), ob ich damit umgehe, wann und wie ich aufhöre und wer mir dabei hilft.
Sollte ich jemanden zufällig anpusten mit meinem blauen Dunst, dann werde ich eines nahen Tages verhaftet wegen Körperverletzung. Wenn mir allerdings jemand in die Fresse haut, mir eine Flasche auf den Kopf haut, oder gar nur solches androht, dem muss ich beweisen, dass er es getan hat. Wenn ich die Polizei anrufe, weil ich mich bedroht fühle, dann muss erst eine Körperverletzung passieren, bevor jemand kommt. Wenn ich rauche, bin ich schon schuldig.
Aber eigentlich ist es noch perfider. Der Betreiber der Gastronomie oder ähnlicher Läden verbietet das Rauchen und alle halten sich dran, weil sie alle Angst haben vor Denunziation. Jemand könnte den Wirt anzeigen. Militante Nichtraucher beharren auf ihrem Recht und setzen sich mitten in Raucherbereiche. Damit beschäftigen sich einige, die meinen, Gesundheit fordern zu müssen. In Wirklichkeit ist es die Gehässigkeit des kleinen Bürgers, der endlich etwas hat, worauf er öffentlich besteht und niemand wird ihm wiedersprechen, denn es ist politisch korrekt, Raucher zu beschimpfen.
Alle Medien fahren auf diesem Boot. Rauchverbote werden gefeiert. Da ist man sich, mit ein paar Ausnahmen von unaufgeregten Zeitgenossen, einig.
In den USA kauft man sich eine Waffe. Das gehört sich geradezu so, weil man ja sein Eigentum schützen muss. Der vermeidlich Böse betritt den Garten und er wird abgeballert. Das ist korrekt. Der Raucher wird verhaftet oder ausgeschlossen.
Das klingt alles nach „Säuberung“. Das Land soll von Dingen befreit werden, die die Volksgesundheit beeinflussen, negativ natürlich. Genussmittel ist die Möhre. Es sei denn, die Möhre ist plötzlich gefährlich, weil sie von Bakterien gekapert wurde.Nun ist die Möhre keine Zigarette. Sie stört niemanden, dampft nicht.
Ich will hier nicht über die Auswirkungen von Alkohol reden, über die Toten durch Totschlag, über die Entzugskosten, über die Wohnzimmerschlägereien und Vergiftungen. Ich bin gegen ein Verbot von Alkohol. Man weiß ja, was dabei herauskommt.
Schon lange wird versucht, über den Preis die bösen Sachen unzugänglicher zu machen, aber für wen? Doch nur für die, die man sowieso zum unteren Drittel zählt. Diejenigen, die nix haben, sollen sich gefälligst keine Süchte oder Genüsse leisten. Das ist klar. Hab ich genügend Kohle, kann ich mir den Koks auch leisten. Die arme Sau soll eben irgendwo einbrechen, um an das Zeugs zu kommen.
Sowieso soll der Mensch in der unteren Klasse sich bescheiden, in jeder Hinsicht. Das Argument, der „Hartzler“ würde sein Geld für Alkohol und Zigaretten ausgeben, deshalb solle er nicht mehr erhalten, zieht immer. Da schreit das Volk: Genau! Aber das Zeugs wird halt teurer. Gut, nicht der Alkohol, außer man nimmt ihn in Gastronomien ein, aber der Tabak. Ganz Europa zieht mit, übernimmt diese Unmündigmachung des Bürgers. In Litauen denkt man darüber nach, Alkohol in Restaurants nur bis 22.00 auszuschenken. Eine wunderbare Idee. Ich war oft genug in Großbritannien und erinnere mich an die Massentorkeleien in den Straßen mit vielen Pubs. Kurz nach 23.00 war Schluss mit lustig. Kurz vorher gibt’s reihenweise Sturztrünke und auf den Straßen kotzt der Bär. Im Urlaub konnte man sehen, dass die Engländer mit der verlängerten Sperrstunde überfordert sind. Sie saufen ab 22.00 schneller und enden im Koma. Aber ich schweife ab.
Der Verbot von Genuss und mag er noch so ungesund sein, führt zu Verlust. Die Nichtraucher haben jetzt längst Schaum vor dem Mund. Wischt ihn Euch ab, Zeitgenossen, bleibt gelassen! Ihr könnt überall auf dieser Welt nichtrauchen. Überall. Von mir aus könnt Ihr Euch organisieren, demonstrieren, kollektiv aufregen! Aber vielleicht muss man den Raucher öffentlich deutlicher erkennen. Da machen bestimmt die Krankenkassen mit. Hallo Grüne und andere Gesundheitsbewegte: Wie wär‘s mit Kennzeichnung? Schwarze Bändchen am Handgelenk zum Beispiel, aber unabkriegbar. Sie bleiben bis man den Nachweis des Nichtrauchens erbracht hat. Ansonsten: Raucher raus! Kauft nicht bei Rauchern! Enteignet die Raucher! Keine Wohnungen mehr für Raucher!
Kommt mir so bekannt vor. Dazu kommen Warn-Schilder, die an Lokale angebracht werden, in denen man Raucher erwischt hat. „In diesem Lokal wurde geraucht!“ Wirte und Veranstalter werden per Verordnung zu Gesundheitshütern. Die Gesundheitspolizei wird eingeführt. Da bin ich sicher. Sie wird nicht so heißen, aber sie wird Jagd machen auf Ungesunde. Halali!
Blödsinnige Verbote, Einengungen, Maßregelungen haben mich schon immer gestört. Ich habe die Hippie-Zeit sozusagen aktiv mitgemacht und erinnere mich an Rauswürfe und Stigmatisierung, weil man lange Haare hatte. Das galt als ungesund, also ästhetisch ungesund.
Ich bin so bekloppt, dass ich, seitdem es das Rauchverbot gibt, das Gefühl habe, genau deswegen weiter und gar mehr zu rauchen und dies zu demonstrieren.
Hätte ich einen Arbeitsplatz in einem geschlossenen Raum ohne rauchen zu können, ich wäre ein Versager. „Wo ist der denn schon wieder?“ „Rauchen.“ Das will ich nicht. Wenn ich an einem Problem sitze, wenn ich mich kreativ ereifere, dann muss ich rauchen. Aber wie ich höre, soll das ja in Gefängnissen weiter möglich sein, das Rauchen, auch in psychiatrischen Kliniken.
Da sitzen eh die, die wir nicht brauchen.
Im Fernsehen rauchen, mit Ausnahmen, nur noch die Bösen in den Krimis. Der Rest ist sauber. Vorbildfunktion nennt man das. So langsam wird der Raucher auch aus der Kunst verschwinden. Fast immer, wenn der Fotojournalist kommt, sagt er: „Können Sie die Zigarette ausmachen?“ „Nö.“
Also: klar ist, ich huste hin und wieder und es ist mir peinlich. „Man erkennt mich schon am Husten“, wird gesagt. Ich weiß das. Im Theater huste ich weniger als andere. Das ist Disziplin, angelernt. Meine Kondition ist sozusagen nicht vorhanden, allerdings auch, da ich keinerlei sportlicher Betätigung nachgehe, nie nachgegangen bin. Mein Geschmackssinn ist vielleicht nicht der, den ich mir wünsche. Vielleicht hat er gelitten wie der Geruchssinn. Ich hoffe, damit niemanden zu schaden. Die eine oder andere Krankheit, mit der ich mich herumschleppe, hat eventuell mit dem Rauchen zu tun, verbessert zumindest nicht die Situation. In meinem Auto stinkt es nach Zigaretten, wie überhaupt kalter Rauch, Tabakreste, volle Aschenbecher keinen angenehmen Geruch verbreiten. Meine Freundin raucht leider auch, so dass wir uns gegenseitig keinen Raucheratem vorwerfen können. Nichtraucher haben sicher keine Mühe, sich meinem Atem zu entziehen. Meine Haut ist nicht von glatter, zarter Oberfläche gezeichnet. Schon immer. Ich finde es albern, sich eine Zigarette anzustecken, sobald man ein Gebäude verlässt. Ich mache das ab und zu. Auch, während ich durch einen Wald laufe, muss ich nicht rauchen. Er könnte ja in Flammen aufgehen. Nichtraucher-Hotels meide ich oder ich rauche, weil ich dafür zahle, übernachten zu können. Kommen sie sich besonders sauber vor? Clean? „Ich bin clean“, kann an auch als ehemaliger Raucher sagen, obwohl man ja immer einer bleibt – wie beim Alkohol der Alkoholiker. Man ist also gezeichnet als Süchtiger. Reicht das nicht?
Ist mangelnde Bildung nicht auch gesundheitsgefährdend? In ihren Konsequenzen? Vielleicht habe ich das Rauchen angefangen mangels Erkenntnis, mangels Bildung also? Dann bin ich eben – der Doofheit verfallen – in diesen Strudel gelangt?