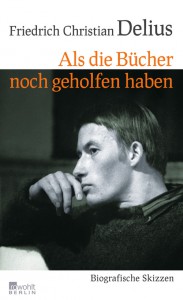F. C. Delius zieht Bilanz – diesseits und jenseits der Ideologie
Wenn ein Büchnerpreisträger seinen neuen Band „Als die Bücher noch geholfen haben“ nennt, so klingt das nach Resignation – und man möchte inständig hoffen, dass er es nicht so meint.
Tatsächlich scheint es, als hätte sich Delius hier noch einmal seines langen literarischen Weges vergewissern wollen. Zeitlich hebt es an mit dem eher unscheinbaren, doch recht glückhaften Auftritt des schüchternen jungen Schriftstellers beim Treffen der damals noch maßgeblichen „Gruppe 47“ im schwedischen Sigtuna.
Das ebenfalls ausgiebig geschilderte Nachfolgetreffen in Princeton/USA nutzte dann der junge Peter Handke ganz gezielt für seine furiose Generalattacke auf die „Beschreibungsimpotenz“ der deutschen Gegenwartsliteratur, also seiner lästigen Konkurrenz. Auch so hochfahrend konnte man sich damals also den Eintritt in die Kreise der Hochliteratur verschaffen. Im grob gewobenen Vergleich steht der bescheidene Delius jedenfalls nicht schlecht da. Auch so eine Marktstrategie.
Nicht nur im Vorfeld der APO-Jahre galt, dass Literatur, wenn sie den Namen verdient, vor platten Ideologien bewahrt – ein Credo, das Delius auch durch die teils dogmatisch erstarrende Nach-68er-Zeit beibehalten hat, als manche gar den „Tod der Literatur“ ausrufen oder die Literatur wenigstens in linke Dienste nehmen wollten. Auch in diesem Punkt möchte Delius sanft darauf hingewiesen haben, dass er damals nicht auf der falschen Seite gestanden hat. Was er sich freilich bis heute vorwirft, ist, dass er nicht vehementer gegen dröhnende Ideologen Einspruch erhoben hat. Wohl auch eine Frage des Temperaments.
Breit ausgemalt wird noch einmal der Konflikt mit dem eigentlich sehr literatursinnigen Verleger Klaus Wagenbach, der in den frühen 70er Jahren unter Einfluss von Baader-Meinhof-Apologeten geraten sei und daher sein Politprogramm für krude Stadtguerilla-Thesen geöffnet habe. Hier sitzt wohl noch ein Stachel: Derart ausführlich schlägt Delius noch einmal die Schlacht von vorvorgestern, dass es sich wie eine noch ausstehende, finale Abrechnung mit dem Wagenbach jener Jahre liest. Ganz so, als wollte Delius nun endlich seinen geistigen Nachlass ordnen und dabei seine damalige Rolle ein für allemal festhalten.
Doch beileibe nicht nur Wagenbach ist damals in den Strudel der Ideologie geraten. Zitat Delius: „Ein unerforschtes Gebiet: Wie sich die Sprache der Studentenbewegung zwischen 1967 und 1970 ins Offensive, vom Fragen zum Behaupten gewendet, vom Konkreten und Sinnlichen abgewendet, radikalisiert und es sich im Abstrakt-Allgemeinen bequem gemacht hat.“ Jeder, der damals in bissige Polit-Debatten verstrickt war, wird diesen Ansatz seufzend bestätigen. Es waren giftige Jahre, in denen am Streit um die „richtige“ Linie nicht selten Freundschaften oder Beziehungen zerbrachen.
Für einen Schriftsteller, der sich als Teil der Linken begriff, die literarischen Kriterien aber keineswegs preisgeben mochte, müssen jene Zeiten eine stete Gratwanderung, ein schwieriges Lavieren gewesen sein. Zumal Delius sehr frühzeitig – bereits ab 1963 – mit Autorenkollegen in der DDR (Günter Kunert, Wolf Biermann, später Heiner Müller, Thomas Brasch usw.) Freundschaft geschlossen hat, deren Texte er unter schwierigen Bedingungen im Westen zugänglich machte, wenn es nur irgend möglich war. So einer konnte den Moskauer Doktrinen nicht mehr auf den Leim gehen.
Übrigens hat Delius als Lektor beim Rotbuch-Verlag auch die spätere Nobelpreisträgerin Herta Müller erstmals hierzulande herausgebracht. Das ist denn doch ein bemerkenswerter Befund: Gerade linke Literaten und Lektoren haben damals offenkundig ungleich mehr für Autoren aus dem Osten (und somit indirekt für den Fall der Mauer) bewirkt, als die notorischen „Kommunistenfresser“.
Es ist überhaupt eine „Lehre“ dieses Buches: Wer sich den Sinn für literarische Qualität bewahrt und als Kompass nutzt, der widersteht so mancher falschen Lockung. Delius benennt auch einige andere, die auf solche Weise unbeirrbar Kurs hielten; unter den Generationsgenossen vor allem Nicolas Born und Peter Schneider, dazu verehrte Vorbilder von großer geistiger Unabhängigkeit wie etwa Susan Sontag oder Walter Höllerer.
Die Lektüre dieser Delius-Rückblicke setzt ein ausgeprägtes Interesse für Zeit-, Literatur- und Verlagsgeschichte mit ihren Kollektiv-Experimenten speziell der 1970er Jahre voraus. Der Autor breitet auch noch einmal seine langwierigen juristischen Auseinandersetzungen mit dem Siemens-Konzern (nach der fiktiven Festschrift „Unsere Siemens-Welt“, um die es einen erbitterten Satirestreit gab) und mit dem damaligen Kaufhauskönig Helmut Horten aus.
Zuweilen weiß man nicht so recht, was Delius bei seinen „biografischen Skizzen“ (Untertitel) angetrieben hat. Mal lesen sich die Kapitel wie bloße Reminiszenzen für die archivarische Schublade, anderes klingt nach Rechtfertigung und Apologie, wieder anderes nach Materialiensammlung für ein Lesebuch zum Zeitgeist und zum Werkhintergrund des Autors. An manchen Punkten wäre eine präzise Nennung der Zitatstellen dokumentarisch hilfreich gewesen.
Offen klafft schließlich die Frage, ob die Bücher heute weniger oder gar nicht mehr helfen. Der letzte Text des Bandes ist Delius’ Dankrede zum Büchnerpreis, in der denn doch den Worten wieder alles Gewicht gegeben wird: „…am Ende entscheiden in der Literatur (…) allein die Sätze, der Satz. Die Energie und die Unruhe, die sich zwischen zwei Punkten entfalten.“ Es möge so bleiben immerdar.
Friedrich Christian Delius: „Als die Bücher noch geholfen haben“. Biografische Skizzen. Rowohlt Berlin. 304 Seiten. 18,95 Euro.