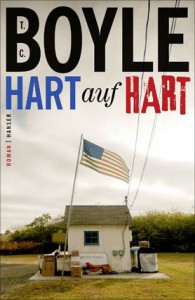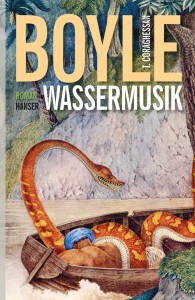Bücher, kurz vorgestellt: Hotel, Proletariat, Apokalypse
Ich leiste Abbitte. Hier sind noch drei Bücher, die wohl eine ausführlichere Besprechung verdient hätten. Doch fehlte mir wegen besonders misslicher Umstände schlicht und einfach die Zeit, die jetzt schon wieder in Richtung Herbst galoppiert. Drum seien die Bände hier immerhin kurz vorgestellt:
 Eine veritable Wiederentdeckung ist der Roman von Maria Leitner: „Hotel Amerika“ (Reclam, 256 Seiten, 25 Euro). Das erstmals 1930 erschienene Buch zählt zur Spezies der urbanen Hotelromane, die in den bewegten 1920er Jahren aufblühte. Kein Geringerer als Siegfried Kracauer rezensierte das Buch damals für die legendäre Frankfurter Zeitung und arbeitete die Unterschiede zu thematisch ähnlich gelagerten Schöpfungen von Vicki Baum und Joseph Roth heraus.
Eine veritable Wiederentdeckung ist der Roman von Maria Leitner: „Hotel Amerika“ (Reclam, 256 Seiten, 25 Euro). Das erstmals 1930 erschienene Buch zählt zur Spezies der urbanen Hotelromane, die in den bewegten 1920er Jahren aufblühte. Kein Geringerer als Siegfried Kracauer rezensierte das Buch damals für die legendäre Frankfurter Zeitung und arbeitete die Unterschiede zu thematisch ähnlich gelagerten Schöpfungen von Vicki Baum und Joseph Roth heraus.
Maria Leitner, die selbst in prekärer Stellung in einem New Yorker Hotel gearbeitet hatte, schildert die Verhältnisse von „ganz unten“, aus Sicht des irischen Wäschemädchens Shirley, konzentriert auf Ereignisse eines einzigen Tages. Machart und Stil muten noch heute prickelnd modern an.
Man staunt immer wieder, welche Schätze literarische Scouts aus fast vergessener Vergangenheit heben. In diesem Falle war es die Chemnitzerin Helga W. Schwarz, die sich beharrlich für eine Neuentdeckung eingesetzt hat, nachdem sie in der DDR wiederaufgelegte Bücher gelesen hatte. Eigentlich fast überflüssig zu sagen, dass die NS-Machthaber Maria Leitner ins Exil getrieben haben. Was hätte sie in einer besseren Welt noch bewirken können!
______________________________________________________
 Seitdem das proletarische Milieu weitgehend geschwunden ist, erscheinen – im Zeichen der biographischen Selbstvergewisserung – umso mehr Erzähltexte, die Bruchstücke jener Vergangenheit bewahren wollen. Hierher gehört, mit eigenen Akzenten, letztlich auch der von Martin Becker verfasste Roman mit dem schlichten Titel „Die Arbeiter“ (Luchterhand, 302 Seiten 22,70 Euro).
Seitdem das proletarische Milieu weitgehend geschwunden ist, erscheinen – im Zeichen der biographischen Selbstvergewisserung – umso mehr Erzähltexte, die Bruchstücke jener Vergangenheit bewahren wollen. Hierher gehört, mit eigenen Akzenten, letztlich auch der von Martin Becker verfasste Roman mit dem schlichten Titel „Die Arbeiter“ (Luchterhand, 302 Seiten 22,70 Euro).
Der 1982 geborene, im sauerländischen Plettenberg aufgewachsene Autor erzählt die Geschichte einer Arbeiterfamilie aus dem Ruhrgebiet. Auch er weiß genau, wovon er schreibt: Sein Vater war Bergmann, seine Mutter Schneiderin. Er kennt also die einfachen Verhältnisse, in denen man sich für ein kleines bisschen Wohlstand abrackert. Die Rückschau hat denn auch so gar nichts von nostalgischem Beigeschmack.
_______________________________________________________
 T. C. Boyle muss wirklich nicht mehr großartig gewürdigt werden, er zählt zu den Weltbestsellern von gehöriger Substanz. Mit seinen Short Stories in „I Walk Between the Raindrops“ (Hanser Verlag, 272 Seiten, 25 Euro – Übrigens eine seltsame Marotte im Verlagswesen: englische Titel für ins Deutsche übersetzte Bücher) entwirft er wieder einmal Szenarien des allmählichen, jedoch zunehmend rasanten, offenbar unaufhaltsamen Weltuntergangs. Wie er das fertigbringt, macht ihm das so leicht niemand nach. Wenn ein Schriftsteller auch technisch auf Höhe dieser Zeit ist, dann sicherlich er (na, gut: und ein paar wenige andere). Fragt sich nur, wie man nach solchen Büchern guten Gewissens und frohen Herzens weiterleben soll. Und doch: es geht. Höchstwahrscheinlich.
T. C. Boyle muss wirklich nicht mehr großartig gewürdigt werden, er zählt zu den Weltbestsellern von gehöriger Substanz. Mit seinen Short Stories in „I Walk Between the Raindrops“ (Hanser Verlag, 272 Seiten, 25 Euro – Übrigens eine seltsame Marotte im Verlagswesen: englische Titel für ins Deutsche übersetzte Bücher) entwirft er wieder einmal Szenarien des allmählichen, jedoch zunehmend rasanten, offenbar unaufhaltsamen Weltuntergangs. Wie er das fertigbringt, macht ihm das so leicht niemand nach. Wenn ein Schriftsteller auch technisch auf Höhe dieser Zeit ist, dann sicherlich er (na, gut: und ein paar wenige andere). Fragt sich nur, wie man nach solchen Büchern guten Gewissens und frohen Herzens weiterleben soll. Und doch: es geht. Höchstwahrscheinlich.
Ganz nebenbei: Auf dem Cover stört eigentlich nur der obligatorische Spruch des nahezu unvermeidlichen Denis Scheck: „Starke Geschichten für heftige Zeiten.“ Aha. Muss man solche Testimonials wirklich unbedingt auf die Titelseite heben?