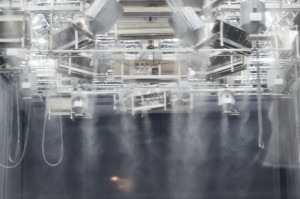Im Dunstkreis russischer Propaganda: Teodor Currentzis dirigiert Verdis „Messa da Requiem“ im Konzerthaus Dortmund

Teodor Currentzis nimmt im Konzerthaus Dortmund den Beifall entgegen. Rechts ist der Sänger Matthias Goerne zu sehen. (Foto: Holger Jacoby)
Darüber lässt sich keine übliche Konzertkritik schreiben: In Dortmund tritt ein Dirigent auf, der sich bisher erfolgreich um eine eindeutige Distanzierung von Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine gedrückt hat, sich mit seinem Ensemble aber nach wie vor von Sponsoren mit Putin-Nähe fördern lässt.
Teodor Currentzis bringt ins Konzerthaus statt der angekündigten konzertanten „Tristan und Isolde“-Aufführung Giuseppe Verdis „Messe da Requiem“ mit. Ein Statement gegen den Krieg? Der Abend in Dortmund sieht nicht so aus: Die bürgerliche Kunstreligionsfeier geht ungebrochen vor sich; im Programmheft ist kein Wörtchen zu lesen, das der Aufführung irgendeine über den Event selbst hinausgehende Bedeutung geben würde. Das Publikum im nicht ganz vollbesetzten Saal begrüßt Chor und Orchester von MusicAeterna mit verhaltenem, aber langem Beifall. Als Currentzis mit viertelstündiger Verspätung aufs Podium springt, gibt es bereits einzelne Bravos. Der Schlussbeifall ist ebenfalls durchmischt mit – künstlerisch verdienten – Anerkennungsrufen. Gilt’s also nur der Kunst?
Auf Gazprom-Tournee
Wenn es so einfach wäre, hätte sich die Kunst tatsächlich aus der gesellschaftlichen Relevanz verabschiedet. Denn im Falle von Currentzis und MusicAeterna geht es nicht um moralische Bewertung privater Meinungen oder um idealistischen, von den Niederungen der Politik elfenbeinern abgeschiedenen Musik-Enthusiasmus, sondern es geht um ein Ensemble und einen Dirigenten, die auf Gazprom-Konzerttour gegangen sind, als die sogenannte Spezialoperation längst im Gange war. Das Verdi-Requiem, das nun in Dortmund zu hören war, gab es kurz zuvor in Sankt Petersburg – und das etwa ohne Förderung von Gazprom oder der sanktionierten VTB-Bank, deren Sponsoring schon vor dem Krieg auf Kritik stieß?
Currentzis hat sich medial wahrnehmbar nicht einmal mit einer allgemein gehaltenen Aussage gegen Krieg und Gewalt von dem distanziert, was da seit Monaten in Europa an Grausamkeiten verübt wird. Er schweigt und entzieht sich den Fragen von Medien – und die machen, wie der Musikjournalist Axel Brüggemann dokumentiert hat, problemlos mit. Wo sonst um jede Straßenumbenennung eine Debatte geführt wird, ist die Haltung eines Nutznießers des Putin-Systems offenbar nicht der hartnäckigen Nachfrage wert. Dabei ist es naiv anzunehmen, man könne in der gegenwärtigen politischen Situation einfach nur Kunst um der Kunst willen genießen: Currentzis wird, ob er will oder nicht, Bestandteil der russischen Propaganda; ein Teil eines kulturellen Krieges, der nicht nur auf den Schlachtfeldern in der Ukraine ausgefochten wird.
Problematische Finanzierung
Die Kölner Philharmonie hat klare Kante gezeigt und ein Konzert mit Currentzis und dem SWR Sinfonieorchester abgesagt. So weit gingen weder der Ex-Dortmunder Benedikt Stampa in Baden-Baden noch Konzerthaus-Intendant Raphael von Hoensbroech. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er über die Finanzierung, er halte sie für kritisch, wisse aber, dass das nicht so schnell änderbar sei. Das mag so sein, aber wenn ein Ensemble keinerlei Indizien erkennen lässt, dass es seine Finanzierung von problematischen Sponsoren unabhängig gestalten könnte, ist das auch ein Statement. Und ob ein Klangkörper mit einem Sony Classical Exklusivvertrag und Hochglanz-Auftritten in ganz Europa – einem umstrittenen Event bei den Salzburger Festspielen dieses Jahres eingeschlossen – beim Abschied von problematischen Sponsoren gleich an den Rand seiner Existenz geraten würde, ist fraglich: Vielleicht hätte sich nach einer Distanzierung ein neuer Sponsor gefunden, der solchen Mut gewürdigt hätte?
Immerhin schließt von Hoensbroech weitere Auftritte von MusicAeterna im Konzerthaus Dortmund vorerst aus. Einige Musiker, die sich in sozialen Medien für den Krieg positioniert hatten, wurden suspendiert – ob nur für den Auftritt in Dortmund oder auf Dauer, ist unklar. Dazu zählt auch der Geiger, der in einem Video-Post angekündigt hatte, er zerstöre Deutschlands Wirtschaft, und dazu ein Heizkörperventil aufgedreht hat. Den Witz muss man nicht verstehen. Aber er könnte wohl auch als Indiz für die Haltung in Teilen der Orchesters verstanden werden und damit mehr als nur eine individuelle Entgleisung darstellen.
Die Kunst muss sich nicht verstecken
Um die Kunst soll es nun aber auch gehen – und in dieser Hinsicht braucht sich MusicAeterna nicht zu verstecken. Schon im „Te decet hymnus“ gibt der Chor eine erste Probe seiner Präzision, die sich im Verlauf des „Dies irae“ und in der „Sanctus“-Doppelfuge atemberaubend bestätigt. Selten ist diese oft als musikalisches Schlachtengemälde missverstandene Sequenz so durchhörbar und genau gestaltet zu erleben. Currentzis wägt sorgfältig ab, welche Gruppen im Orchester gerade dominieren und welche zurücktreten sollen, erzeugt so einen tief gestaffelten, bei aller Wucht variablen Klang, lässt hören, dass Verdi hier keine bloße Überwältigungsstrategie fährt und die differenziert ausgearbeitete Partitur nicht als Lektürevergnügen, sondern als blutvoll ausmusizierte Vorlage dienen soll.
Dass Currentzis mit seinen Manierismen nicht bricht, ist jedoch auch hörbar. Die Celli zu Beginn sind in ihrer absteigenden Dreiklangfigur kaum wahrnehmbar: Ein solch übertriebenes Pianissimo ist nicht im Sinne Verdis, der von den Instrumenten einen leisen, aber sonoren Klang verlangt. Der Chor singt das erste „Requiem“ nicht, sondern murmelt es vor sich hin, so wie er in „Quantus tremor“ das Zittern vor dem Weltenrichter flüsternd skandiert. Die Piano-Abstufungen gestaltet er jedoch meisterlich, auch wenn ihm dann die süße Wendung zum „lux perpetua“ nicht so recht gelingen will. Das „Te decet“ setzt nicht nur einen entschiedenen Kontrast, sondern platzt heraus: Da wäre weniger mehr gewesen. Zum „Dies irae“ bringt sich Currentzis in Stellung, aber er verzichtet tatsächlich auf Effekthascherei, schafft es stattdessen, den Sinn des Textes ausdeuten zu lassen, schafft es auch, „teste David cum Sibylla“ entspannt zurückzunehmen, damit sich die Kräfte der Dynamik wieder ballen und erneut losbrechen können.

Teodor Currentzis mit seinen Solisten. (Foto: Holger Jacoby)
Die Auswahl der Solisten hängt wohl mit dem ursprünglich geplanten „Tristan“ zusammen: Weder Andreas Schager – einer der führenden Tristan-Sänger heutiger Tage –, noch der Liedsänger Matthias Goerne passen in Verdis vokales Profil. Und sie harmonieren nicht mit dem Sopran Zarina Abaeva und dem Mezzo Eve-Maud Hubeaux, was vor allem im nur leise harmonisch gestützten Quartett („fac eas de morte transire ad vitam“) durch zerrissenen Klang Schmerz bereitet. Andreas Schager müht sich bewundernswert darum, seine Soli textsinnig und klangschön zu gestalten, aber schon das „Kyrie“ ist nicht leuchtend, sondern nur laut. Ein schönes Legato fällt ihm schwer. Im „Ingemisco“ sucht er den bittenden Ton, aber die Stimme ist nicht geschmeidig genug, auch nicht, um das „Inter oves“ in seinem fast kindlichen Flehen in einen schwerelosen Klang zu kleiden. Zarina Abaeva erweist sich dagegen als stilgewandte Verdi-Sängerin, die sich nicht zu vibratosatter Tongewalt hinreißen lässt und die Höhe auch im Piano sicher ans Zentrum anzubinden weiß. Ihr „Libera me“ erfleht sie sich von der Chorempore herab; vielleicht bleibt seine innere Bewegung deshalb etwas blass.

Eve-Maud Hubeaux und Andreas Schager. Foto: Holger Jacoby)
Nichts bleibt ungesühnt
Bei Matthias Goerne spürt man die Qualität des Liedgestalters: Kaum einer singt das dreimalige „mors“ jedes Mal anders aufgeladen – erschüttert, bitter, resigniert; kaum einer gestaltet die rhythmische Feinheit des „Hostias“-Beginns so klug wie Goerne. Aber schon im Kyrie befremdet der gewohnte, weit hinten gebildete, kehlige Klang der Stimme, der sich zu gurgelnder Intensität steigert und einen sinistren Gegensatz zum schlank-samtigen Timbre von Eve-Maud Hubeaux aufbaut. Die Schweizer Mezzosopranistin – die Amneris der Salzburger Festspiele 2022 und Eboli der Wiener Staatsoper 2020 – ist kein breiter italienischer „Contralto“, sondern eine präsent artikulierende Sängerin mit einer definierten Emission, die nur im Wechsel in die Bruststimme („latet apparebit“) ihren ästhetischen Ton nicht mitnehmen kann.
Hubeaux singt in der mittelalterlichen „Dies irae“-Sequenz den einen Satz, der sich in der gebannten Stille nach dem Verklingen des letzten „Libera me“ (und eines prompt einsetzenden Handy-Gebimmels) aufdrängt: „Nil inultum remanebit“. Nichts bleibt – glaubt man denn an einen Gott und ein Weltgericht – ungesühnt. Dieser Satz sollte den Mächtigen in den Ohren gellen, die heute ihre Gewaltorgien in der Ukraine und in vielen Teilen der Welt toben lassen. Der gerechte Gott ist die Hoffnung der Opfer. Das wäre das Statement dieses Requiems.