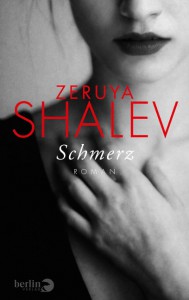Der Schmerz nach dem Terror hört niemals auf – Zeruya Shalevs erschütternder neuer Roman
Iris steht als Schulleiterin mit beiden Beinen im Leben. Sie ist eine selbstbewusste Frau, hat zwei Kinder großgezogen, und in einer eher freudlosen Ehe erträgt sie die Macken und Marotten ihres Ehemanns mit stoischem Gleichmut.
Doch hinter der Fassade lauern lange verdrängte Verletzungen und kaum erträgliche Schmerzen, deren Ursachen weit in der Vergangenheit liegen: Vor 30 Jahren, da war Iris fast noch ein Kind, hat Eitan, ihre erste große Liebe, sie von einem auf den anderen Tag verlassen. Und vor 10 Jahren wurde Iris Opfer einer Terror-Attacke, als ein Selbstmord-Attentäter sich mitten in Jerusalem in die Luft sprengte.
Nur knapp hat Iris dieses fürchterliche Inferno aus abgetrennten Gliedmaßen und Blutlachen überlebt. Bis heute wird sie, wenn sie sich die grausamen Bilder in Erinnerung ruft, von ebenso realen wie eingebildeten Schmerzen heimgesucht. Als, auf der Suche nach Linderung ihrer Pein, in einer Klinik ausgerechnet Eitan ihr behandelnder Arzt wird, gerät Iris in einen Strudel aus Leidenschaft und Lüge, erotischer Spannung und Liebes-Verrat. Doch kann das Wunder der wieder gefundenen Liebe sie wirklich heilen?
In den Romanen der israelische Autorin Zeruya Shalev geht es immer um die Liebe, die selten zum Glück führt, sondern meistens eine Art Leidensweg darstellt: Überall emotionale Abhängigkeiten, vergiftetet Beziehungen, scheiternde Ehen. Das ist auch in dem neuen Roman „Schmerz“ nicht anders.
Neu ist, dass Shalev diesmal sich selbst und ihre eigenen Erlebnisse in den Roman mit einbezieht. Denn die Autorin, die mit „Liebesleben“, „Mann und Frau“, „Späte Familie“ zu einer der bedeutendsten Erzählerinnen der Gegenwart wurde, ist vor einigen Jahren selbst in Jerusalem Opfer eines terroristischen Anschlags geworden und überlebte das Blutbad schwer verletzt. Sie weiß also nur zu genau, was Iris, ihre Hauptfigur, durchgemacht hat und von welchen körperlichen und seelischen Schmerzen sie seitdem gepeinigt wird. Sicherlich ein Grund dafür, warum das Buch noch bedrückender und verzehrender ist als ihre bssherigen Romane.
Erzählt wird die komplexe Geschichte in einer atemlos wirkenden Gleichzeitigkeit der Ereignisse und Gedanken. Beschreibungen und Reflexionen werden eng miteinander verknüpft, endlose Satzfolgen aufgetürmt und übereinander geschichtet. Und vielleicht würde Iris ohne ihre Tochter Alma nie wieder hinausfinden aus diesem Labyrinth aus Terror-Trauma und Liebes-Sehnsucht, radikalem Schmerz und erotischer Grenzerfahrung.
Alma, von Schuldgefühlen und Identitätsproblemen heimgesucht, verfällt den Verlockungen eines Sektenführers und lässt sich als Sex-Sklavin ausbeuten. Wenn Iris ihreTochter retten will, muss sie erst mit sich selbst ins Reine kommen. Das tut weh und ist auch für den Leser nur schwer zu ertragen.
Um den Tod zu überwinden und das Leben zu feiern, hat Zeruya Shalev nach dem Terroranschlag ein kleines Kind adoptiert -und diesen Roman verfasst. Hoffentlich hat das ihren Schmerz ein wenig lindern können.
Zeruya Shalev: „Schmerz“. Roman. Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler. Berlin Verlag. 383 Seiten, 24 Euro.