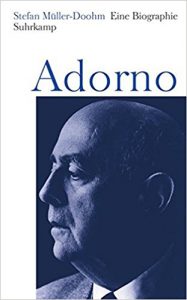Nachdenken über Städtebau, Rechtsradikalismus und die autoritäre Persönlichkeit – Vorträge von Theodor W. Adorno
Also schrieb Botho Strauß in seinem 1981 erschienenen Buch „Paare Passanten“ über Theodor W. Adorno, anlässlich einer Lektüre der „Minima Moralia“: „Wie gewissenhaft und prunkend gedacht wurde, noch zu meiner Zeit! Es ist, als seien seither mehrere Generationen vergangen.“ Tatsächlich sind inzwischen etliche weitere Jahre vorübergezogen, seit Adorno, der Mitbegründer der „Frankfurter Schule“, seine Wirksamkeit vollends entfaltete. Doch eine Wiederbegegnung lohnt sich immer noch und allemal.
 Jetzt sind gesammelte „Vorträge 1949-1968″ Adornos im Rahmen der Nachgelassenen Schriften bei Suhrkamp erschienen – wissenschaftlich sorgsam eingeordnet in die „Abteilung V – Vorträge und Gespräche, Band 1″.
Jetzt sind gesammelte „Vorträge 1949-1968″ Adornos im Rahmen der Nachgelassenen Schriften bei Suhrkamp erschienen – wissenschaftlich sorgsam eingeordnet in die „Abteilung V – Vorträge und Gespräche, Band 1″.
Doch man muss hier keine Angst vor knochentrockenem Dozieren haben. Gewiss, Adorno (1903-1969) bewegt sich stets auf beachtlichen theoretischen Höhen, doch hat er gerade in seinen öffentlichen Vorträgen auch spürbar versucht, auf sein jeweiliges Publikum einzugehen, zuweilen gar geradezu unterhaltsam an dessen Verstand zu appellieren. Selbst beim wahrlich ernsthaften Vortrag über Rechtsradikalismus verzeichnet die Niederschrift einige Lacher im Publikum. Es war das Gelächter der Erkenntnis.
Was die Schönheit einer Stadt ausmacht
Das Themenspektrum der 20 Vorträge ist vielfältig und größtenteils von bleibender Relevanz. Es reicht von überaus differenzierten (wenn auch heute nicht mehr in allen Punkten nachvollziehbaren) musiktheoretischen Erwägungen und allgemeinen soziologischen Analysen („Die menschliche Gesellschaft heute“, 1957) über Fragen des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg („Städtebau und Gesellschaftsordnung“, 1949) bis hin zu einer nach wie vor aufschlussreichen Betrachtung über „Aspekte des neuen Rechtsradikalismus“ aus dem Jahre 1967, als die NPD aufkam. Apropos: Historische Differenzen und Details werden in einem umfangreichen Anmerkungs-Apparat am Ende des Bandes erschlossen.
Gehen wir – anhand von drei prägnanten Beispielen – chronologisch vor. 1949, als weite Teile Deutschlands noch in Kriegstrümmern lagen, empfahl Adorno einen demokratischen Wiederaufbau, an dem möglichst auch die Bürger beteiligt werden sollten – damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit, heute zumindest formal vielfach üblich. Die „Schönheit“ von Städten als Mischung aus organisch und historisch Gewachsenem ist für Adorno nicht so sehr eine rein ästhetische Frage, sondern vielmehr eine soziologische: Sie habe sich phasenweise ergeben, wenn die Interessen der einzelnen Bewohner mit denen des Gemeinwesens übereinstimmten.
Im Geiste der Moderne
Diese Zeiten, in denen Wohnen und Arbeiten noch nicht räumlich getrennt waren, sind allerdings 1949 längst Geschichte. Und so rät Adorno denn auch zum Wiederaufbau im Geiste der Moderne, keineswegs zur Wiedererrichtung historischer Altstädte, deren gesellschaftliche Grundlagen entfallen seien. Ein Wiederaufbau des alten Nürnberg, so sein Beispiel, würde nur auf eine Spielzeug-Variante der Historie hinauslaufen. Ein entschiedener „Gegenschlag“ zum Gewesenen würde hingegen verbliebende Traditionen erst recht zur Geltung bringen.
Immer noch hochinteressant und in so manchen Punkten weiterhin gültig ist auch Adornos Vortrag über „Die autoritäre Persönlichkeit“ (1960). Auf der Grundlage langjähriger Untersuchungen arbeitet er abermals einige Kernpunkte seiner Thesen heraus. Die autoritätshörige Persönlichkeitsstruktur ist nach seiner Ansicht die Basis aggressiv-nationalistischen Unwesens. Der weit verbreitete Typus lasse lebendige Erfahrungen, die ihn verunsichern könnten, gar nicht mehr an sich heran. Also verhärteten sich seine irrationalen Vorurteile zusehends. Auch wenn heute andere Sozialtypen vorherrschen mögen, so erkennt man doch einige Züge dieser charakterlichen Prägung heute wieder, vielleicht sogar im wachsendem Maße – so etwa auch im „finsteren und brütenden Einverständnis“, das derlei Gruppierungen kennzeichne. Muss man da noch eigens Ross und Reiter unserer Tage nennen?
„Technik der plumpen Lüge“
Womit man beinahe bruchlos zum Thema Rechtsradikalismus überleiten kann. In seinem Vortrag von 1967, kurz vor dem Scheitelpunkt der bundesdeutschen Studentenrevolte, registriert Adorno, welche Teile und Regionen der Gesellschaft noch oder schon wieder für rechtsradikale Ideologien anfällig seien. Adorno befindet, dass diese Ideologie kein zusammenhängendes Theorie-Konstrukt ausgeformt hat, sondern weit überwiegend nur aus Propaganda und Machttechnik bestehe.
Unter dem Eindruck einer seinerzeit erstarkten NPD gerät das Phänomen in den Blick, dass von rechts (z. B. seinerzeit in der National-Zeitung) ganz bewusst an den Grenzen des „Sagbaren“ operiert wurde. Kommt einem nicht auch das neuerdings wieder bekannt vor? Auch geht es um systematische Fake-Behauptungen, die Adorno damals natürlich noch nicht so genannt hat. Er sprach von „solchen völlig irren und phantastischen Geschichten“ sowie von der „Technik der plumpen Lüge“. Oh, schreckliche Wiederholung!
Wahrheit im Dienste der Unwahrheit
Weiteres Zitat, bezogen auf rechtes Imponiergehabe: „Es wird mit Kenntnissen geprotzt, die sich schwer kontrollieren lassen, die aber eben um ihrer (Un)kontrollierbarkeit willen dem, der sie vorbringt, eine besondere Art von Autorität verleihen.“ Von Adorno erfundenes, aber triftiges Beispiel einer infamen Lüge aus rechten Kreisen: „Was? Das weiß doch jedes Kind! Und Sie wissen nicht, daß seinerzeit der Rabbiner Nussbaum gefordert hat, daß alle Deutschen kastriert werden sollen?“
Bemerkenswert auch Adornos fein unterscheidende Sicht auf den Umgang mit der Wahrheit: „Ich möchte (…) darauf hinweisen, daß keineswegs alle Elemente dieser Ideologie einfach unwahr sind, sondern daß auch das Wahre in den Dienst einer unwahren Ideologie (…) tritt…“ Dieser Umstand müsse bei der Gegenwahr berücksichtigt werden.
Überhaupt erwägt Adorno am Rande auch taugliche Abwehrstrategien gegen rechte Umtriebe. So solle man nicht moralisieren, sondern jenen Leuten, die noch erreichbar sind, deren eigene und eigentliche Interessenlage ganz klar vor Augen halten und die Tricks ihrer Anführer entlarven. Ob es (noch) hilft?
Theodor W. Adorno: „Vorträge 1949-1968″ (Hrsg.: Michael Schwarz / Theodor W. Adorno Archiv). Im Rahmen der Ausgabe „Theodor W. Adorno Nachgelassene Schriften, Abteilung V: Vorträge und Gespräche, Band 1″. Suhrkamp, 786 Seiten, 58 Euro.