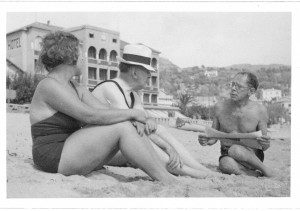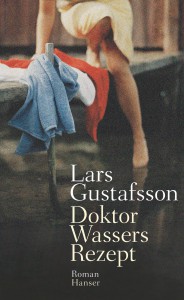Heillose Heilanstalt: Heinz Strunks Roman „Zauberberg 2″
Welch ein tollkühnes Unterfangen, schon mit dem Romantitel und sodann mit der Handlung in einen Vergleich mit Thomas Mann einzutreten! Mit „Zauberberg 2″ nimmt Heinz Strunk wie selbstverständlich Bezug auf Manns großen, just vor 100 Jahren erschienenen Roman „Der Zauberberg“, der bekanntlich hauptsächlich in einem Sanatorium zu Davos spielte und wortmächtig aus einem gewaltigen Gedanken- und Bildervorrat schöpfte.
Strunks Protagonist namens Jonas Heidbrink macht sich hingegen mit dem eigenen Fahrzeug in den abgelegenen und untervölkerten deutschen Nordosten auf. Der Aufenthalt in der Heilanstalt, in die er sich begibt, kostet pro Nacht exorbitante 823 Euro. Selbstzahler sind gern gesehen. Heidbrink, der sich ein Start-up mit Hightech-Idee hat abkaufen lassen, verfügt fraglos über das Geld, ist aber seelisch ein armer Tropf, schon längst zu Tode betrübt. So drastisch erinnert er sich bei Strunk an seine Jugendjahre: „Bei jeder Gelegenheit hatte Heidbrink seine Verzweiflung wegzuonanieren versucht – seine Wichsdichte war wirklich schwindelerregend hoch gewesen. Not in Wichse verwandeln.“ Das ist fürwahr ein anderer Sound als bei Thomas Mann, der in seinen Tagebüchern höchstens verdruckst eine „Niederlage“ eingestand, wenn es ihn über-mannt hatte.
„Böser Blick“ und Lachnummern
Heinz Strunk erweist sich erneut als Meister der wirksamen, zuweilen fuchsfrechen Zuspitzung, der seine Figuren mit „bösem Blick“ betrachtet und zu Karikaturen ihrer selbst gerinnen lässt. Ärzte, Psychiater, Psychologen und sonstige Therapie-Fachkräfte geraten so reihenweise zu Lachnummern, diverse Maßnahmen (Musiktherapie, Kunsttherapie, Fototherapie, Biblio-Therapie, Tanz und Bewegung et cetera pp.) erscheinen als ebenso sterbenslangweilige wie groteske Zusammenkünfte, unterfüttert mit schwer erträglichem Psycho-Kauderwelsch. Die „Kulturabende“ des nur äußerlich noblen, schlossartigen Hauses sind unterdessen gottserbärmlicher Schmock. Nicht nur bestens vorstellbar, sondern höchst wahrscheinlich, dass derlei Befunde in vielen Punkten der traurigen Wirklichkeit entsprechen.
Zu allem Überfluss teilt man Heidbrink auch noch – gleich nach der Aufnahme – Verdachtsmomente für ein Melanom (Hautkrebs) und einen Nierentumor mit. Eine Folge: Ständig werden uns fortan seine „Vitaldaten“ (Laborwerte) mitgeteilt. Wie sehr wir um ihn bangen, sei dahingestellt. Nicht, dass auch wir in der Lektüre noch dem bösen Blick verfallen sind… Oder verbirgt sich hinter all der Spottlust doch heimliche, sozusagen verschämte Empathie?
Quälende Schweiger und Schwätzer
Lauter desolate Existenzen fristen in der Klinik ihr Leben – bei langsamst dahinkriechender Zeit; Tag um Tag, Monat für Monat, ohne wesentliche Veränderungen. Wir begegnen gleichermaßen quälenden Schweigern und Schwätzern am abendlichen Esstisch. Da ist etwa ein heilloser, reichlich prolliger Säufer namens Klaus oder jener Pseudo-Philosoph Zeissner, der so manche Suada absondert. Dazu die zerbrechliche, durchaus vorgestrige Fabrikerbin Margot oder eine seltsam unzertrennliche Zweiheit: Eddy und Pia, denen gleichfalls auf Erden nicht zu helfen ist. Wer daran Vergnügen findet, mag die Bezüge zu Thomas Manns Figureninventar herstellen. Demnächst werden sich Doktorierende damit befassen.
Diese Beschreibung der Klinik mutet schließlich an wie die generelle Bestandsaufnahme einer miserablen Welt: „Übrig bleibt ein Haufen Irrer und Bedürftiger, Verbrauchter und Versehrter, Belämmerter und Benommener, Hinkender und Humpelnder.“
Welch ein Jahrhundert-Abstand zu Thomas Mann!
Heinz Strunk gelingen rasante und prägnante Charakterisierungen zwischen Gelächter und Depression. Unterhaltsamkeit kann man diesem Schriftsteller (einst Musiker und Comedian) gewiss nicht absprechen, sein Roman liest sich weg wie sonst was. Aber sind es nicht manchmal doch etwas herabgedimmte Thomas-Mann-Anklänge, die er uns auftischt? Andererseits: Soll er denn den ichzentrierten Großbürger Thomas Mann nachahmen oder paraphrasieren? Das geht ja nun auch nicht. Auf sprachlichen Höhen (und in Untiefen) bewegt sich Strunk mitunter gleichfalls, wenn auch nicht in Sphären des Altvorderen.
Der vierte und letzte Teil des Romans handelt vom Verfall der Klinik, deren Schließung so unvermeidlich ist wie das finale Schicksal von Jonas Heidkamp. Ins Kapitel „Kirgisenträume“ fließen etliche Originalzitate aus Thomas Manns „Zauberberg“-Roman ein, die man sogleich am hohen Ton erkennt und die im Anhang penibel aufgeführt werden. Welch ein Abstand zu jenen Zeiten und jener Sprache! Wahrlich ein ganzes Jahrhundert, in dem sich die Gattung jedoch gar nicht so sehr verändert hat.
Heinz Strunk: „Zauberberg 2″. Roman. Rowohlt Verlag. 288 Seiten, 25 Euro.