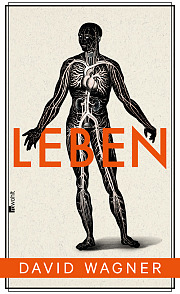Aufrüttelnde TV-Doku: Organhandel zwischen Kriminalität und Lebensrettung
Manila, Philippinen. Ein Mann in den Slums ist bereit, sich für 2500 Dollar eine seiner beiden Nieren entfernen zu lassen, um sie für eine Transplantation zu spenden.
Für das Geld müsste er zwei Jahre lang als Hilfsarbeiter schuften. Kann man bei all dem von „Freiwilligkeit“ reden? Haben diese Menschen wirklich eine Wahl? Oder erleiden sie die schamlose Ausbeutung einer Zwangslage, an der skrupellose Händler und Ärzte noch viel mehr verdienen?
Keine einfachen Antworten
Ric Esther Bienstocks kanadische Doku über den „Schwarzmarkt Organhandel“ (arte) gab sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden. Auf allen Seiten wurde gewissenhaft recherchiert, so gut es eben ging. Die geduldige Langzeitbeobachtung ließ manch eine Schattierung des Themas erkennen und ließ Fragen offen: Ist es nicht allemal besser, Leben zu retten; koste es, was es wolle? Zumal, wenn man erfährt, unter welchen Bedingungen schwerkranke Dialyse-Patienten auf ein Spenderorgan warten. Die Wartelisten sind deprimierend lang…

Bereit, eine Niere zu verkaufen: Familienvater „Eddieboy“ aus Manila. (© arte/Associated Producers Ltd.)
Der aufwendige, aber wohltuend unspektakuläre Film begab sich auf globale Spurensuche, u. a. zwischen Toronto, Denver, Tel Aviv, Istanbul, Pristina (Kosovo), Moldawien und den Philippinen. Dort zeigten reihenweise Männer ihre Operationswunden und erzählten freimütig, was sie mit dem Geld für die Nierenspende angefangen haben: Familie ernährt, kleines Haus gebaut, Ausbildung der Kinder bezahlt oder auch Saufschulden beglichen. Eine Frage des Überlebens. Eine Frage der Würde. Kleines Glück, Schande und Angst liegen bestürzend nah beieinander. Und was geschieht, wenn das Geld aufgebraucht ist? Werden dann etwa andere Organe angeboten?
Irrsinnige Tarife
Irrsinnig die Tarife des illegalen Organhandels: In Indien erhält ein Spender umgerechnet gerade mal rund 1000 Dollar für eine Niere, in Ägypten etwa 2000, in der Türkei 10000. Ein US-amerikanischer Empfänger muss derweil eine Hypothek aufnehmen und über 100.000 Dollar für Spende und OP bezahlen.
Wer verdient an dieser immensen Spanne? Schemenhaft ließ die Reportage ein Netz der Zwischenhändler, Organisatoren und Chirurgen ahnen, die ihr lukratives Tun zu verschleiern und zu beschönigen suchen. Dennoch wurden die Letzteren nicht schlichtweg als Abkömmlinge des „Dr. Frankenstein“ verteufelt, wie vorher so oft und wohlfeil in manchen Medien geschehen.
Alles legalisieren?
Der gut situierte Arzt Yusuf Sonmez in Istanbul, nach gut 850 mutmaßlich illegalen Operationen mit internationalem Haftbefehl gesucht, kann es sich offenbar leisten, sich lachend in den bestens gepolsterten Ruhestand zurückzuziehen. Man möchte am liebsten dreinschlagen, wenn man sein selbstgefälliges Grinsen sieht. Und dennoch: Hat er nicht das Leben von Menschen gerettet, die sonst gestorben wären? „Ich bin mit mir im Reinen“, behauptet er. Die Türkei sollte er allerdings nicht mehr verlassen, sonst droht ihm Gefängnis.
Man könnte solchen Leuten das Handwerk legen: Es erhob sich die durchaus ernsthafte Frage, ob sich Organhandel nicht legalisieren, also staatlich regeln und somit beleben ließe. Bis es so weit ist, muss allerdings noch manche medizinische Ethik-Kommission beraten, von politischen Entscheidungen ganz zu schweigen. Die Dringlichkeit führte ein Schriftband am Schluss vor Augen: „Während Sie diesen Film gesehen haben, sind 118 Menschen an Nierenversagen gestorben.“