Fakir Baykurt – sozialkritischer Poet des türkischen Dorflebens und langjähriger Revier-Bürger
Gastautor Heinrich Peuckmann erinnert an den türkisch-deutschen Autor Fakir Baykurt, der auch viele Jahre im Ruhrgebiet gelebt hat:
In Deutschland einem Schriftsteller zu unterstellen, dass er ein sozialkritischer Dorfautor wäre, käme einer literarischen Vernichtung gleich. Als provinziell, gar hinterwäldlerisch würde man ihn einordnen und die Unterstellung, dass er einem rührseligen Heimatbegriff folgt, läge nicht fern.
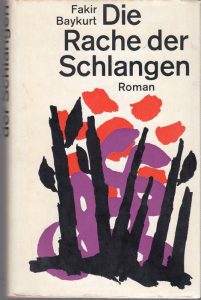
Fakir Baykurts Roman „Die Rache der Schlangen“ in einer Ausgabe des Verlags Horst Erdmann (Herrenalb), erschienen 1964.
In der überwiegend ländlich strukturierten Türkei war und ist das anders. Fakir Baykurt, 1929 in einem Dorf namens Akcaköy geboren und 1999, vor fast 20 Jahren, in Essen gestorben, gilt neben dem inzwischen ebenfalls verstorbenen Nobelpreiskandidaten Yasar Kemal („Mehmet, mein Falke“) als der große sozialkritische Dorfautor der türkischen Gegenwartsliteratur.
Bergkamen, Duisburg und Essen
1979, als schon bekannter Autor mit gut zwanzig veröffentlichten Romanen, siedelte er nach Deutschland über und wohnte eine Zeitlang auch in Bergkamen, ganz in meiner Nähe. Zur Bergkamener Kulturverwaltung fand er schnell Kontakt und auf diesem Wege lernte auch ich Fakir Baykurt kennen. Während der achtziger Jahre habe ich oft mit ihm zusammengearbeitet, auch noch, als er längst in Duisburg wohnte.
Baykurt stammte aus einer armen Bauernfamilie. Sein Vater starb früh, seine Mutter brachte mit erzieherischer Strenge, aber mit noch mehr Herzlichkeit ihre sechs kleinen Kinder (zwei weitere starben früh) durch.
Nach dem Militärputsch von 1971 verhaftet
So arm die Familie auch war, seine Mutter schaffte es trotzdem, ihren wissbegierigen Sohn Fakir studieren zu lassen. An einem Lehrerinstitut machte er seine Ausbildung und lernte reformpädagogische Ansätze kennen, die er ab 1949 in dörflichen Schulen umsetzte. Natürlich gab es angesichts der traditionell denkenden Bauern die zu erwartenden Probleme. Später schloss er ein weitergehendes Studium an, das ihn sogar an die amerikanische Universität in Bloomington führte.
Gymnasiallehrer ist er geworden, schnell auch Vorsitzender der türkischen Lehrergewerkschaft. Nach dem Militärputsch 1971 wurde auch Baykurt wie viele Künstler, Intellektuelle und vor allem Gewerkschafter verhaftet und eingesperrt. Baykurt berichtet darüber in seiner Erzählung „Die Jahre mit meiner Mutter“ und schildert darin den Besuch seiner Mutter im Gefangenenlager. Vor allem entwickelt er geradezu genüsslich, wie sie sich durch entschiedenes Auftreten bei den Wachen Respekt verschaffte, um ihren Sohn zu sehen und unbelauscht mit ihm sprechen zu können.
Inzwischen hat die gegenwärtige Türkei bei der Verfolgung von Schriftstellern und Journalisten wieder einen unrühmlichen Spitzenplatz erlangt.
Die Mutter lies sich seine Texte vorlesen – und war voll des Lobes
Baykurt war zur Zeit seiner Verfolgung bereits ein bekannter Autor. Regelmäßig veröffentlichte er Romane, die das Landleben in der Türkei darstellen, das er durch seine Herkunft so gut kannte. Seine kritischen Texte brachten ihm den Ruf ein, Kommunist zu sein, was wiederum seine Mutter erschreckte. Sie selbst konnte nicht lesen, deshalb ließ sie sich den Roman „Die Rache der Schlangen“ von Fakir bei einem seiner Besuche zu Hause vorlesen. Noch während Fakir las, unterbrach sie ihn wütend. „Was soll daran kommunistisch sein? So ist es doch in unseren Dörfern, genauso! Du hast nur geschrieben, was hier passiert.“ Ihrem Sohn Fakir hat dieses Lob besonders gut getan.
Von nun an verteidigte die Mutter ihn, wenn Nachbarn oder Verwandte meckerten: „Dein Sohn konnte wieder nicht den Mund halten.“ Im Gegenteil, danach gewann sie, die einfache Frau vom Lande, erst recht Interesse an Fakirs Romanen. Im Dorfladen, in dem sie immer einkaufte, wurde sie von jungen Mädchen, die zur Mittelschule gingen, bedient. Von denen ließ sie sich den Roman „Die Sense“ vorlesen, stolz darauf, was ihr kleiner Fakir erreicht hatte. Mit der Zeit wuchs dessen Ansehen auch unter den anderen Dorfbewohnern, bis er schließlich zu den bekanntesten türkischen Autoren gehörte und die Kritik an ihm verstummte.
Das Problem mit den schlechten Übersetzungen
Warum er nach Deutschland auswanderte, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, er folgte einem seiner Kinder. Baykurt war ein kommunikativer Mann, der schnell Anschluss gewann. Das war schon in Bergkamen so, das war in Duisburg, wo er ebenfalls als Lehrer arbeitete, sich aber vor allem mit den Problemen türkischer Migranten beschäftigte, nicht anders. Auch eine deutsch-türkische Autorengruppe gründete er in Duisburg, um den türkischen Kollegen Hilfe auf dem deutschen Literaturmarkt zu geben. Nach seinem Tod 1999 bekam diese Autorengruppe seinen Namen. Baykurt selbst hatte nicht unbedingt Hilfe nötig, dazu war er viel zu bekannt, aber den einen oder anderen Hinweis konnte er doch gut gebrauchen.
In dieser Zeit habe ich, wenn ich eine Anthologie mit Erzählungen herausgab, immer dafür gesorgt, dass Fakir Baykurt, wenn es nur eben thematisch passte, darin vertreten war. Seine Erzählungen waren ein schönes Zeichn für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen deutschen und türkischen Autoren und darüber hinaus für gelingendes Zusammenleben überhaupt.
Es gab nur jedes Mal ein großes Problem, denn Fakir hatte für seine neuen Erzählungen Übersetzer, die selbst der deutschen Sprache nur bedingt mächtig waren. So bekam ich von ihm Texte zugeschickt, bei denen ich mir beim ersten Lesen stets die Haare raufte. Es waren thematisch immer gute, spannende, auch humorvolle Geschichten, so viel sah ich sofort, aber was die einzelnen Sätze bedeuten sollten, erschloss sich mir bestenfalls nach mehrfachem Lesen. Und auch dann nicht immer.
Von der Frau, die unbedingt einen Garten haben wollte
Also setzte ich mich hin und übertrug seine Sätze so, wie ich glaubte, dass sie gemeint waren. Dann schickte ich die korrigierte Geschichte an Fakir zurück und bat ihn zu prüfen, ob ich alles richtig verstanden hätte. Von Fakir kam dann stets ein Dankschreiben zurück mit der Frage, ob ich nicht sein Übersetzer werden wollte. Ja, unsere Zusammenarbeit in jener Zeit hatte auch ihre komischen Seiten.
Die gemeinsame Arbeit war aber auch anregend, denn sie half mir, die türkische Mentalität der Migranten in meinem Umfeld besser zu verstehen. In einer Geschichte zum Beispiel erzählt Fakir von einer türkischen Frau in Oberhausen, die so gerne einen Garten gehabt hätte, weil sie sich ein Leben ohne das Wühlen in der Erde nicht vorstellen konnte. Aber ihr wenig durchsetzungsfähiger Mann schaffte es nicht, ihr einen Garten im Kleingärtnerverein zu besorgen.
Also griff die Frau zur Selbsthilfe, räumte ein Zimmer ihrer Wohnung leer (das Sonnenzimmer), füllte Kisten mit Erde und begann, dort Gemüse zu ziehen: Steckrüben, Gurken, Knoblauch. Sie war in ihrem Zimmer erfolgreicher als andere türkische Frauen in ihren Gärten…
Bis eines Tages die Polizei vor der Tür stand. Der Mieter in der Wohnung darunter hatte sich darüber beschwert, dass seiner Familie laufend Wasser auf den Kopf tropfte. Das Gemüse musste ja regelmäßig gegossen werden, die Kisten weichten durch oder es lief etwas daneben. Sie mussten also verschwinden. Aber jetzt wurde die Leidenschaft der armen Frau auch im Umfeld bekannt. Viele, auch ein Pfarrer, mischten sich ein, bis die begnadete Gärtnerin endlich ihren Garten in der Brache an der Autobahn erhielt. Eine humorvolle Geschichte, prall gefüllt mit Leben – wie alle Texte von Fakir Baykurt. Er ist ein Autor, der bei uns unbedingt wiederentdeckt werden müsste.


