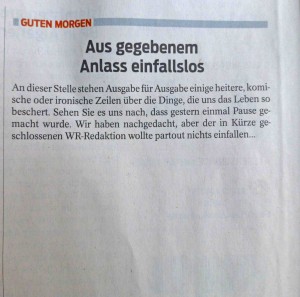Im Zeichen des Mammuts – Dortmunds Naturmuseum nach sechs Jahren endlich wieder geöffnet

Museumsdirektorin Dr. Dr. Elke Möllmann und Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau halten dem Wahrzeichen des Naturmuseums (aus vielen Originalteilchen zusammengesetztes Skelett einer Mammut-Kuh) ihre Schutzmasken vor. Sierau ließ es sich nicht nehmen, den hindernisreichen Umbau des Hauses als „Mammut-Aufgabe“ zu bezeichnen. (Foto: Bernd Berke)
Eine Stadt, die etwas auf sich hält, sollte beispielsweise mehrere Kunstmuseen haben, außerdem diverse Häuser zur (Kultur)-Geschichte – und möglichst ein naturkundliches Ausstellungs-Institut. In diesem Sinne rückt Dortmund jetzt beim Image-Wettbewerb der Kommunen endlich wieder in eine der vorderen Reihen auf: Nach schier unglaublichen sechs Jahren Umbauzeit (nur zwei hätten es sein sollen) eröffnet das Naturmuseum wieder, in gründlich veränderter Gestalt und deutlich attraktiver als ehedem.
Eigentlich ist – neben dem althergebrachten Stadtwappen-Adler – das Nashorn (Maskottchen des Konzerthauses) zum Dortmunder Werbetier avanciert, doch nun bekommt der Dickhäuter ebenso schwergewichtige Konkurrenz von einer Mammut-Dame. In mühseliger Kleinstarbeit hat man ihr Skelett fürs Museum zusammengesetzt, aus zahllosen originalen Einzelteilen, die (gleichsam als „Beifang“) auf dem Gebiet der heutigen Nordsee gefunden wurden. Vor rund 30.000 Jahren war dort noch trockenes Land. Schon angesichts eines solchen Zeitmaßes erscheint die sechsjährige Umbauzeit seit 2014 denn doch als (allerdings kostspielige) Petitesse. Und es geht ja museal noch viel weiter zurück: von den Eiszeiten (Quartär – hierhin gehört das Mammut) über das Zeitalter der Saurier (Kreidezeit) bis in die Frühzeit der Kohle-Entstehung (Karbon).
Ach ja, übrigens: Nähere Einzelheiten zur Genese des bundesweit beispiellosen Dortmunder Mammuts finden sich hier. Und noch viel, viel mehr steht im „Mammutbuch“, das von den Freunden und Förderern des Naturmuseums neu herausgebracht wurde.
„(Bitte nicht) am Dino packen!“
Das zweite spektakuläre Hauptstück des Hauses ist nicht original, sondern ein nachempfundenes Dinosaurier-Modell. Die Dortmunder kennen das mächtige Wesen noch aus dem alten Naturkundemuseum, wie es vormals geheißen hat. Dortmund Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) sagte heute zur Eröffnung, er sei in den letzten Jahren vielfach darauf angesprochen worden, wann denn der Dino (und all die anderen Exponate) wieder zu sehen sein würden. Er musste die Menschen wieder und wieder vertrösten. Heute aber rief er launig und spontan in Ruhri-Diktion aus: „Jetzt kann man wieder am Dino packen!“ Da freilich musste er sich von den Museumsleuten höflich korrigieren lassen. Nicht nur, aber derzeit vor allem „wegen Corona“ dürfen etliche Objekte und Mitmach-Stationen noch nicht so berührt werden, wie man es sich gewünscht hätte.
Viele Kalamitäten beim Umbau – nur kein Vulkanausbruch
Museumsdirektorin Dr. Dr. Elke Möllmann skizzierte kurz die schier endlose Abfolge von Pech und Pannen in der Umbauzeit. Mal ging eine Baufirma pleite, mal gab’s keinen Strom, kein Internet, keine Heizung oder kein Wasser, dann wieder hatte man eine Überschwemmung. „Nur einen Vulkanausbruch – den hatten wir nicht…“
Die Museumschefin erläuterte das veränderte Konzept: Während das Museum früher die wissenschaftliche Systematik in Biologie und Geologie nüchtern abgearbeitet habe, sei der Rundgang heute im Wesentlichen regionalspezifisch und möglichst sinnlich arrangiert. Man setzt also konsequent in der Lebenswelt Dortmunds und des Umlandes an, ganz konkret zum Beispiel bei den Dortmunder Großgrünflächen Westfalenpark, Rombergpark, Hauptfriedhof und Fredenbaum. Diese Parklandschaften und andere Lebensräume sind (unter dem Obertitel „Stadt – Land – Fluss“) Ausgangspunkte naturgeschichtlicher Erkundungen und Erzählungen, die sich immer mehr verzweigen.
Die Vielfalt reicht bis in Alltagsfragen hinein, beispielsweise: Was muss ich bei der Haltung eines Meerschweinchens beachten? Andererseits rührt man natürlich auch an die großen Fragen der Entstehung des Lebens und der Ökologie. Wollte man hier all die vielen Schubladen mit pointiertem Zusatzwissen aufziehen und die Tafeln lesen, so hätte man sehr reichlich zu tun. Besser wär’s, man käme mehrmals wieder.
Vermittlung durch Vitrinen bleibt eher die Ausnahme
Ja, es gibt auch einige Vitrinen (etwa mit präparierten Vögeln oder Eichhörnchen und dergleichen Getier), doch derlei traditionelle Vermittlung ist eher die Ausnahme, auch wirkt das Inventar „lebendiger“, denn alles ist ungleich besser ausgeleuchtet als früher in den notorisch schummrigen Museen. Wo immer es ging, hat man versucht, Informationen zeitgemäß mit anschaulichen Dioramen, Touchscreens, Videos oder Hörstationen aufzubereiten. In der Pflanzenabteilung darf man ausgewählte Düfte riechen, in einem großen Aquarium schwimmen heimische Fische. Auf der geologischen Etage, die einem vielleicht nicht gar so nah liegt wie die Tierwelt, werden Fossilien durch farbliche Gestaltungen und überraschende Zusammenhänge „zum Sprechen gebracht“. So liegen etwa die uralten Ammoniten nicht einfach nichtssagend herum, sondern sie werden buchstäblich ansprechend präsentiert. Zudem ergeben sich auf den verschiedenen Stockwerken immer wieder reizvolle Perspektiven, die auch dem ästhetischen Empfinden Genüge tun.
Auch eine Katze leistete ihren naturgemäßen Beitrag
Nicht nur die Museumsdirektorin und ihr Team haben seit 2014 einiges geleistet, selbst die Katze von Frau Dr. Dr. Möllmann war indirekt beteiligt. Sie hat Mäuse gefangen, deren filigrane Skelette sodann präpariert wurden und nun in einem speziellen Schaukasten zu sehen sind; selbstverständlich im wissenschaftlichen Kontext.
Gut denkbar, dass das Naturmuseum, wie zuvor das Naturkundemuseum, wieder zum besucherstärksten Haus in Dortmund wird (wenn man vom Deutschen Fußballmuseum einmal absieht). Nicht nur nebenher bedeutet es auch eine kulturelle Aufwertung der gelegentlich als problematisch verschrienen Dortmunder Nordstadt.
Naturmuseum Dortmund. Münsterstraße 271. Ab Dienstag, 8. September 2020, jeweils dienstags bis sonntags 10-17 Uhr (zu diesen Zeiten ist auch das neue Museumscafé „Ammonit“ geöffnet). Eintritt in die Dauerausstellung frei. Neu seit 22. September: tägliche Öffnungszeit um eine Stunde erweitert, also Di bis So 10-18 Uhr
Reservierung erforderlich: Tickets über www.naturmuseum-dortmund.de
Tel.: 0231 / 50-24 856. Mail: naturmuseum@stadtdo.de
Internet: www.naturmuseum.dortmund.de
_________________________
Einlass-Regelung/Reservierung
Es muss vorab online für jede Person (unabhängig vom Alter) eine Reservierung vorgenommen werden, und zwar auf dieser Seite:
www.naturmuseum-dortmund.de
Die Reservierungen sind jeweils auf ein bestimmtes Einlass-Zeitfenster begrenzt. Dies bedeutet, dass der Zugang zum Museum nur zu dieser Zeit gestattet wird. Durch die Limitierung der Reservierungen soll gewährleistet werden, dass die aktuell maximal zulässige Personenanzahl im Naturmuseum zu keinem Zeitpunkt überschritten wird.
Vorerst werden nur Reservierungs-Möglichkeiten für jeweils zwei Wochen online gestellt.