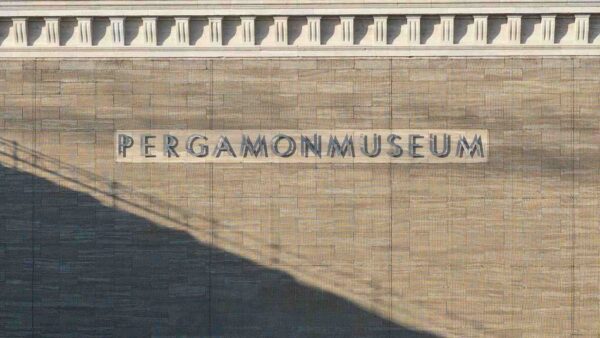Berliner Baustellen-Blues: Pergamonmuseum schließt für einige Jahre
Während draußen auf den Berliner Straßen die Nazis marschierten und Hitlers Machtergreifung herbei prügelten, suchte der junge Kommunist und angehende Schriftsteller Peter Weiss oft Zuflucht im damals neu erbauten Pergamonmuseum. Vor allem der Pergamonaltar hatte es ihm angetan. Immer wieder studierte er das gigantische Bauwerk aus dem 2. Jahrhundert vor Christi, das einst zur Residenz der mächtigen Könige von Pergamon gehörte und unter dubiosen Umständen in die deutsche Hauptstadt geschafft wurde.
Die auf dem Fries dargestellten Szenen vom ewigen Streit zwischen den Menschen und Göttern sowie die mühsam in den Stein gehauene künstlerische Kreativität waren für ihn Ausdruck der geschichtsbildenden Kraft des Klassenkampfes und der lichten Zukunft einer Freiheit, die ohne Kunst nicht auskommt. In seiner mehrbändigen „Ästhetik des Widerstands“ verwandelt er seine subjektiven Eindrücke in zeitlose Prosa.
Dass der Pergamonaltar schon seit acht Jahren verhüllt und Auftakt für eine Komplett-Sanierung des maroden Museums ist, hätte Peter Weiss sicherlich geschmerzt. Getröstet aber hätte ihn wohl der Gedanke, dass Modernisierung und Umbau des zwischen 1910 und 1930 auf der Museumsinsel errichteten Gebäudes sowie die Restaurierung der Kunstwerke bei laufendem Betrieb vonstatten gehen sollten und immer einzelne Bereiche des Hauses (in dem auch die Antiken-Sammlung, das Vorderasiatische Museum und das Museum für Islamische Kunst beheimatet sind) für das Publikum geöffnet bleiben sollten. Doch daraus wird nichts: Der schöne Plan ist Makulatur.
Überraschende Ankündigung
Überraschend verkündeten jetzt Hermann Parzinger (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) und Barbara Große-Rhode (Bundesamt für Bauwesen) bei einer Baustellenbegehung den verdatterten Pressevertretern die vollständige Schließung des Pergamonmuseums: Schon ab Oktober 2023 wird eine der weltweit bedeutendsten Kunstsammlungen, die jährlich eine Million Besucher anzieht, über Jahre nicht mehr zu sehen sein. Der Pergamonaltar, das Ischtartor, die Prozessionsstraße von Babylon, das Markttor von Milet, die Fassade des Wüstenschlosses von Mschatta: Diese Wunder der Menschheitsgeschichte verschwinden hinter geschlossenen Türen, während das von Kriegsschäden und Wassereinbrüchen stark in Mitleidenschaft gezogene, auf schwammigen Grund und rissigem Fundament stehende Museum mit neuester Technik ausgestattet wird. In zusätzlich geschaffenen An- und Neubauten sollen die umfassenden Sammlungen neu sortiert und besser sichtbar gemacht werden.
Kostenpunkt mindestens 1,2 Milliarden Euro
Das bisher hufeisenförmige Gebäude bekommt einen neuen Flügel und wird einen Rundgang durch die verschiedenen Museumsbereiche ermöglichen. Im Kellergeschoss soll es eine archäologische Promenade geben und eine Verbindung zu den anderen Häusern auf der Museumsinsel. Veranschlagt sind Gesamtkosten von 1,2 Milliarden Euro, hinzu kommt ein Risikopuffer von 300 Millionen Euro für mögliche Baupreissteigerungen. Ein schöner Batzen Geld in Zeiten klammer Kassen. Für Hermann Parzinger, der dem Haus einen „supermaroden Zustand“ attestiert, und für Barbara Große-Rhode, die das von der Spree umspülte Gebäude als „havarieanfällig“ einschätzt, ist das alles aber alternativlos: „Dieses Gebäude hat einen bestimmten Anspruch. Den müssen wir mit unseren Bauarbeiten erfüllen. Wir müssen dieses Gebäude seinem Wert angemessen zukunftsfest machen.“
Damit Sanierung und Restaurierung, Um- und Neubau nicht in Gänze unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, haben die Chef-Planer ein paar Trostpflaster im Angebot. Der erste Bauabschnitt im Nordflügel, in dem sich auch der Hellenistische und der Pergamonsaal befinden, soll im Jahr 2027 wieder für Besucher geöffnet werden. Der Südflügel aber bleibt bis 2037 geschlossen: das Ischtartor und andere Wunderwerke bleiben also fast 15 Jahre lang für alle Kunst-beflissenen Augen unsichtbar.
Enttäuschung für Kultur-Touristen aus aller Welt
Doch nein, halt! Barbara Helwing, Direktorin des Vorderasiatischen Museums, verspricht für die Zeit der Schließung neuartige Vermittlungskonzepte, will die digitalisierten Objekte ihrer Sammlung in einen virtuellen Museumsrundgang verwandeln, der im Internet abrufbar sein soll. Auch eine Interims-Ausstellung einzelner Werke im nahe gelegenen Pergamon-Panorama sei geplant. Darüber hinaus, so Hermann Parzinger, wolle man einzelne herausragende Objekte als Botschafter in andere Museen in Berlin und auch weltweit verschicken, eine „Intervention“ im Hamburger Bahnhof und eine thematische Zusammenarbeit mit dem Kupferstichkabinett sei vorgesehen, eine Kooperation mit dem Louvre in Vorbereitung.
Klingt doch ganz nett. Aber was haben die aus aller Welt anreisenden Kunst-Touristen davon, wenn doch das Herzstück der jährlich von über 3 Millionen Besuchern bevölkerten Museumsinsel einer Baustelle gleicht und sie zentrale, ikonische Werke der Kunst-Geschichte nicht zu Gesicht bekommen? Außerdem kann heute ernsthaft niemand garantieren, dass die Kosten nicht noch ins Uferlose steigen und die Bauzeit sich noch um Jahre verlängern wird. Wie beim Humboldt-Forum oder dem Berliner Flughafen. Die Liste der nicht eingehaltenen Versprechungen ist lang. Der Berliner Baustellen-Blues ist doch immer für ein paar Überraschungen gut.
_____________________________
Info
Das Pergamonmuseum gehört zum Bauensemble der Museumsinsel und zum Weltkulturerbe der UNESCO. Im Auftrag von Kaiser Wilhelms II. wurde es von Alfred Messel im Stil des Neoklassizismus geplant und von 1910 bis 1930 von Ludwig Hoffmann in vereinfachter Form gebaut. Im Rahmen eines „Masterplans“ zur Sanierung der stark beschädigten Gebäude auf der Museumsinsel, zu denen auch das Bode-Museum, das Alte und das Neue Museum gehören, wird derzeit das Pergamonmuseum für die geplante Summe von 1,2 Milliarden Euro (plus 300 Millionen Euro Risikopuffer) von Grund auf erneuert und umgebaut. Von Oktober 2023 an wird es komplett geschlossen. Bauabschnitt A soll ab 2027 wieder zugänglich sein, Bauabschnitte B erst 2037.