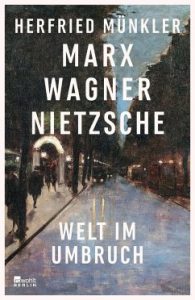Imaginäre Begegnungen zwischen Ikonen der Geistesgeschichte – Herfried Münklers Buch „Marx, Wagner, Nietzsche“
Herfried Münkler ist einer der bekanntesten Professoren Deutschlands. Wann immer über ideologische Verwerfungen, historische Katastrophen und aktuelle Kriege diskutiert wird, ist seine Meinung gefragt. Ob „Die Deutschen und ihre Mythen“ oder „Der Große Krieg“ – die Bücher des Politik-Wissenschaftlers stehen auf der Bestseller-Liste. Jetzt hat Münkler drei Ikonen der deutschen Geistes- und Kultur-Geschichte vereint: „Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch.“
Die ambivalenten Biografien der drei Geistesgrößen, ihre Alltagssorgen und Geldnöte, ihre politischen Analysen, musikalischen Revolutionen, philosophischen Innovationen: alles scheint längst bis ins letzte dunkle Geheimnis und verwirrendste Detail ausgedeutet. Gesellschaftsanalyse und Kapitalismuskritik von Marx; die Idee des kunstreligiösen Gesamtkunstwerks von Wagner; die Vorstellung von individueller Freiheit und Umwertung aller Werte durch den von Kunst beseelten Übermenschen von Nietzsche: tausendfach durch dekliniert. Das weiß natürlich auch Münkler. Deshalb verwickelt er die drei in ein imaginäres Gespräch.
Für Marx war Bayreuth ein „Narrenfest“
Aber Marx und Wagner sind einander nie begegnet. Nur einmal hat sich Marx, als er 1876 auf dem Weg zur Kur nach Karlsbad war und bei einer Zwischenstation in Nürnberg kein Zimmer bekommen konnte, fürchterlich geärgert, weil die Stadt – wie Marx ätzte – überschwemmt sei von Leuten, „die sich von dort aus zu dem Bayreuther Narrenfest des Staatsmusikanten Wagner begeben wollten.“ Am Kurort angekommen, schreibt Marx an seinen Freund Engels: „Allüberall wird man mit der Frage gequält: Was denken Sie von Wagner?“ Marx dachte nichts über Wagner, er war ihm völlig schnuppe. Der Musikgeschmack von Marx war zu konventionell, um die kompositorischen Neuerungen Wagners auch nur ansatzweise erfassen zu können.
Auch das individualpsychologische und kunstphilosophische Werk Nietzsches hat Marx weder zur Kenntnis genommen noch irgendwo kommentiert. Bei Wagner und Nietzsche liegt der Fall anders: Nietzsche hat Wagner erst glühend verehrt und in ihm den Retter des dionysischen Geistes gesehen, der einen neuen Kunst-Kult erschaffen und Deutschland zu einem aus antiken Ruinen wieder auferstandenen Griechenland machen könnte. Dass sich Nietzsche später von Wagner entfremdete, von seinem großbürgerlichen Lebensstil und seinem Antisemitismus angeekelt war, steht auf einem anderen Blatt.
Posthume Verfälschung der Werke
Münklers Buch ist der Versuch, Marx, Wagner und Nietzsche vom Kopf auf die Füße zu stellen, aufzuzeigen, dass Marx mit dem Realen Sozialismus nichts am Hut gehabt hätte und von Stalins Schergen an die Wand gestellt worden wäre; dass Wagners Antisemitismus zwar etwas Verwerfliches und Nietzsches Kunst-beseelter Übermensch etwas Wahnwitzes hatte, dass beide aber im Grabe rotieren würden, wenn sie wüssten, dass der eine zum Lieblings-Musiker von Hitler und der andere zum Vordenker des Faschismus vergewaltigt wurde.
Münkler konzentriert sich auf so genannten „Knoten“, Punkte, in denen die Biographien der drei sich berühren, Ereignisse, die für alle drei von besondere Bedeutung sind. Einer dieser „Knoten“ ist Bayreuth 1876, wo der vorbei reisende Marx sich über die vielen Wagner-Fans ärgerte und Nietzsche sich von Wagner nicht genügend gewürdigt fühlte, enttäuscht von den Festspielen abreiste und fortan zum Wagner-Hasser mutierte.
Knotenpunkte der Geschichte
Auch der deutsch-französische Krieg von 1870/71 ist ein „Knoten“, der Wagner in seiner Deutschtümelei bestärkte und von der Zerstörung des verhassten Paris träumen ließ, während Nietzsche sich erst freiwillig als Sanitäter meldete und später um das von der Pariser Commune zerstöre kulturelle Erbe fürchtete. Marx dagegen sah als Diagnostiker auf den Krieg und die Niederschlagung des Aufstands und entwickelte aus seinen Analysen eine neue Sicht auf die Rolle der deutschen Arbeiterklasse. Die Revolution von 1848/49 ist ein weiterer „Knoten“: Wagner hat als Hofkapellmeister zusammen mit seinem Anarchisten-Freund Bakunin auf den Dresdner Barrikaden gekämpft, Marx als Chefredakteur der „Neuen Rheinischen Zeitung“ die Politik mit journalistischen Mitteln begleitet: beide, Wagner und Marx, gingen nach dem Scheitern der Revolution ins Exil.
Für Nietzsche, damals noch ein Kind, blieb die Revolution folgenlos, sie war für ihn nie ein Thema. Der Antisemitismus ist ein „Knoten“ und Anlass, nach entsprechenden Belegen zu suchen, zu zitieren, wie Marx in privaten Briefen seinen Widersacher Lassalle wegen seines „jüdischen Aussehens“ beleidigte; Anlass auch, ausführlich zu diskutieren, ob Alberich im „Ring“, Beckmesser in den „Meistersingern“ und Kundry im „Parsifal“ als Juden-Stereotype anzusehen sind, und was es bedeutet, wenn Nietzsche die Juden als Urheber des „Sklavenaufstands in der Moral“ tituliert.
„Begleiter im 21. Jahrhundert“?
Münkler umkreist Themen wie die Wiedergeburt der Antike, Krankheit und Schulden, gescheitere Revolution und gelungene Reichsgründung, Bourgeoisie und Proletarier, die europäischen Juden und die Umsturzprojekte mittels Kunst und neuer Werte-Ordnung. Er fahndet nach Zitaten und biografischen Daten, versucht das Werk der drei Protagonisten zu entwirren, auf seinen unverfälschten Kern zurück zu führen und als Wegweiser vom 19. Jahrhundert in die Gegenwart zu deuten. Eine Sisyphusarbeit.
Zum Schluss schreibt Münkler, „alle drei miteinander ins Gespräch gebrachten Denker (sind) im 21. Jahrhundert angekommen – und haben hier, nach hochideologischer Auslegung ihrer Werke im 20. Jahrhundert, wieder zu sich selbst gefunden. Einer Welt im Umbruch entstammend, können sie zu Begleitern im 21. Jahrhundert werden, ebenfalls eine Welt im Umbruch.“ Wie diese „Begleitung“ aussehen, welche Themen für die Lösung der heutigen Probleme wichtig sein könnten, das hätte man doch gern etwas genauer gewusst. Doch darüber schweigt sich der sonst so beredte Münkler leider beharrlich aus.
Herfried Münkler: „Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch“. Rowohlt Berlin 2021, 720 Seiten, 34 Euro.