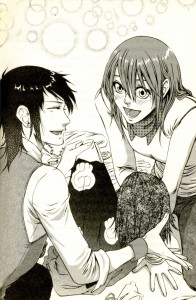Lachen und lernen vom Weinberg bis in den Weltraum – ein kleines Loblied auf die unverwüstliche „Sendung mit der Maus“
Ich gestehe es freimütig: Auch im nicht mehr ganz jugendlichen Alter weiß ich die „Sendung mit der Maus“ sehr zu schätzen. In Sachen TV-Klassiker-Status kann es der orangefarbene Nager nahezu mit „Tatort“ und „Tagesschau“ aufnehmen.

Ob groß, ob klein, die Maus muss sein… (Foto auf der heimischen Fensterbank: Bernd Berke / © an der Maus-Figur: WDR)
Die seit 1971 regelmäßig ausgestrahlten Lach- und Sachgeschichten sind halt kaum wegzudenken. Wie zu lesen ist, sind die Zuschauer(innen) im Schnitt 40 Jahre alt. Eltern, Großeltern und Kinder schauen eben gerne gemeinsam zu.
Allein schon die finalen Bestandteile der gegenwärtigen „Maus“-Ära sind aller Ehren wert, denn zum Schluss der Ausgaben sieht man entweder Shaun das Schaf, seine wolligen Gesellen, den dusseligen Farmer und den so oft gebeutelten Hund Bitzer o d e r – (Luft holen) – oder den famosen Lügenbold Käpt’n Blaubär, dessen freche Enkel und den Tolpatsch Hein Blöd. Beide Reihen sind auf je eigene Weise genialisch.
Auch die Animationsfilme in den Zwischenakten haben es oft in sich. Meine Lieblingsserie, die leider viel zu selten zum Zuge kommt, heißt „Trudes Tier“ und erzählt sehr liebevoll die etwas bizarren Geschichten einer jungen Frau, die mit einem zotteligen Monster zusammenlebt, das ihr mit seinen Eskapaden immer wieder Schweißperlen auf die Stirn treibt.
Maus, Elefant und Ente erleben derweil so elementare kleine Abenteuer, dass es mitunter ans Existenzielle oder Philosophische grenzt. Und die gar zittrig gezeichneten „Krawinkel und Eckstein“ (chaotischer Herr und sein Hund) folgen einer recht eigenen ästhetischen Spur. Das ist Staun- und Denkstoff, längst nicht nur für Kinder.
Nun aber natürlich keineswegs zu vergessen: die Sachgeschichten! Wo sonst bekäme man über Monate hinweg haarfein erläutert und vorgeführt, was sich im Jahreskreislauf in einem Weinberg begibt? Wo sonst erführe man, gleichsam Schräubchen für Schräubchen, wie ein ICE-Zug oder ein Feuerwehrwagen zusammengebaut werden? Wo sonst lernt man, wie ein Croissant gebacken wird oder wie die Löcher im Käse entstehen? Völlig andere Gewichtigkeit: Vor Jahren hat sich die Maus auch schon mit Atomkraft befasst. Die traut sich was.
Und wo sonst könnte der deutsche Astronaut Alexander Gerst so alltagsnah erläutern, was er so in der Weltraumstation ISS erlebt – vom wissenschaftlichen Experiment bis zum schwerelosen „Gang“ aufs Klo. Ein Exemplar der Maus ist (nach ungemein peniblen Schadstoff-Überprüfungen) im All dabei – und sie hat sogar einen maßgeschneiderten Astronautenanzug an…
Ebenfalls zugegeben: Ich habe die Macher der „Maus“ immer mal wieder beneidet, denn sie (vor allem Ralph Caspers) gönnen sich immer mal wieder überaus nette Dienstreisen. So haben sie etwa Schulkinder in Island, Indien, Japan oder Brasilien besucht, um zu zeigen, wie es denen so ergeht. Dabei geht es stets angemessen fröhlich und freundlich zu, niemals allzu kritisch. Doch die Kinder bekommen schon mit, wie verschieden ihre Altersgenossen auf diesem Planeten leben.
________________________________________
Anhang
Moderator(innen) der „Maus“ (Erstausstrahlung 7. März 1971):
Armin Maiwald (Jahrgang 1940 – seit 1971 dabei)
Christoph Biemann (Jahrgang 1952 – seit 1983)
Ralph Caspers (Jahrgang 1972 – seit 1999)
Malin Büttner (Jahrgang 1975 – seit 2008)
Siham El-Maimouni (Jahrgang 1985 – seit 2014)
Beispielhafte Animationsreihen im Rahmen der „Maus“-Sendungen:
Janosch: „O wie schön ist Panama“ (ab 1979)
Walter Moers: „Käpt’n Blaubär“ (ab 1991)
Wouter van Reek: „Krawinkel und Eckstein“ (ab 2004)
Gunilla Bergström: „Willi Wiberg“ (ab 2004)
Richard Goleszowski: „Shaun das Schaf“ (ab 2007)
Andreas Strozyk: „Ringelgasse 19″ (ab 2010)
Marcus Sauermann: „Trudes Tier“ (ab 2014)
Eine Institution ist mittlerweile auch der Maus-Türöffner-Tag, der just wieder am jetzigen Feiertag (3. Oktober) bundesweit begangen wird und Kindern den Zugang zu Einrichtungen oder Firmen ermöglicht, die für gewöhnlich verschlossen bleiben. Vielleicht sind ja noch ein paar Plätze in der Nähe frei?