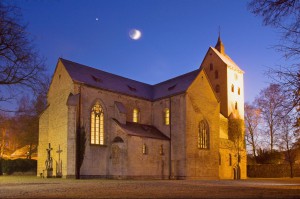Erinnerungstheater aus dem Revier – Neue Einblicke in die Sammlung des Ruhr Museums
Vor allem für Auswärtige sei’s gesagt: Das Ruhr Museum beherbergt die wohl umfangreichste Sammlung zur hiesigen Regionalgeschichte und befindet sich seit einigen Jahren auf dem Gelände der Essener Zeche Zollverein, welche bekanntlich als Unesco-Weltkulturerbe firmiert. Punkt.

Panorama vom Gelände der Essener Zeche Zollverein, auf dem sich das Ruhr Museum befindet. (Foto: Bernd Berke)
Nach und nach werden die gesamten Bestände gesichtet, sukzessive ausgestellt und sorgsam katalogisiert. Dabei treten, gleichsam Stück für Stück, neue Einsichten und Erkenntnisse zutage. Jüngste Frucht der Bemühungen: Jetzt ist – unter dem Titel „Arbeit und Alltag“ – ein Konvolut aus dem Kernbesitz zu sehen, nämlich rund 350 Exponate aus der Kollektion zur Industriekultur und Zeitgeschichte.
Was dabei zum Vorschein kommt, ist nicht etwa aus der eh schon lohnenden Dauerausstellung des Hauses abgezweigt worden, sondern stammt aus den reichhaltigen Depots. Praktisch alle Schaustücke waren bislang noch nicht öffentlich zu sehen.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Frank Kerner und Axel Heimsoth. Sie und ihr Team haben wahrlich gewichtige Stücke ausgewählt, die von der heute unvorstellbaren Härte der Arbeit künden, beispielsweise eine tonnenschwere Gießpfanne, die einst bei Hoesch in Dortmund zum Einsatz kam. Kohle und Stahl stehen natürlich im Zentrum der Abteilung „Betrieb“, sie machten das frühere Ruhrgebiet aus.
Ungleich schwerer als heute war freilich auch die Hausarbeit, damals noch eindeutig Sache der Frauen. Wir sehen frühe Haushaltsgeräte für Waschtag, Küche und Näharbeiten. Jedes Stück enthält eine Geschichte, wenn man sie zu lesen und zu deuten weiß. Nicht alles, aber vieles ist spezifisch fürs Ruhrgebiet, so auch jenes schwarze Brautkleid einer Bergmannsfrau, das kostensparend auch im späteren Alltag getragen werden konnte.
Die zahlreichen Signaturen aus den recht sinnvoll angeordneten Bereichen Betrieb, Individuen (Kleidung, Porträts, Hygiene), Haushalt, Freizeit (Vereine, Vegnügen, Spielzeug) und Gesellschaft (Schule, Kirche, Herrschaft, Weltkriege) bescheren immer wieder kleine Aha-Erlebnisse. Aus all dem ergibt sich ein Kaleidoskop der alten Zeiten im Ruhrpott.
Man sollte hierzu möglichst den Katalog lesen, der viele Exponate einzeln erläutert. Da finden sich einige Prachtstücke eingehend beschrieben, so eine der ganz frühen, mit Gas beheizten Duschen der Firma Vaillant (um 1910), eine Schulbank von 1893, eigens konstruiert für den privathäuslichen Unterricht in den gehobenen Schichten oder ein gänzlich stählerner Altar aus einer Essener Kirche, der auf besondere Weise vom materiell grundierten Selbstbewusstsein der Region zeugt.
Über die historische Erzählung hinaus, entfalten manche Objekte auch ästhetische Qualitäten. Man schaue sich etwa die zerbeulten Weißblech-Kaffeeflaschen an, die von den Bergleuten unter Tage verwendet wurden. Sie wirken, derart gruppiert wie hier, als gehörten sie zu einer künstlerisch inspirierten Installation.
Museumsdirektor Heinrich Theodor Grütter spricht von einem „Erinnerungstheater“, das von manchen der Objekte angeregt werde. Tatsächlich begegnen einem hier etliche Gegenstände, die man kennt, wenn man schon lange im Revier lebt, „Gelsenkirchener Barock“ inbegriffen. Zumal die Zeitzeugnisse aus den 50er und 60er Jahren dürften noch viele Besucher zuinnerst ansprechen.

Radio-Fernseh-Kombinationstruhe Saba „Bodensee“ Vollautomatic 126 Stereo (1960/61). (© Ruhr Museum, Foto Rainer Rothenberg)
Vor allem ältere „Ruhris“ werden hier vertraute Zeichen der herkömmlichen Identität dieser oftmals geschundenen Gegend finden. Und noch ein Stichwort wirft Grütter in die Debatte: „Verlusterfahrung“. Ja, es ist wahr: Ein Großteil der ausgestellten Gegenstände hat mit längst oder unlängst versunkenen Lebenswelten zu tun, insofern auch mit Wehmut.
Wie alle Sammlungen, so hat auch diese ihre Vorgeschichte. Schon um 1903 gab es in Essen Pläne zum Aufbau einer industriegeschichtlichen Sammlung, die jedoch durch mancherlei Fährnisse und Widrigkeiten über Jahrzehnte hinweg nicht zustande kam. Ja, wesentliche Bestände der Krupp-Werke wanderten gar nach München ab, wo sie einen Grundstock des Deutschen Museums bildeten. Immer diese Münchner…
Über einige Zwischenstationen (z. B. das heimattümelnde Ruhrlandmuseum der NS-Zeit, das Ruhrmuseum neben dem Folkwang-Museum in der Goethestraße) gelangte man schließlich aufs Areal der Zeche Zollverein. Den Rückstand beim Sammeln industrieller Zeugnisse hat man derweil vielfach einigermaßen aufgeholt, wenn nicht gar wettgemacht.
Erst gegen Ende der 1970er Jahre, als die Montanindustrie deutlich schwächelte und der erzwungene Strukturwandel sich abzeichnete, wurde sich das Revier selbst historisch und ging allmählich auf betrachtende Distanz zur eigenen Geschichte. Zugleich begannen sich die Historiker überall mehr und mehr für Alltagsdinge zu interessieren, die vordem missachtet worden waren. Erst jetzt wurde dementsprechend gesucht und gesammelt.
Aus solchen Entwicklungen erklärt sich der Zuschnitt der heutigen Sammlung, die nicht zuletzt durch Zeitungsaurufe rapide angewachsen ist. Und der Zustrom hört beileibe nicht auf: Allwöchentlich werden dem Museum, etwa bei Haushaltsauflösungen, viel mehr Objekte angeboten, als es jemals beherbergen kann.
Da heißt es klug und besonnen auswählen. Nicht alles, was persönlich bedeutsam ist, muss der Allgemeinheit etwas sagen und in ein Museum gehören. Direktor Grütter über den Zustand, um den die meisten Leiter von Kunstmuseen ihn beneiden dürften: „Wir haben kein Geldproblem, wir haben ein Platzproblem.“
„Arbeit & Alltag“. Industriekultur im Ruhr Museum. 26. September 2015 bis 3. April 2016. Mo bis So 10-18 Uhr. Eintritt 7 €, ermäßigt 4 €. Katalog 29,80 (im Museum 19,80) Euro. Infos: www.ruhrmuseum.de
Ruhr Museum. UNESO-Welterbe Zollverein, Areal A (Schacht XII), Kohlenwäsche (Gebäude A 16), Essen, Gelsenkirchener Straße 181. Adresse für Navi-Systeme: Fritz-Schupp-Allee 15. Kostenlose Parkplätze A 1 und A 2.