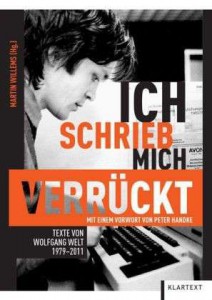Vom fernen Freigeist fasziniert – Werner Streletz‘ Versuch über den französischen Dichter Robert Desnos
Man tritt dem Bochumer Autor Werner Streletz wohl nicht zu nahe, wenn man ihn einen fleißigen, produktiven Schreiber nennt.
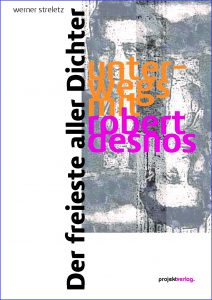 2011 erschien „Volkers Lied der Nibelungen. Eine Annäherung“, 2013 der Roman „Rohbau“, 2014 „Gewaltig endet so das Jahr. Meine Tage mit Georg Trakl“. 2016 folgte wiederum ein autobiographisch getönter Roman: „Rückkehr eines Lokalreporters“.
2011 erschien „Volkers Lied der Nibelungen. Eine Annäherung“, 2013 der Roman „Rohbau“, 2014 „Gewaltig endet so das Jahr. Meine Tage mit Georg Trakl“. 2016 folgte wiederum ein autobiographisch getönter Roman: „Rückkehr eines Lokalreporters“.
Im Umkreis des Surrealismus
Und nun liegt, noch 2017 erschienen, ein freilich nur 66 Seiten schmaler Band mit dem Titel „Der freieste aller Dichter vor“, der als Novelle firmiert und in dem Streletz Annäherungsversuche an den französischen Dichter Robert Desnos (1900-1945) unternimmt.
Streletz ist geradezu getrieben vom Impuls, zumal in der Literatur-, Theater-, Film- und Rockmusik-Geschichte Geistesverwandtschaften aufzuspüren oder – wer weiß – vielleicht auch erst zu kreieren. Nun also Robert Desnos, der vor allem als sprühend inspirierter Lyriker im Umkreis der Pariser Surrealisten auftrat, sich aber von deren selbsternanntem „Papst“ André Breton keineswegs vereinnahmen ließ und auch dessen kommunistische Orientierung nicht teilte.
„Der freieste aller Dichter“
Unterdessen verdingte sich Desnos als durchaus fähiger Journalist und „Werbefuzzi“, um mit Streletz zu reden. Das Ehrenzeichen, „der freieste aller Dichter“ zu sein, bekam Desnos vom Schriftstellerkollegen Paul Eluard angeheftet.
Werner Streletz zeigt sich durchweg angetan, ja fasziniert vom französischen Freigeist und imaginiert die eine oder andere Begegnung mit diesem „Sekretär des Unbewussten“ – nach dem Leitmotto „Wenn ich ihn gekannt hätte…“ Es ist, als wolle sich der Bochumer partout eines weiteren Vorläufers oder zumindest Anregers versichern.
Einmal verfassen die beiden sogar quasi ein Gedicht miteinander, genauer: Der Bochumer ermuntert Desnos, in einer schwachen Stunde wieder in seine literarische Spur zu finden. Zuweilen fallen Streletz zu Begebenheiten aus Desnos‘ Biographie eigene Erinnerungen aus der Ruhrgebiets-Kindheit ein. So beispielsweise, wenn es um die Angst vor dem eigenen Vater geht.
Nicht alles will sich zueinander fügen
Doch nicht immer will sich das wirklich zueinander fügen. Manches wirkt eher wie zwanghaft herbeigeschrieben. Die Lebensläufe lassen sich natürlich nicht ohne weiteres miteinander kurzschließen. Und man fragt sich im Lauf der Lektüre, ob Werner Streletz vielleicht gerade auch die Schwierigkeit herausstellen wollte, sich solch einer literarischen Gestalt tatsächlich zu nähern. Der unentwegt betonte Modus des „Es wäre möglich, dass…“ würde sich somit teilweise als illusorisch erweisen.

Robert Desnos mit seiner Gefährtin Youki Foujita im Jahr 1933. (Foto: Archives Desnos / Menerbes – public domain / gemeinfrei bei Wikimedia Commons)
Es ist eine manchmal geradezu leichtfertige, dann aber auch wieder recht mühselige Annäherung, in deren Verlauf Streletz zuweilen auch sprachlich sehr vorsichtig tastend und manchmal geradezu umständlich zu Werke geht. Hie und da droht er sich in Zeitebenen und konjunktivischen Formen geradewegs zu verheddern. Ein literarischer Draufgänger ist er nicht; eher schon einer, der sich immerzu in Frage stellt.
Tod im KZ Theresienstadt
Etwa in der Mitte des Textes ist es aufs Schrecklichste vorbei mit der einst herrlich behaupteten Freiheit der Kunst und des Künstlers. Die Nazi-Truppen sind in Frankreich einmarschiert und können sich auch auf Denunzianten und Kollaborateure stützen. So kommt es, dass auch Robert Desnos, der für die Résistance im Untergrund gearbeitet und zuvor mit der Japanerin Youki Foujita ein privates, jedoch auch öffentlich zelebriertes Glück gefunden hat, verhaftet und nacheinander in verschiedene Konzentrationslager deportiert wird. Kurz nach der Befreiung des Konzentrationslagers Theresienstadt stirbt Desnos dort unter absurd tragischen Umständen am 8. Juni 1945.
Überflüssig zu sagen, dass eine „Annäherung“ an den französischen Dichter mit dieser Zeit in der Hölle noch unendlich problematischer, wenn nicht vollends unmöglich wird. Was zuvor streckenweise mühselig erschien, wird nun in jeder Hinsicht quälend.
Im letzten Satz der Novelle (wir wollen hier nicht über Gattungs-Definitionen streiten) schwingt denn auch leise Resignation mit: „Seltsam eigentlich, dachte ich: Vielleicht ist das alles doch schon zu lange her.“
Werner Streletz: „Der freieste aller Dichter. Unterwegs mit Robert Desnos“. projekt verlag, Bochum/Freiburg. 66 Seiten. 12,80 Euro.
_________________________________________________
Nachspann
P.S.:
Eine heitere Gedichtprobe von Desnos, die in Streletz‘ Buch zitiert wird und von Morgenstern oder Ringelnatz stammen könnte – oder auch von Villon:
Der Pelikan
Der Kapitän Jonathan
Fing schon mit 18 Jahr’n
Eines Tages einen Pelikan
Auf einer Insel im Ozean.
Der Pelikan von Jonathan
Legt morgens ein schneeweißes Ei,
Und daraus schlüpft ein Pelikan
Der ihm erstaunlich gleicht.
Und dieser zweite Pelikan
Legt auch ein schneeweißes Ei,
Aus dem schlüpft unvermeidlich dann
Ein neuer und tut es ihm gleich.
Ich glaub, dass dies so ewig währte,
wenn man sie nicht vorher als Omelett verzehrte.
P.P.S.:
Zufallsfund während der Streletz-Lektüre: „Der freieste Schriftsteller aller Zeiten“ war – nach dem Urteil von Friedrich Nietzsche – übrigens (auch) Laurence Sterne („Tristram Shandy“), ein unübertroffener Großmeister der Abschweifungen.
P.P.P.S.:
Und noch ein Fund, verzeichnet im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek; eine ausgesprochene Rarität, sogar mit Ruhrgebiets-Bezug: Anno 2008 ist in der von Louis Flamel betriebenen Dortmunder edition alicorn ein druckgraphisches Mappen-Buch über Robert Desnos erschienen: „L’étoile de mer oder die Sirene des Schlafs. Robert Desnos & Louis Flamel“. edition alicorn. Trémoigne (= Dortmund) 2008.