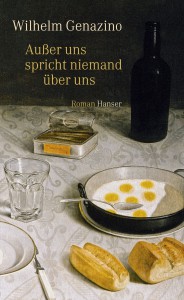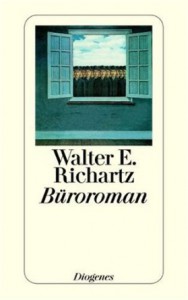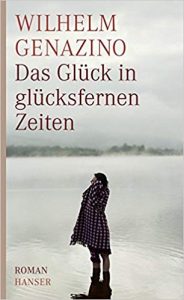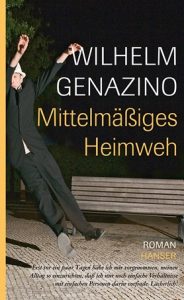Die Liebens-Würdigkeit – Wilhelm Genazino nachgerufen

2015: Wilhelm Genazino als Gast des Gladbecker Literaturbüros in der Stadtbibliothek Duisburg. (Foto: Jörg Briese)
Wilhelm Genazino war einer der Lieblingsgäste des Gladbecker Literaturbüros Ruhr. Mal las und diskutierte er im Jüdischen Gemeindezentrum am Duisburger Innenhafen, mal im Theater an der Ruhr, mal im Foyer des Museums Bochum. Bei Tisch- und Bühnengesprächen für und mit uns blieb er immer jener freundlich-zugewandte Gast, den sich jeder Gesprächspartner oder Veranstalter wünscht.
Während einer Fahrt zum Hotel „Duisburger Hof“ unterhielten wir uns einst über den ihm so verhassten Lärm (aus Nichts), der alles überwuchert: öffentliche Easy-Listening-Musik, die stampfenden Beats aus spätpubertierenden Jünglingskarossen, Self-Marketing-Gedröhne oder Eventwahn. Ein anderes Mal wunderten wir uns über den Zwang zu Selbstoptimierung und die Pflicht zum Auslandsaufenthalt, ohne den kein Leben (vor allem keine Karriere) mehr möglich zu sein scheint. Genazino selbst – durchaus auch ein Reisender – blieb seiner Heimat zwischen Mannheim, Frankfurt und Heidelberg immer verhaftet und machte aus dem Historiker-Motto „Grabe, wo du stehst“ seine eigene Poetik des beharrlich „gedehnten Blicks“, ein detailversessenes Sehen, das nicht nur genau hinschaut und durch schaut, sondern Bewusstsein, Ort und Gegenwart so tief auslotet, dass Wilhelm Genazino zu Recht als leiser, aber wortgewaltiger Wahrnehmungsvirtuose gilt.
Im besten Falle: gescheit, gescheitert, gescheiter
Für diese Meisterschaft erhielt er viele Preise. Und war einer, der sich über Preise (und Preisgelder) auch freuen konnte. Allerdings monierte er in seinem Essay „Funkelnde Scherben. Der Künstler und sein Preis“, dass mit dem Lobpreisen des Autors oft die vielfachen Möglichkeiten des Scheiterns beim Schreiben ausgeblendet werden. Im Vordergrund stehe nur noch das gelungene Werk. Als ich ihn einmal fragte, wie er die ‚Helden‘ seiner Romane beschreiben würde, antwortet er: „Wie uns alle. Jeder, der den Alltag überlebt, ist eigentlich ein Held.“
Den wohl wichtigsten Literaturpreis, den Georg-Büchner-Preis, erhielt Wilhelm Genazino 2004, auch mit der Begründung, dass er sich „wie Georg Büchner stets um die Randexistenzen der Gesellschaft gekümmert“ habe. Man hätte präziser sagen können: vor allem um das Innenleben von vermeintlichen Außenseitern – denn selbstverständlich wusste Genazino, dass die Einzelgänger, Verlierer und Sonderlinge so selten nicht sind, dass die „Randexistenzen“ heute eher die heimliche Mitte, das unheimliche Massezentrum der Gesellschaft bilden.
Den Eigenbrötlern Genazinos geschieht viel, vieles stößt ihnen zu, doch nur selten passiert etwas. Jedenfalls war das lange so in seinen Texten und in Genazino wuchs der Wunsch, dies zu ändern. In einem TagesAnzeiger-Interview mit Hajo Steinert kommentierte er die Jahre zwischen 1984 und 1989 so:
„Da hatte ich meine bisher größte Krise. Mit Romanen aus der Angestelltenwelt ging es nicht weiter. Fünf Bücher dieser Art waren genug. Mein Programm des psychologischen Realismus war erschöpft. (…) Mit meinem neuen Roman ‚Die Liebesblödigkeit’ betrete ich ein neues Kapitel meines Schriftstellerdaseins. Ich konnte doch mein Programm einer Ästhetisierung der Wahrnehmung nicht ewig fortführen. So wenig wie damals meine Angestelltenromane. Ich will hin zu einem handlungsstarken Romantyp. Mich aus einer Einbahnstraße befreien.“
Vieles blieb dennoch erhalten. Die Ratlosigkeit und der Schwindel, der viele Figuren Genazinos erfasst, ihre Verstörungen, ihre Innen- wie Außenweltallergien. Trotz aller Selbstauskünfte Genazinos, trotz aller Essays und Poetikvorlesungen verweigerte der Autor vorschnelle Lösungen in den Geschichten, und eindimensionalen Schreib-Programmen oder schlüssigen, also erstarrten Poetiken misstraute er weiter zutiefst.
Die schwierige Kunst, innere Welten sichtbar zu machen
Über Virginia Woolf schrieb Wilhelm Genazino: „Es wird von inneren wie von äußeren Befindlichkeiten erzählt, und zwar so, als wären auch die inneren anschaulich. Sie erzählt von der inneren Welt, als könnte man von dieser erzählen.“ Und in der Tat – vielleicht kann man das trotz aller Zweifel, jedenfalls ein Autor von Genazinos Größe. Als Leser sind wir fasziniert davon, wie der Erzähler hörbar macht, Dechiffrierer und Übersetzer dessen ist, was man mit der Sprachwissenschaft Wygotskis oder Piagets das „innere Sprechen“ der Menschen nennt. Wir alle praktizieren und hören dieses unaufhörliche, oft zwanghafte innere Sprechen, aber kaum einer erfasste dieses amorph-wilde Durcheinander zwischen Halbgedachtem, Gefühl, Bild und Wort so als lesbar verstörenden Text wie Genazino. Er brachte es in Form, in eine ästhetische Gestalt, die auch die ganze Tragik und Komik dieses Sprechens und der damit verbundenen Biografien, Hoffnungen, Verletzungen, Sehnsüchte, Absurditäten enthüllt. Dieser „Selbstkommentar unseres unentwegt erlebenden Ichs“ ( so Genazino in seinem Essay „Belebung der toten Winkel“) ist so intensiv gestaltet, dass der Leser nicht umhin kann, auch seinem eigenen inneren Sprechen, das sich nun nicht mehr länger überhören lässt, endlich Gehör zu schenken. Genazino bringt zur Sprache, was andere nur diffus erleben, denn deren inneres Sprechen bleibt – ästhetisch unbearbeitet – bloß fragmentarisch, flüchtig, abgründig, asynchron, amoralisch, voller Tempo- und Bildwechsel.
Wilhelm Genazino genügte dagegen oft nur ein einzelnes Wort (wie „Liebesblödigkeit“ oder „Problembetreiber“) oder ein einziger Satz, um eine Shortest-Story oder doch gleich von der ganzen Welt zu erzählen. So leuchtet er uns mit seinen Romanen, Erzählungen und Essays weiter heim und aus: unsere Innenausstattung, jene Inneneinrichtung des sog. modernen Massenmenschen, der so gerne Individuum, also unteilbares Ganzes und nicht nur zersplittertes Ich wäre.