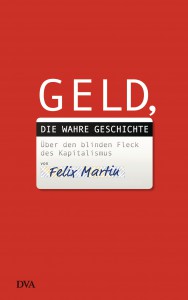Virus der Ratlosigkeit: Diese und jene Frage über Corona hinweg

Natürlich kein Virus, sondern ein Nahrungsbild, das während einer Speisenzubereitung in der Küche entstanden ist. Und nein: Es ist auch wirklich kein Spiegelei. (Foto: Bernd Berke)
Für virologische Expertisen sind wir hier absolut nicht zuständig. (Ich höre schon Euer Loriotsches „Ach was…“). Auch steht uns selbstverständlich keine politische Entscheidung zu, es sei denn: als indirekte Teilhabe im Rahmen unserer demokratischen Rechte (manche unken auch schon: unserer verbliebenen Rechte). Es interessiert einen im Überlebensfalle freilich schon sehr, wie diese, unsere Gesellschaft „nach Corona“ aussehen könnte. Daher diese oder jene ratlose Frage.
1) Wird eine gewachsene Mehrheit künftig in verstärktem Maße immer gleich nach dem Staat rufen, der gefälligst alles regeln und möglichst auch bezahlen soll? Wie verträgt sich das mit dem Anspruch so vieler Gruppierungen, selbst möglichst immer weniger Steuern zu bezahlen? Der Staats soll’s haben und richten – aber woher und womit?
2) Wird sich dieser etwaige Impuls der Staatsfrömmigkeit von Land zu Land unterscheiden? Werden etwa die Bürger Frankreichs widerspenstiger sein als „wir“?
3) Sollten wir nicht heilfroh sein, dass es hier bei allem nötigen Reglement demokratisch zugeht und die Menschen nicht – wie in furchtbar vielen autokratischen Ländern der Welt – brutal in die Quarantäne geprügelt oder ins Jenseits geschossen werden?
4) Gibt es neben den vielen, vielen, die wirklich bedürftig sind und auf Unterstützung hoffen, auch solche, die vorher schon halb in der Krise waren und sich nun mit dem Anker von Staatshilfe retten wollen? Wird die Bedürftigkeit überprüft oder wird im Überschwang alles durchgewunken?
5) Und wie verhält es sich mit den Profiteuren, deren Geschäftsmodell haargenau zur gegenwärtigen Lage passt? Sollten sie nicht etwas abgeben?
6) Nebenfrage: Wie halten es eigentlich die sogenannten „Reichsbürger“ mit den diversen Rettungsschirmen und Hilfspaketen? Die Idioten nehmen doch sicherlich gern Knete vom Staat, den sie ansonsten nicht anerkennen, oder?
7) Wer glaubt wirklich, dass die Reichen, Begüterten, Betuchten und Wohlhabenden ihr Geld überwiegend in lebenswichtiges Produktivvermögen gesteckt haben, in Fabriken, Maschinen, Personal – und es nur in ganz bescheidenem Maße zur persönlichen Verwendung antasten?
8) Ist es nicht erstaunlich, dass nun etliche Leute bereit sind, vorübergehende Staatseingriffe in die Wirtschaft, wenn nicht gar Verstaatlichungen bestimmter Bereiche hinzunehmen, die solcherlei Ansinnen vor kurzer Zeit noch als Teufelswerk bezeichnet hätten?
9) Ist außer den lukrativ Beteiligten jemand dagegen, das in den letzten Jahren teilweise kaputtgesparte und neoliberal privatisierte Gesundheitswesen wieder weitgehend in öffentliche Regie zu übernehmen?
10) Werden dann die Angehörigen der Pflegeberufe (und einige andere Berufsgruppen) endlich angemessen bezahlt? Hat man denn nicht gesehen, dass das Virus auch die Klassenfrage neu aufgeworfen hat?
11) Wird dem Staat künftig generell mehr überantwortet oder aufgebürdet? Soll er uns im Gegenzug allweil gängeln dürfen?
12) Werden viele Menschen nach staatlicher Autorität geradezu lechzen, nach der harten Hand des Staates?
13) Wird zugleich der Asozialtypus des „Blockwarts“ (und des Denunzianten) wieder hervortreten und dumpf auftrumpfen, der es den Hedonisten mal so richtig zeigt?
14) Haben nun auch die Apokalyptiker Hochkonjunktur?
15) Löst der um sich selbst besorgte „Prepper“ den Hedonisten als Rollenmodell ab? Haben beide etwa insgeheim Gemeinsamkeiten? Was unterscheidet den Prepper vom gewöhnlichen Hamsterer?
16) Mag man die schicksalsergebene Wendung „In den Zeiten von Corona“ noch hören?
17) Wird, sofern Corona vorüber oder zumindest behandelbar ist, hierzulande alles rasend schnell nachdigitalisiert? Werden wir in dieser Hinsicht gar zu Litauen und Albanien aufschließen?
18) Wird die wild ins Kraut geschossene Globalisierung zum Teil zurückgedreht? Werden lebenswichtige Güter künftig wieder häufiger in Deutschland und Europa hergestellt – zu deutlich höheren Kosten als Preis der Versorgungssicherheit?
19) Wird es eine Wiederkehr der Nationalstaaten als Leitbild geben? Kann das zu ungeahnten Animositäten führen, die man längst überwunden glaubte?
20) Wird der angebliche Trend zu seriösen Medien von Dauer sein? Widerstehen die meisten Menschen nun der Versuchung zu unsinnigen Verschwörungstheorien? Lauern Populisten schon seit Wochen auf ihre Chance?
21) Soll man jetzt wirklich Masken tragen? Wie muss man sich beispielsweise Schulklassenfotos vorstellen, auf denen alle mit Masken versehen sind?
22) Um nach den hauptsächlichen Teilen einer Zeitung zu fragen: Werden wir hernach eine andere Politik, eine andere Wirtschaft, eine andere Kultur, einen anderen Sport und andere Gemeinden haben?
23) Wird sich das Verhältnis zu Migranten und Geflüchteten ändern? Werden die Religionen und Konfessionen anders miteinander umgehen?
24) Wird man den Klimawandel und die Folgen in einem anderen Licht sehen?
25) Wann wird es Impfstoffe und Medikamente geben?
26) Wann dürfen wir wieder dieses und jenes tun?
27) Ist es nicht jammerschade, dass wortmächtige Intellektuelle wie der heute (von der Neuen Zürcher Zeitung) vorübergehend irrtümlich totgesagte Hans Magnus Enzensberger sich nicht zum Themenkreis äußern?
P. S.: Immerhin hat sich im Monopol-Magazin und im Cicero Alexander Kluge zu Wort gemeldet.