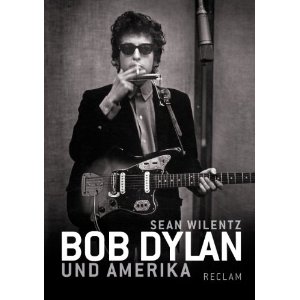Pete Seeger: Die Stimme der Minderheiten und Unterdrückten ist verstummt
Wenn Joan Baez‘ Stimme wie eine Freiheitsglocke mit „We shall overcome“ aus dem Getümmel eines Ostermarsches klang, wenn Bob Dylan elektronisch verstärkt klampfte und sein Vorbild ihm den Stecker rauszog, wenn Bruce Springsteen mit ihm gemeinsam Musik zu Ehren des ersten schwarzen Präsidenten der USA machte und beide offenbar Hoffnungen in Barack Obama setzten – und wenn der große Woody Guthrie nur mit ihm zusammen „The Alamac Singers“ gründen wollte, dann fiel stets sein Name: Pete Seeger, der viel Verstand und Musikalität, politische Integrität, unbeugsamen Widerstandsgeist und das Krächzen seines 5-saitigen Banjos gegen jeden Zeitgeist setzte, ist im Alter von 94 Jahren in einem Krankenhaus seiner Geburtsstadt New York gestorben.
Er war Soziologiestudent in Harvard, brach aber gelangweilt ab, um sich einer lebenslangen Leidenschaft zu widmen, der Musik seines Heimatlandes. Es begann damit, dass er amerikanischer Volkslieder und Blues aus den Südstaaten sammelte. Und er nahm sein Banjo zur Hand, spielte eigene Lieder und machte die ersten Schritte dorthin, wo er bis zu seinem Tode seine Aufgabe sah: Unterdrückten, Ausgebeuteten und Minderheiten eine laute und allerorts in den USA und darüber hinaus vernehmbare Stimme zu verleihen.
In der Tradition seines Freundes Woody Guthrie wurde er der Großvater der Folkmusik und sah in ihr ein Werkzeug, das gegen Machthaberei und für Bürgerrechte eingesetzt werden konnte. Und seine – heute würde man sie vielleicht „Follower“ nennen – Weggefährten und „Jünger“ tun es ihm nach.
Pete Seeger unterstützte Henry A. Wallace, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten von 1949. Vergebens, wie wir wissen, denn statt des integren Wallace kam Harry Truman an die Macht, dessen Intellekt eher als ergänzungsbedürftig anzusehen war. Pete Seeger weigerte sich 1955 standhaft, vor dem Tribunal-Herren McCarthy und dessen „Komitee gegen unamerikanische Umtriebe“ auszusagen, was ihm eine Haftstrafe von 10 Jahren einbrachte; nur eines musste er absitzen. Aber darauf wurde er 17 Jahre lang boykottiert. Kein kommerzielles US-Medienunternehmen wollte ihm mehr eine Bühne geben.
Also schuf er sich selbst seine Öffentlichkeit, gemeinsam mit Theodore Bickel, der mit ihm das Newport Folkfestival auf Rhode Island anregte und zum Leben erweckte. Dort drehte er auch dem jungen Bob Dylan den „Saft ab“, was dazu führte, dass dessen Nuschel-Gesang gar nicht mehr beim Publikum ankam und der arme Kerl ausgebuht wurde. Pete Seeger meinte später kleinlaut, dass er doch nur Bob Dylans Lyrik verständlich werden lassen wollte, die durch die brüllende elektronische Beschallung nicht mehr zu verstehen war.
Bis ins hohe Alter blieb Pete Seeger, übrigens Neffe des Lyrikers Alan Seeger, musikalisch und damit politisch aktiv, hob für den Umweltschutz seine Stimme, stritt stets für Menschenrechte und war zur Stelle, wenn es darum ging, Solidarität mit denen zu zeigen, die geknechtet wurden. Pete Seeger war der Denker, der Philosoph und der sammelnde Bewahrer ganzer Musik- und Musikergenerationen. Die Themen seiner Lieder werden wohl nie ihre Aktualität verlieren. Bye, Pete.