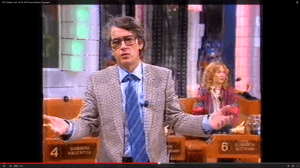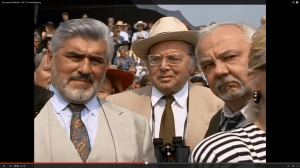Heino wird 80 – Sind denn alle Geschmäcker nivelliert?
Kinder, wie die Zeit vergeht! Denkt euch nur: Morgen (13.12.) wird Heino schon 80. Obwohl: Etliche Leute haben bereits vor vier bis fünf Jahrzehnten gesagt, er sei ein Mann des Ewiggestrigen und wirke ziemlich alt.
Was sonst nur ganz wenigen – *räusper, räusper* – Kulturschaffenden widerfährt: Das ZDF hat ihn jetzt mit einer 45-Minuten-Sendung zur Prime Time gewürdigt. Darin wird der sonore Volkslied-Barde überwiegend im milden Licht der (Lebens)-Abendsonne betrachtet. Selbst die meisten Achtundsechziger, so erfahren wir, hätten irgendwann und irgendwie ihren Frieden mit Heino gemacht. Ein Rebell von damals ist sogar seit Jahren sein Produzent und hat ihn offenbar als Profi schätzen gelernt.
Hat sich also alles relativiert, sind alle Unterschiede nivelliert und alle einst so tiefen Gräben zugeschüttet worden? Je nun. Jörg Müllners Film mit dem schulterklopfenden Titel „Mensch Heino!“ spart auch kritische Fragen nicht gänzlich aus – und nicht alle haben sich mit der Zeit ohne weiteres erledigt; wenngleich Heino selbstzufrieden meint, der Erfolg gebe ihm in jedem Sinne Recht.
Trotz Apartheid in Südafrika aufgetreten
In die äußere rechte Ecke gehört er wohl wirklich nicht. Jedoch: Zumindest „blauäugig“, naiv und fahrlässig, hat Heino (bürgerlich Heinz Georg Kramm) gelegentlich Liedgut ausgegraben und neu zu beleben versucht, das schon in der Nazizeit zum forschen Absingen und Marschieren taugte. Auch ist er gegen alle Vernunft und wider allen Anstand in Südafrika aufgetreten, als dort noch die rassistische Apartheid herrschte.
Immer wieder zog es ihn nach Namibia (zu Kolonialzeiten „Deutsch-Südwest“), um dem dortigen Deutschtum dienstbar zu frönen und dabei stets das historisch anrüchige „Südwester-Lied“ anzustimmen. In und um Windhoek hat er seine vielleicht treueste Fangemeinde, allenfalls annähernd erreicht von Scharen ehemaliger DDR-Bürger, die ihn früher partout nicht hören sollten (worüber sogar die Stasi wachte). Filmemacher Jörg Müllner präsentiert auch ein schräges Archiv-Fundstück aus der Fernseh-Steinzeit: Karl-Eduard von Schnitzler (berüchtigt als „Sudel-Ede“) mit einem harschen Verdammungsurteil über Heino im „Schwarzen Kanal“, dem legendären DDR-Propagandamagazin.
Liaison mit einer bildhübschen Prinzessin
Schlagerkollege Roberto Blanco hingegen huldigt ihm auf fast schon ergreifend schlichte Weise. Heino habe Millionen glücklich gemacht. Neben Weggefährten und Managern kommt selbstverständlich auch Gattin Hannelore (seit 1979 seine dritte Ehefrau) zu Wort. Fotografien zeigen sie als bildhübsche, in ihrer ersten Ehe adelig angeheiratete Prinzessin von Auersperg. Die Boulevard-Presse überschlug sich damals ob dieser Promi-Liaison. Freilich drohte zugleich ein Imageschaden beim rückständigen Publikum. Hatte der treudeutsche Heino nicht auch ehelich felsenfest zu bleiben?
Überzeichnet wie eine Comicfigur
Ein Deutungsansatz des Films besagt, dass dieser Heino sich zu einer Art Comicfigur habe stilisieren lassen, alles an ihm sei auf gewisse Weise übersteigert – das Blonde, das Deutsche, das Heimattreue; auch die monströsen Sonnenbrillen, die er als Markenzeichen weiter trug, als seine Augenkrankheit längst geheilt war. Just dieses Übertriebene zog wie von selbst den Spott auf sich – bis hin zum berühmten Gruft- und Zombie-Auftritt eines erschröcklich vervielfältigten Heino in „Otto – der Film“.

Vaterlos aufgewachsen: Kindheitsbild aus der frühen Nachkriegszeit mit Mutter Franziska und Schwester Hannelore. (© ZDF/Privatbesitz Heino)
Längst ist Heino souverän und selbstironisch genug, um beispielsweise Cover-Versionen alter Rocksongs zum Besten zu geben oder auch mit den Brachial-Typen von „Rammstein“ gemeinsam aufzutreten – und das vor 80.000 Hardrock- bzw. Metal-Fans beim Wacken Open Air. Natürlich steckt aber vor allem geschicktes Marketing hinter derlei forcierten Crossover-Bestrebungen. Heinos Karriere, die schon zu verblassen schien, lebte damit noch einmal kultverdächtig auf.
Ärmliche Kindheit in Düsseldorf
Der Film blendet auch weit zurück zu den Anfängen – in die recht ärmliche, vaterlose Düsseldorfer Kindheit, zur nicht so sehr geliebten Bäcker- und Konditorlehre, zu den ersten Auftritten mit dem Trio OK Singers. Um die schmale Kasse aufzubessern, mussten Heino und seine Mitstreiter anfangs auch schon mal im Hafen Säcke schleppen oder sich auf dem Schrottplatz verdingen.
Der Durchbruch kam 1965 in Quakenbrück. Dort traf Heino den Schlagersänger und Produzenten Ralf Bendix („Babysitter-Boogie“), der ihn allmählich zum unverkennbaren Markenzeichen formte. Heino machte demnach widerspruchslos alles, was Bendix wollte. Und tatsächlich: Alsbald hatte Heino sein frühes Vorbild Freddy Quinn nicht nur erreicht, sondern auch überflügelt, was die Verkaufszahlen anging. Spätere Bilanz: 50 Millionen abgesetzte Tonträger in Deutschland, dazu ein Bekanntheitsgrad von angeblich 98 Prozent.
Wenn er so sein Bankkonto betrachtet…
Der junge Heino wurde von Bendix gezielt als Kontrastprogramm zur Beat-Musik und zu den nachfolgenden Richtungen aufgebaut – mit der schwarzbraunen Haselnuss, dem blau, blau, blau blühenden Enzian und allem volltönenden Karamba Karacho. Ihr wisst schon: diese manchmal arg dröhnenden Klänge fürs tümliche oder tümelnde Volk.
Finanziell sollte er das alles nicht bereuen. Wenn er so sein Bankkonto betrachte, sinniert der in der Eifel lebende Heino nun rückblickend im Film, dann habe er wohl alles richtig gemacht. Doch das ist eine gewagte, wenigstens einseitige Schlussfolgerung. Denn es liegen, wie der Film gleichfalls verrät, auch einige Schatten auf seiner Familiengeschichte. Alles hat seinen Preis…
In der Mediathek ist der ZDF-Film „Mensch Heino! Der Sänger und die Deutschen“ noch für ein Jahr abzurufen – bis zum 10. Dezember 2019.