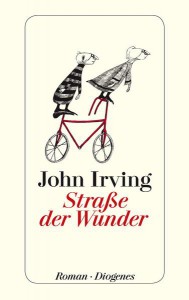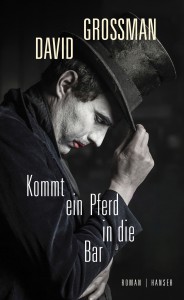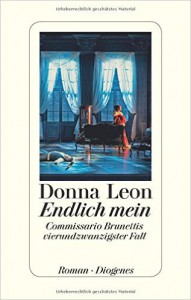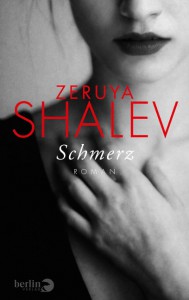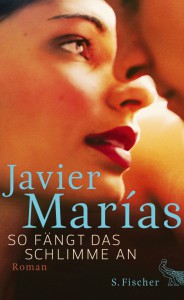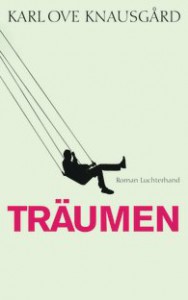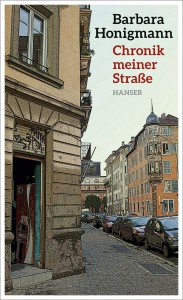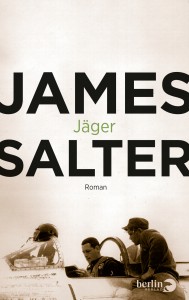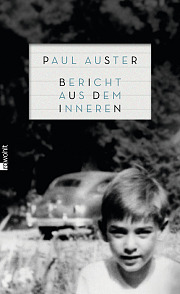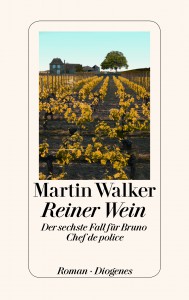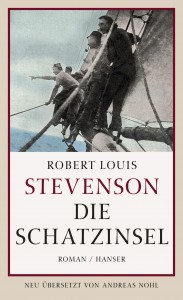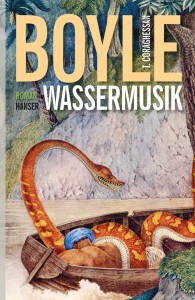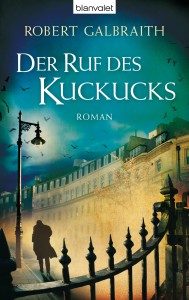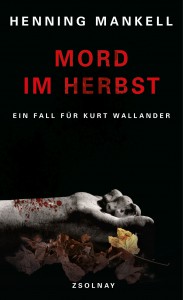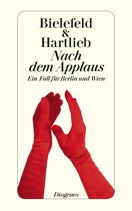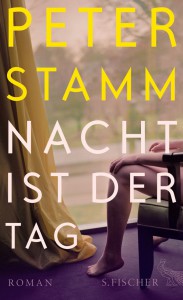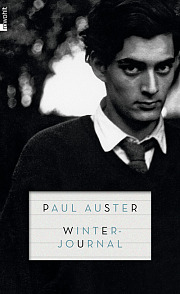Eine schier endlose Strecke der Selbstzitate – John Irvings Roman „Straße der Wunder“
Juan Diego, dessen Mutter eine Prostituierte und dessen Vater unbekannt ist, lebt zusammen mit seiner Schwester Lupe auf einer Müllkippe in Mexiko. Der Junge rettet dort Bücher vor dem Verbrennen, bringt sich das Lesen und Schreiben selbst bei und zieht dann das große Los: Er wird von der großherzigen transsexuellen Hure Flor und ihrem schwulen Liebhaber, dem ehemaligen katholischen Priester Edward, adoptiert und mitgenommen in die USA.
Aus dem ehemaligen Müllkippenkind wird in Iowa City, dem Dorado für „Creative Writing“ und angehende Autoren, ein weltberühmter Schriftsteller und angesehener Literaturprofessor. Allerdings ist Juan Diego frühzeitig gealtert, ist Mitte 50 und sieht aus wie Mitte 60, leidet unter Herz- und Erektionsproblemen, nimmt Betablocker und Viagra wild durcheinander. Das verschafft ihm zwar einige aufregende erotische Erfahrungen, aber auch einige körperliche Ausfälle, vor allem auf der Flugreise auf die Philippinen, die er unternimmt, um ein altes Versprechen einzulösen und den Soldatenfriedhof amerikanischer Gefallener aus dem Zweiten Weltkrieg zu besuchen.
Auf dieser wunderlichen Reise lernt er nicht nur die geisterhaften Literatur-Groupies Miriam und Dorothy kennen, die ihn zu erotischen Höchstleistungen treiben, er verfällt auch in komatöse Zustände und alpträumt sich durch sein abenteuerliches Leben.
John Irving beherrscht dieses Changieren zwischen Erlebtem und Erinnertem, zwischen Wunder und Wirklichkeit, Geist und Gosse, Kirche und Katastrophe. Hier ist er auf seinem ureigenen Terrain und schlägt mit skurrilem Humor erzählerische Salti zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Versuchung und Verlust, Tod und Trauer.
„Straße der Wunder“ ist der 14. Roman des 1942 in New Hampshire geborenen und heute im kanadischen Toronto lebenden Erfolgsautors, der für die Drehbuchadaption seines Romans „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ einen Oscar bekam.
Im neuen Roman geht es um Realität und Imagination, Wunsch und Wirklichkeit, Wunderliches und Wundersames. Denn Irving und seine Hauptfigur Juan Diego haben beide eine Obsession für das absurd Unerklärliche, den bizarren Zufall und das Neben- und Durcheinander von schnöder Wirklichkeit und schönem Schein. Eine Heiligen-Statue, die Tränen der Rührung weint, ein seltsames Mutter-Tochter-Gespann, dessen Abbild man nicht im Spiegel sehen kann, ein Mädchen, das die Gedanken anderer Menschen und sogar der Tiere lesen kann – die Liste der wundersamen Menschen und Ereignisse im Roman ist lang.
„Straße der Wunder“ ist eine Art „Meta-Roman“, Irving variiert ironisch einige seiner bekannten Themen und Topoi: Dass die Hauptfigur ein Schriftsteller ist, ein Einzelgänger, Außenseiter, Waisenkind, das kennen wir von Irving. Dass Juan Diego mehrfach aus Romanen zitiert, die der Kenner als Irving-Bücher dechiffrieren kann, ist ein neckisches Spiel.
Dominante Frauen, abwesende Väter, tragische Unfälle, Transsexualität, Aids, Glaube und Aberglaube: alles alte Irving-Themen. Wieder – wie in „Zirkuskind“ – werden wir, wenn Juan Diego sich als Hochseilartist versucht, in die Manege entführt. Die Gedanken lesende Lupe erinnert an „Owen Meany“; Transvestit Flor könnte auch im „Hotel New Hampshire“ logieren; Müllkippenarzt Dr. Vargas wäre auch in „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ gut aufgehoben; und wenn die Zirkuslöwen einem Mädchen das Genick durchbeißen und einen Dompteur zerfleischen, erinnert das an „Die vierte Hand“. Nur ein klassisches Irving-Motiv kommt nicht vor: der Bär. Kein Bär wird nieder gerungen und kein Mensch wird für einen Bären gehalten.
Und sonst? Es gibt ein paar irrlichternde, schillernde Figuren und furios ausgemalte Handlungen. Aber dass der wahre Lesegenuss sich nur dem erschließt, der auch andere, am besten alle Irving-Romane kennt, ist doch etwas hochmütig. Die Erzähl-Konstruktion vom immer wieder weg dösenden und sich schlafend auf Erinnerungsreise begebenden Schriftsteller ist auf Dauer etwas banal.
Zu viele Erlebnisse und Erinnerungen werden zu oft wiederholt. Zu oft auch werden spanische Wörter und Sätze eingestreut und (in Klammern) ins Deutsche übersetzt. Zu oft muss Schriftsteller Juan Diego sagen, was Irving schon in unzähligen Interviews gesagt hat: dass Frauen die wahren Leser und Männer Literaturmuffel sind.
Und zu oft betreibt Irving durch den Mund von Juan Diego „Journalisten-Bashing“: Journalisten sind für Irving alias Juan Diego bei Autoren-Interviews grundsätzlich schlecht vorbereitet und lesen die Romane nicht, über die sie dann kritische Artikel schreiben: nichts als gähnend langweilige Journalisten-Klischees, die den eher mittelmäßigen Roman des zunehmend zu Weitschweifigkeit und Geschwätzigkeit neigenden Irving nicht aufbessern. Ein kritischer Lektor hätte dem Roman gutgetan.
John Irving: „Straße der Wunder“. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Hans M. Herzog, Diogenes Verlag, Zürich. 777 S., 26 Euro.