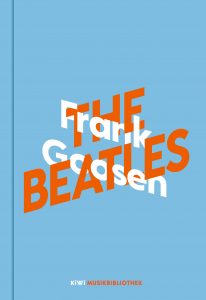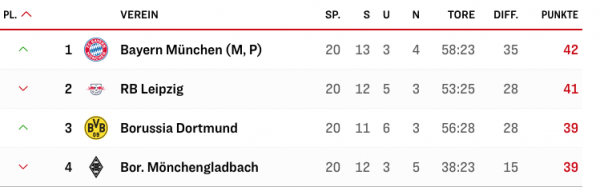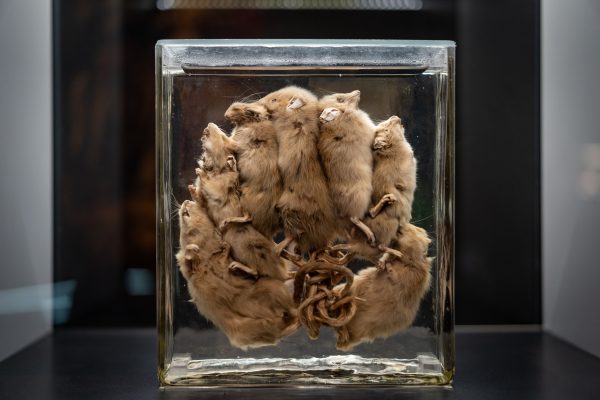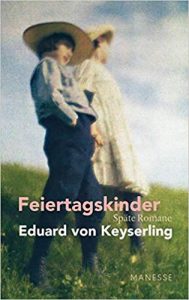Bloß nichts Erzählendes zeigen – eine Werkschau von Jobst Tilmann im Kunstmuseum Ahlen
So kann’s gehen, wenn ein Künstler seine Retrospektive weitgehend selbst kuratiert: Der heute im ostwestfälischen Wiedenbrück lebende Jobst Tilmann (70) hat binnen zwei Jahren aus einem Fundus von rund 4000 Arbeiten fast 200 für die Werkschau im Kunstmuseum Ahlen ausgewählt – und sich dabei rückblickend die strenge Kernfrage gestellt: „Habe ich mein Leben verplempert?“ Oder ist Haltbares entstanden? Tilmanns trockene Bilanz nach der intensiven Selbstbefragung: „Es ist gut ausgegangen.“
Ausgegangen? Nicht im Wortsinne eines Aufhörens. Tilmann hat nach eigenem Bekunden „noch einiges vor“. Und seine Werkschau heißt ja auch vielsagend „Anfang ohne Ende“. Tatsächlich sind im Laufe der rund 35 Schaffensjahre, die diese Retrospektive umfasst, immer wieder Neuanfänge und neue Orientierungen zu erkennen. Von „Nullpunkt“ und „Reset“ an bestimmten Punkten seiner Biographie spricht der Künstler selbst. Doch es scheint auch so, als sei er sich und seiner Vorgehensweise durch all die Jahre letztlich treu geblieben. Oder mit der Zeit treu geworden, wenn man so sagen darf.

Wo der Blick des Betrachters zunächst einer Irrfahrt (wie einst bei Odysseus) gleicht: Jobst Tilmanns Bild „Ulysse“ (2008), Acryl auf Leinwand. (© VG-Bild Kunst, Bonn 2020)
Grundsatzentscheidung nach Gusto: Wer durch den Haupteingang das Museum betritt, somit von unten kommt und dann aufwärts geht, bewegt sich von neuesten Arbeiten bis in die 1980er Jahre zurück. Wer es lieber chronologisch vorwärts möchte, muss eben oben im zweiten Stockwerk beginnen. Das musste jetzt erst mal gesagt sein.
„Ich bin kein Malschwein“
Eine frühe Tätigkeit als „Kunsterzieher“ (Tilmann spricht das Wort beinahe angewidert aus) hat er rasch beendet und sich alsbald als freier Künstler eingerichtet, anfangs im zeitlichen Kontext der malwütigen „Jungen Wilden“, denen er sich freilich nie anschließen mochte. „Ich bin kein Malschwein“, stellt er unmissverständlich klar, einen ironischen Begriff jener Jahre verwendend, der ungefähr so klingt wie „Rampensau“ im Theaterwesen. Tilmann ist hingegen einer, der denkend, wenn nicht gar mitunter grübelnd zu Werke geht und fleißig an künstlerischen Problemen arbeitet. Man müsse in solchen Dingen konsequent sein und dürfe sich „keine Tricks“ gestatten, sagt er. Und außerdem: „Ich bin eben Niedersachse. Und Protestant.“ Aha.
Nach einem Kunststudium in Hannover und ersten, gar nicht mal erfolglosen Künstlerjahren mit Atelier in Springe/Hannover, hat Tilmann zu Beginn der 1980er Jahre gleichsam alle Brücken zum bis dahin geführten Leben abgebrochen – familiär und beruflich. Es war eine grundlegende Neuorientierung. Er zog bzw. es zog ihn 1982 nach Südfrankreich, in einen abseits der Touristenströme gelegenen Winkel der Provence, nach St. Restitut. Anderes Klima, andere Farben, anderer Menschenschlag. Als Künstler wecke man dort – auch in der einfachen Bevölkerung – ein wesentlich größeres Interesse als in Deutschland, befindet Tilmann. Sehr schnell habe er sich in der südfranzösischen Kunstszene vernetzen können.
Anregung durch Steinformationen
Eine wichtige Anregung waren seinerzeit die unterirdischen Steinbrüche der Region. Die in den Stein eingezeichneten Linien und Schnitte haben ihn fortwährend beschäftigt, auch hat er sich bis heute eine Neigung zum lichten Grau als einer Hauptfarbe bewahrt. Beides deutet nicht auf farblichen oder formalen Exzess, sondern eher auf Minimalismus hin. Tatsächlich fällt dieser Begriff gelegentlich, wenn von Tilmanns Werk die Rede ist. Doch natürlich verhält es sich vielfältiger, uneindeutiger und komplizierter. Jobst Tilmann selbst kann (anders als so manche seiner Berufskollegen) ausführlich, wort- und gestenreich über Beweggründe und Triebkräfte seiner Kunst sprechen.
Sein Weg führte jedenfalls früh weg vom abbildhaften Realismus, hin zur entschiedenen Gegenstandsferne. Dem Begriff „Chaos“ kann Tilmann wenig abgewinnen, das sei nur ein hilfloses Wort für den Fall, dass wir etwas nicht begreifen und durchdringen. Tatsächlich walte im Chaos eine höhere Ordnung. Spontane Einfälle und Assoziationen (Sieht z. B. dies oder jenes Bild nicht aus wie eine Landkarte?) lässt er gelten, doch diese Sichtweise solle man möglichst schnell hinter sich lassen. Die Bilder sprächen durchaus für sich – ohne zusätzliche Sinnstiftung. Auch gebe es dafür keine Vor-Bilder in der Natur. Allerdings verlangten seine Arbeiten eine gewisse Einlässlichkeit und Zuwendung seitens der Betrachtenden. Welche Künstler würden sich das nicht wünschen?
Einhegung und Freisetzung
Auch „Themen“ sind bei Tilmann nicht gefragt, viele Bilder tragen keine Titel – und falls doch, dann manchmal eher belustigt klingende, nicht ganz ernst zu nehmende („Besserwisser“). Generell gilt: bloß nichts Erzählendes, bloß kein „Narrativ“. Stattdessen: stringente und strikte Arbeit an künstlerischen Problemen, ein nicht nachlassendes Bemühen, das oft genug ins Grundsätzliche mündet: Was ist überhaupt ein Bild? Wie kann man es aufbauen? Hat da jemand L’art pour l’art gesagt, also Kunst um der Kunst willen? Ganz falsch wäre es nicht.
Ein Strang, der sich durchs gesamte Werk in all seiner Vielfalt zu ziehen scheint, ist der beständige Wechsel zwischen Einhegung und Freisetzung von Formen. Der Spannungsbogen reicht von nahezu „mathematisch“ anmutenden Arbeiten bis hin zur tänzerischen Leichtigkeit. Nimmt das Eine überhand, wird das Andere bekräftigt. Und bald wieder umgekehrt. Oder es treten neue Elemente hinzu, wie in einer Phase die sogenannten „Störenfriede“. Das sind beispielsweise rundliche, klopsartige Formen, die den vorherigen Liniengerüsten etwas Spontanes und Eigenwilliges entgegensetzen. Und überhaupt: Sobald eine Reihe von Bildern gar zu „seriell“ zu geraten droht, sobald dem Künstler die Formalien allzu „beherrschbar“ und regelhaft erscheinen, braucht es wieder einen Entschluss und eine verändernde Tat.
Bei all dem kommt die Bewegung des Künstlers vor Leinwand und Papier, also das Gestische, wohl immerzu ins Spiel. Man muss nur sehen, wie Tilmann sich erklärend vor seinen fertigen Bildern bewegt, dann kann man sich den eigentlichen Malvorgang ein wenig vorstellen. Es ist, als würde er sich erläuternd noch einmal ans Werk begeben.

Um die Ecke gemalt: Ausstellungsansicht von Jobst Tilmanns Bild mit dem Titel „Besserwisser“, der freilich gar nichts über Machart und Texturen des Bildes besagt. (Foto: Bernd Berke)
Was sich aus dem „Sumpf“ erhebt
Ein neueres Verfahren besteht darin, anfangs eine Art urtümlichen farblichen „Sumpf“ (Tilmann) herzustellen, zuweilen auch mit Wischfeudel aufgetragen oder aus Eimern hingegossen. Daraus erwüchsen wie von selbst durchaus schöne Bilder. Aber: „Schöne Bilder interessieren mich nicht.“ Also ist es erst der Beginn. Hernach wird vorzugsweise jenes lichte Grau begrenzend eingesetzt, um aus den vorherigen Farbverläufen einzelne Formen (der Künstler nennt sie „Protagonisten“) individuell hervorzuholen. Es sei recht eigentlich keine Konstruktion, sondern es ergebe sich, wenn man die Formen in ihrem Eigenwert aufspürt und ihnen nachgeht.
Damit nicht genug: Im weiteren Prozess entsteigen just einige dieser Formen den Bildern und werden zu Skulpturen. Auch so eine Befreiung, eine Freilassung aus dem Bildgeviert. Ganz anders, gleichsam selbst-bewusster hängen diese Figurationen nun im Raum. Mit des Künstlers Worten eher philosophisch ausgedrückt: Es seien „neue Entitäten“ entstanden, es sind also – mag man paraphrasieren – neue Wesenheiten in die Welt geraten. Willkommen im Museum.
Tilmanns französische Zeit ist übrigens seit 2002 passé. Anno 2000 erhielt er einen Ruf an die HAWK (Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst) in Hildesheim. Da merkte er im Hinblick auf seine etwas älteren Tage, dass er denn doch im Hannoverschen besondere Heimatgefühle verspüre. Aus Ostwestfalen hat er’s ja nicht so weit dorthin.
Jobst Tilmann: „Anfang ohne Ende“. Kunstmuseum Ahlen, Kreuzung Museumsplatz 1 / Weststraße 98. Vom 8. März bis zum 24. Mai. Mi/Do/Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Feiertage 11-18 Uhr, Mo/Di geschlossen. Begleitbuch 30 Euro.