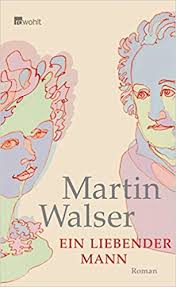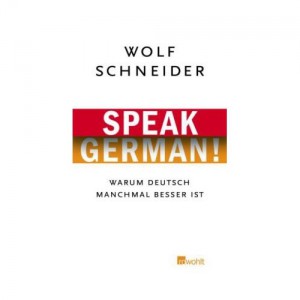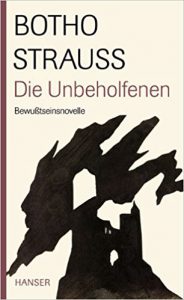Was darf uns die Kultur denn kosten? – Debatte um die Finanzen der Kulturhauptstadt
Alter Streit, der sich immer mal wieder entzündet: Wieviel Geld sollen „wir” für Kultur ausgeben? Genügt das, was die öffentliche Hand bezahlt – oder sollten Bürger, die es sich leisten können, freiwillig etwas drauflegen? Derzeit rankt sich die Debatte um die Finanzen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010.
Als neulich in Düsseldorf die Förderbescheide des Landes NRW fürs „Dortmunder U” (Ex-Brauereiturm, künftig Museum und Zentrum der Kreativwirtschaft) überreicht wurden, gab’s neben aller Freude auch viele kritische Stimmen, so etwa im Internetportal http://www.derwesten.de/. Grundzug so mancher Äußerungen: Lieber Straßenbau, Schulen, Kindergärten und Schwimmbäder finanzieren – oder Hartz IV aufstocken . . .
„Hände weg
von meiner
Geldbörse!”
Gegen solch dringlichen Alltagsbedarf befindet sich Kultur seit jeher in der Defensive. Stets muss sie ihre finanziellen Ansprüche gut begründen und legitimieren, was ja völlig in Ordnung ist. Doch etliche Politiker sind auf diesem Ohr fast gänzlich taub. Denn massenhaft Wählerstimmen kann man mit den schönen Künsten nicht einheimsen. Eine kurzsichtige Art der Betrachtung.
Und so erntete denn auch Essens Stadtkämmerer Marius Nieland beileibe nicht nur Beifall, als er kürzlich vorschlug, jeder Bewohner des Reviers möge aus freien Stücken je einen Euro für die Kulturhauptstadt Ruhr spenden, deren Kassen bislang eher spärlich gefüllt sind. Die Reaktionen glichen im Großen und Ganzen jenen aufs „Dortmunder U”. Motto: Hände weg von meiner Geldbörse! Ja, es ist eine schwierige Gemengelage.
Nielands Idee ist ja an und für sich sympathisch, sie könnte Phantasien beflügeln. Aber ist sie nicht auch ein Blütentraum? Selbst Amtskollegen aus anderen Revierstädten bleiben skeptisch. Wie, bitte, soll das funktionieren? Per Überweisung? Mit Sammelbüchse an der Haustür? Mit Sparschweinen, die in den Rathäusern aufgestellt werden? Und: Ein Euro ist „gefühlt” nicht gleich ein Euro. Manche nehmen ihn aus der Portokasse, andere müssen ihn sich absparen.
Zudem kalkuliert Nieland ohne weiteres mit 5,4 Millionen Bewohnern (bzw. Euro) – vom Neugeborenen bis zur Hundertjährigen; von „kulturferneren” Menschen gar nicht zu reden. Größere Familien würden demnach rein rechnerisch mehr berappen, denn pro Kopf wäre ja ein Euro fällig. Wäre das gerecht?
Schnellere und stärkere Wirkung ließe sich erzielen, wenn sich mehr potente Sponsoren aus der Wirtschaft fänden. Fritz Pleitgen und Oliver Scheytt, die Geschäftsführer der Ruhr 2010 GmbH, arbeiten daran. Man kann ihnen nur Erfolg wünschen.
Mit Steuern und Abgaben finanzieren die Bürger ohnehin schon die Kulturhaushalte. Freilich: Die gesamten Kulturausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden machen nicht einmal 0,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus – rund 8 Milliarden Euro stehen jährlich zu Buche. Man darf schon fragen, ob dies für eine Kulturnation nicht beschämend geringe Werte sind.
Doch auch da gibt’s wieder Gegenpositionen, die sich untermauern lassen: Es gibt wohl kein anderes Land auf Erden, das eine so dichte kulturelle Infrastruktur hat wie Deutschland. Ungefähr jedes siebte Opernhaus weltweit steht bei uns. Kulturschaffende haben sich vielfach an namhafte Subventionen gewöhnt. Jede Kürzungsabsicht zieht daher einen Aufschrei („Kahlschlag!”) nach sich.
An dieser Stelle folgt in Debatten rasch der Ausruf: Und das alles für eine betuchte Minderheit? Nun, das wäre zu engstirnig gedacht. Man stelle sich die Städte ohne Theater, Opern, Museen und Bibliotheken vor. Es wären öde Kommerz-Wüsten. Ausgaben für Kultur erweisen sich in aller Regel als sinnvolle Investitionen. Viele Euros fließen in die Städte und Gemeinden zurück. Es kommen mehr Touristen und Tagesgäste, die Geld ausgeben – nicht nur an der Theaterkasse. Und schließlich konkurrieren Betriebe und Behörden in allen Städten um gut ausgebildete, qualifizierte Mitarbeiter. Viele von ihnen lassen sich vor allem durch kulturelle Angebotsfülle locken.
__________________________________________________
INFO:
- Die derzeitige Finanzlage der Kulturhauptstadt Ruhrgebiet 2010:
- Insgesamt stehen jetzt rund 52 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld kommt aus folgenden Quellen:
- Der Regionalverband Ruhr (RVR) steuert 12 Millionen Euro bei.
- Vom Land Nordrhein-Westfalen kommen 12 Millionen Euro.
- Der Bund schießt 12 Millionen Euro zu.
- Die Stadt Essen ist mit 6 Millionen Euro dabei.
- Die Europäische Union (EU) stellt 1,5 Millionen Euro bereit.
- Private Sponsorenmittel (bisher zugesagt): 8,5 Millionen Euro.
- Was können die einzelnen Städte beitragen? Vor allem die Revier-Gemeinden, die unter Sparzwängen stehen, könnten eine Aufstockung ihrer Eigenmittel bestens gebrauchen.