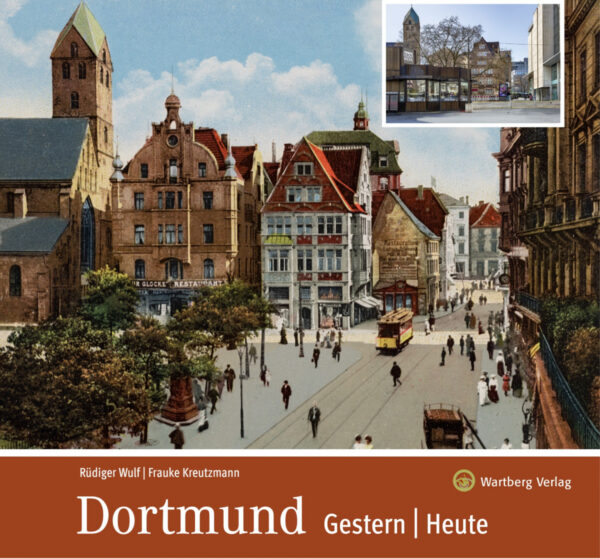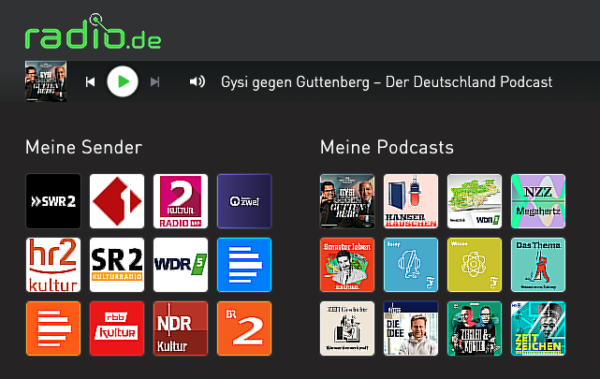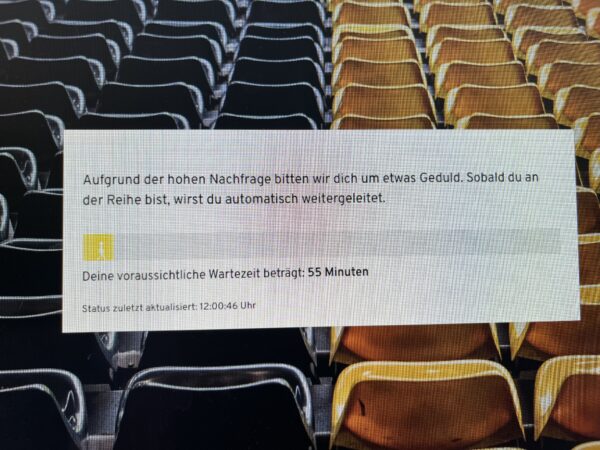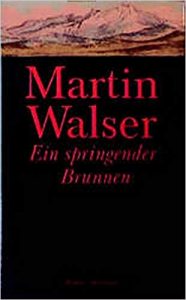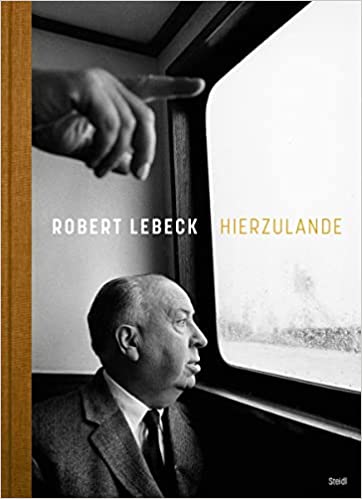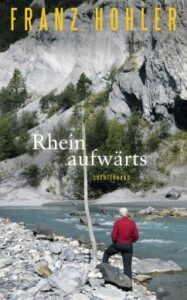Eher widerwillig mitgemacht – Borussia Dortmund zur NS-Zeit
Wie stand es in der NS-Zeit um den BVB? Hat der Verein am faschistischen Unwesen freiwillig oder eher notgedrungen mitgewirkt? Solchen Fragen, die sich keinesfalls „erledigt“ haben, widmen sich Rolf Fischer und Katharina Wojatzek in ihrem Buch „Borussia Dortmund in der Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945″.
Sie haben, so gut es angesichts der schwierigen Quellenlage nur ging, das Thema mit dem Rüstzeug der Geschichtswissenschaft eingehend recherchiert und bislang unbekannte Details zutage gefördert. Der BVB, dessen Präsident Reinhold Lunow ein Vorwort geschrieben hat, hat die Untersuchung nach Kräften unterstützt. Gut so.
Wertvolle Pionierarbeit hatte schon 2002 Gerd Kolbe mit seiner Publikation „Der BVB in der NS-Zeit“ geleistet, für die er noch zahlreiche Zeitzeugen befragen konnte. Im Sinne der zunehmend aufgewerteten „Oral History“ hat er mündlich überlieferte Quellen gesichert, die später nicht mehr zur Verfügung gestanden hätten. Darauf ließ es sich aufbauen. Inzwischen konnten aufschlussreiche Akten und Dokumente (auch Fotografien) gesichtet werden, sofern sie nicht im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurden. Erschwerend kam hinzu: Da der BVB in seinen Anfängen ein Arbeiterverein war, haben die Mitglieder weniger Schriftliches hinterlassen, als dies im bürgerlichen Umfeld der Fall gewesen wäre.
Unterschiedlich „nazifizierte“ Vereine
Um ein Fazit des neuen Buches vorwegzunehmen: Die Borussen haben sich gegen eine Vereinnahmung durch die NS-Machthaber nicht wehren können, doch hielt sich diese für längere Zeit in Grenzen. Die meisten anderen Vereine ließen sich bereitwilliger oder in vorauseilender Fügsamkeit gleichschalten. Andernorts gehörten deutlich mehr Vereinsmitglieder zugleich NS-Organisationen an, und zwar oft schon sehr frühzeitig.
Ein nachvollziehbarer Befund lautet so: Es gab Unterschiede, was den Grad der „Nazifizierung“ angeht. Schon der soziologische Hintergrund der jeweiligen Vereine gab eine Richtung vor, wobei man von etwaigen heutigen Sympathien strikt absehen muss. Demnach waren damals bürgerliche Clubs wie etwa der VfB Stuttgart, Werder Bremen (wo anfangs gar höhere Schulbildung Voraussetzung war), Alemannia Aachen oder 1860 München in aller Regel anfälliger für Indienstnahme, desgleichen die größeren Vereine in Nürnberg, Fürth und Kaiserslautern. Sie waren schnell „auf Linie“.
Bürgerliche und proletarische Milieus
Proletarisch grundierte Vereine wie der BVB (Ursprünge in den Stahlwerksvierteln rund um den Borsigplatz) oder auch Hertha BSC Berlin (Wurzeln im „roten Wedding“) waren hingegen zumindest von der Genese und vom Milieu her widerständiger, ihre Mitglieder hatten vor 1933 überwiegend KPD oder SPD gewählt. In Dortmund kam noch ein katholischer Impuls von früheren „Zentrums“-Wählern hinzu – nicht zuletzt durch polnische Zuwanderer. Allerdings konnte aus all dem kein offener Widerstand gegen das NS-Regime erwachsen. Allenfalls insgeheime Sabotage-Akte waren möglich, wenn auch sehr riskant. Eine bewegende und schließlich betrübliche Geschichte solchen Zuschnitts rankt sich um den kommunistisch orientierten BVB-Platzwart Heinrich Czerkus, der lange von Leuten im Verein systematisch gewarnt wurde, wenn die Gestapo sich näherte – bis eigens ein V-Mann auf ihn angesetzt wurde. Czerkus wurde von den Nazis ermordet.
Der BVB galt in den 1930er Jahren noch als Verein, für den man sich nur in seinem engeren Umkreis und nicht in der ganzen Stadt interessierte. Also stand er nicht so sehr im Fokus, auch nicht in dem der NS-Parteigenossen. Ganz anders der FC Schalke 04, der damals die renommierteste Mannschaft des ganzen Reichs stellte. Also ließen sich die NS-Chargen stets gern mit den „Knappen“ ablichten.
Borussia Dortmund hatte seinerzeit keine jüdischen Spieler, so dass man auch nicht gezwungen war oder gedrängt wurde, jemanden auszuschließen, wie dies bei vielen anderen Vereinen geschah – selbst bei solchen, die von jüdischen Bürgern (mit)gegründet worden waren. Kein Dortmunder Verdienst also, sondern eine Folge der Mitgliederstruktur.
Verdruckster Umgang nach dem Krieg
Erhellend auch das Kapitel über den Umgang mit dem Thema in der Nachkriegszeit. Mindestens bis zur Jubiläumsschrift von 1969 (der BVB 09 wurde damals 60 Jahre alt) muss die Haltung dazu als verdrängend, verlogen und verdruckst bezeichnet werden. In der erwähnten Broschüre wurden zwar Bilder aus der NS-Zeit gezeigt, freilich hatte man sie dilettantisch retuschiert (Übermalung von Hakenkreuzfahnen etc.) und damit „entschärft“. Es dauerte noch eine ganze Weile, letztlich bis in die späten 90er Jahre, bevor endlich offen über die NS-Verstrickungen geredet wurde – wenigstens von jüngeren Jahrgängen.
Das Buch dürfte zum Standardwerk über den BVB in jenen finsteren Zeiten werden. Zwar ist man in manchen Fragen auf Spekulationen angewiesen, doch klingen die Mutmaßungen zumeist plausibel und werden transparent ausfbereitet. Vor allem aber hat sich die intensive Quellenarbeit ausgezahlt. Im steten Wechsel zwischen Blicken aufs größere Ganze und biographische Nahansichten zeichnen Fischer und Wojatzek ein vielschichtiges Zeitbild, das auch Widersprüche und Leerstellen umfasst.
Rolf Fischer / Katharina Wojatzek: „Borussia Dortmund in der Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945″. Metropol Verlag, Berlin. 256 Seiten mit zahlreiche Schwarzweiß-Abbildungen, 24 Euro.