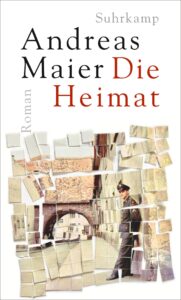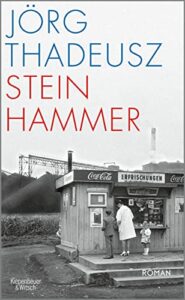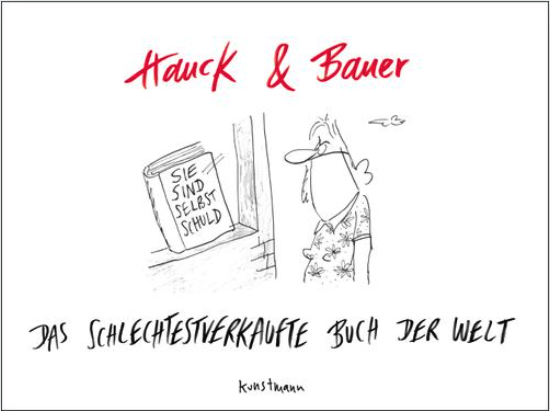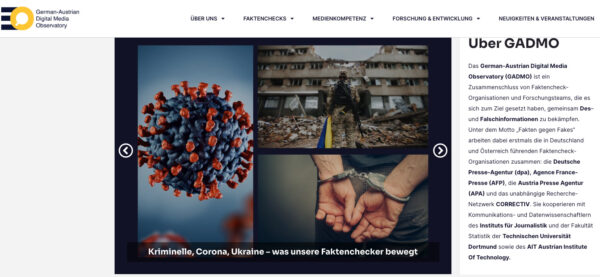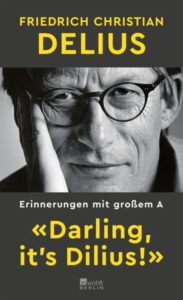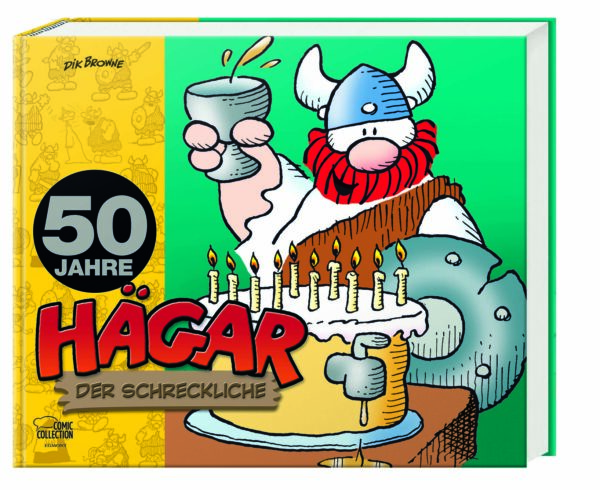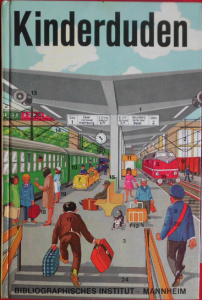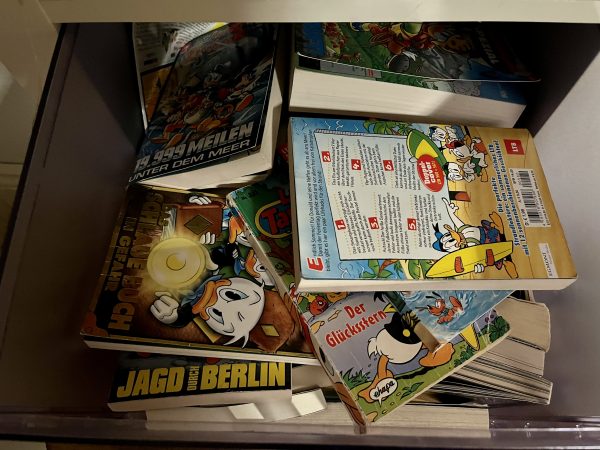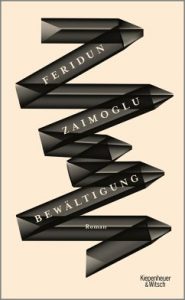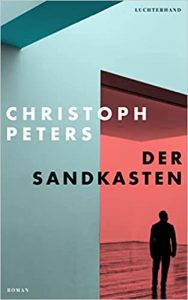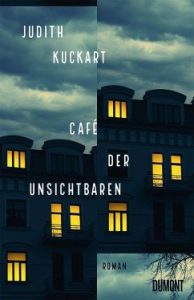Nähe, Alltag und Wirrnis – Andreas Maiers Roman „Die Heimat“
1970er Jahre in der hessischen Provinz (und eigentlich nicht nur dort): In der Grundschulklasse sitzen gerade mal zwei „Ausländer“-Kinder, ein Italiener und ein Mädchen aus Bulgarien, das im gnadenlosen Urteil der Mitwelt als „wilde Zigeunerin“ gilt. Wie lange scheint das her zu sein und wie unbegreiflich fern scheint es zu liegen! Andreas Maier muss es in seinem neuen Roman „Die Heimat“ geradezu archäologisch hervorholen. Dann aber kommt es uns doch verdammt bekannt vor.
Es folgen weitere zeittypische Szenarien: bezeichnende Vorkommnisse auf dem Schulhof; eine Schwester Adelheid, die nahezu obszön in die Kreuzigung Jesu vernarrt ist und auf entsprechend drastische Weise katholischen Religionsunterricht erteilt. Das erste italienische Restaurant im Städtchen, die Fernsehserie „Holocaust“ und der bleierne Herbst des RAF-Terrorismus sind andere Wegmarken der 70er, wie sie sich fernab der Metropolen abgezeichnet haben.
Das Puzzle ergibt ein brüchiges Bild
Tatsächlich ergibt sich aus all dem, so diffus es erscheinen mag, ein Umriss dessen, was damals als „Heimat“ nicht wirklich wahrgenommen, sondern schlicht für selbstverständlich gehalten und in seiner Vielschichtigkeit kaum begriffen wurde. Obwohl es doch bereits Irritationen und Erschütterungen gegeben hat. Die Mehrheit wollte sich eben nicht beirren lassen und sich lieber behaglich einrichten im Vorhandenen. Jaja, die Normalität.
Ein kleines Kabinettstück ist Maiers Erinnerung an die Anfänge des Fremdsprachenunterrichts in Englisch und Französisch: In der Tat grotesk, welche Weltausschnitte einem da präsentiert wurden. Wie seinerzeit die Partikel des Daseins im Englischen, so setzt sich auch das brüchige Bild der eigenen Heimat zusammen wie ein immer umfassenderes, aber nicht unbedingt deutlicheres Puzzle (worauf auch das Titelbild des Bandes abhebt, das Elvis Presley als US-Soldaten anno 1959 in Bad Nauheim zeigt), angereichert mit immer anderen Aspekten, so in Zeiten linker Bewusstwerdung eine harsche Ablehnung dessen, was dem herkömmlichen Heimatbegiff entsprach. Aber auch das war nur eine Teilansicht. Heimat sieht oft übersichtlich klein und gemütlich aus, ist aber eine große Verwirrung.
Fortschreibung des Langzeitprojekts
Maier arbeitet sich durch die 80er und 90er Jahre bis in die „Nuller Jahre“ vor. Die deutsch-deutsche Optik kommt hinzu und stellt die eigene Heimat nochmals in einen anderen Kontext, konfrontiert sie mit anderen Fragen. Irgendwann wird das Haus der Oma bezogen, wobei sich eine Art musealer, doch auch alltäglich-lebensnaher Aspekt von Heimat zeigt. Und natürlich drängt sich mit unheimlicher Macht die furchtbare deutsche Vergangenheit, medial zugerichtet, an vielen Stellen hinein, gleichsam in jede Ritze: Hitler, Hitler-Vergleiche, Hitler-Parodien. Das ganze Programm. Hingegen findet sich zu Maiers Verwunderung keine tiefer gehende Erzählung, die von den Opfern handelt, als seien die Juden damals einfach so „verschwunden“. Heimat als pechschwarzes, kaum je „aufgearbeitetes“ Phänomen.
„Die Heimat“ – übrigens dem mittlerweile 90jährigen Filmregisseur Edgar Reitz (famose Serie „Heimat“) gewidmet – ist eine erneute Fortschreibung von Andreas Maiers Langzeitprojekt, mit dem er die Gegend um Bad Nauheim, Friedberg und die Wetterau bis hin nach Frankfurt/Main von vielen Seiten her einkreist und bis ins Einzelne familiärer sowie sonstiger Verzweigungen erkundet. Damit beschert er der Region (und indirekt vielen Regionen) eine stetig anwachsende Chronik aus persönlicher, aber auch gesellschaftlich geweiteter Perspektive; ein Unterfangen, dem man mit nicht nachlassendem Interesse folgen kann.
Universelle Befunde aus der Region
Es ist ein beneidenswert detaillierter Erinnerungs-Fundus, den Maier nach und nach vor uns ausbreitet. Fast möchte es scheinen, als könnte man just in solchen Büchern „heimisch“ werden. Freilich geht Maier mit derlei Anwandlungen durchaus sanft ironisch um, konstruiert er doch als Rahmenhandlung den Bau einer Ortsumgehung, die an Friedberg vorbei führen soll. Auch so eine unscheinbare Pointe.
Hätte es nicht den wunderbaren und leider zu früh verstorbenen Peter Kurzeck gegeben, der sich in benachbarten Bezirken Hessens umgetan und höchst intensiv davon Zeugnis abgelegt hat, so würde man Maiers Projekt vielleicht als beispiellos bezeichnen. So aber gehört es wohl in Zusammenhänge, die letztlich auch den gleichfalls bewunderswerten und ebenfalls zu früh verstorbenen Wilhelm Genazino mit seinen Streifzügen durch Frankfurt geprägt haben. Zusammenhänge, die künstlerischen Eigensinn keineswegs ausschließen. Im Gegenteil. Je genauer sie ihre „Heimat“ auf je besondere Weise angeschaut haben, umso universeller und existenzieller erscheinen ihre Befunde. Ob das auch zum Tragen kommt, wenn es in andere Sprachen übersetzt wird?
Andreas Maier: „Die Heimat“. Roman. Suhrkamp. 245 Seiten, 22 Euro.
Vorherige Romane aus dem Zyklus waren u. a.: „Das Zimmer“ (2010), „Das Haus“ (2011), „Die Straße“ (2013), „Der Ort“ (2015), „Der Kreis“ (2016), „Die Universität“ (2018) und „Die Familie“ (2019).
_________________________
P. S.: Da gegen Schluss des Beitrags Wilhelm Genazino erwähnt wird, hier noch ein Hinweis auf eine sehr empfehlenswerte Neuerscheinung aus seinem Nachlass (übrigens kein Rezensionsexemplar, sondern im Buchhandel käuflich erworben):
Wilhelm Genazino: „Der Traum des Beobachters“. Aufzeichnungen 1972-2018. Hanser, 464 Seiten, 34 Euro.