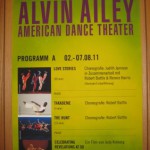Bankberater können die Welt nicht retten – Bruce Willis will’s allerdings auch nicht
 Wär schon schön, wenn man jemanden in seinem Leben hätte, der einen aus der Bredouille holt und rettet. Der ehemalige Bankberater von Tilman Rammstedt ist dieser Jemand anscheinend nicht. Dieser wäre am liebsten eine Salzstange und würde sich zu den anderen Salzstangen in den Einkaufswagen legen. Man kennt das.
Wär schon schön, wenn man jemanden in seinem Leben hätte, der einen aus der Bredouille holt und rettet. Der ehemalige Bankberater von Tilman Rammstedt ist dieser Jemand anscheinend nicht. Dieser wäre am liebsten eine Salzstange und würde sich zu den anderen Salzstangen in den Einkaufswagen legen. Man kennt das.
Das Leben ist kompliziert geworden und keiner mehr da, der es einem erklären kann. Geschweige denn, dass Tilman Rammstedt wüsste, wie der Abgabetermin seines neuen Buches einzuhalten sei. Die Idee hat er: Er dichtet dem melancholischen Bankberater einen Überfall auf seine eigene Bank an. Dieser geht natürlich grandios schief, aber wie jetzt weiter? Das hypochondrische, an der Welt leidende Alter Ego Tilman Rammstedts kommt auf die nahe liegende Lösung: Hollywood. Dort sind sie doch zu finden, die Weltenretter – und wer könnte besser geeignet sein als der Experte für sechste Sinne und langsames Sterben, Bruce Willis, um in die Rolle des Bankberaters zu schlüpfen und dessen Schieflage zu begradigen? Beflügelt von seinem Lösungsansatz, setzt Herr Rammstedt sich an die Tasten und hackt ellenlange Mails an Herrn Willis hinein. Er bedrängt den Filmstar, umschmeichelt ihn, fleht und bettelt, wird zeitweilig beleidigend und nötigend. Bruce Willis jedoch antwortet nicht und Rammstedt beginnt zu fürchten, dass er sein Buch umbenennen müsse in „Die Abenteuer des Bruce Willis, die abrupt endeten, als er von einer Harpune durchbohrt wurde, weil er sich zu fein war, auch nur eine einzige Mail zu beantworten“
Tilman Rammstedts neues Werk Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters besteht aus diesen Emails, die sich mit Erinnerungen an seinen mittlerweile ehemaligen Bankberater abwechseln. Dieser Bankberater kennt zumindest die halbe Wahrheit und langsam beginnt Rammstedt einzusehen, dass dies doch so wenig gar nicht ist. Denn „das meiste war schließlich einfach und der Rest nicht so schwer„: Ein Baum ist wie ein Festgeld. Es muss fest stehen und langsam wachsen. Nicht mehr und nicht weniger.
Der Bankberater steht dabei symbolisch für jeden, der beratend tätig ist und von dem die Leute erwarten, dass sie ihnen die Welt erklären, auch wenn das längst niemand mehr kann. Es hätte auch ein Steuerberater sein können, aber bei diesen lohnt es sich vielleicht nicht so sehr, wenn sie die eigene Kanzlei überfallen. Wer sich beim Titel des Romans Insiderwissen zur Finanzkrise erwartet hat, liegt völlig falsch. Dieses Thema kann man sich allenfalls dazu denken, man kann es aber auch lassen. Denn das ist nicht das Thema des Tilman Rammstedt. Genauso wie das Buch nichts mit Katzen zu tun hat, auch wenn eine auf dem Cover thront. Die Katze steht allenfalls für den toten Hund, der im Zweifel eine größere Hilfe ist als der Actionstar. Wen das irritiert, dem sei gesagt, das lernt man direkt als Anfänger bei jedweden sozialen Medien. Ohne sogenannten „Cat-Content“ und Banken-Bashing geht heutzutage fast nichts mehr.
In diesem Buch findet sich ein ganzes Konglomerat derzeit erfolgreicher Literaturprinzipien. (Briefroman, die direkte Ansprache von Ikonen der Popkultur und Metafiktion – die Thematisierung von Fiktion der Geschichten und Charaktere). Vor allem das Prinzip der Metafiktion reizt Rammstedt bis zum Äußersten aus. Er schaltet sich nicht nur gelegentlich ein, sondern ist klar erkennbar der Ich-Erzähler, welcher von der Schwierigkeit berichtet, aus einer guten Idee einen Roman zu machen. Gerade, wenn der Abgabetermin näher rückt und Bruce Willis immer noch nicht geantwortet hat. Er tut dies nicht mitleidheischend, sondern durchaus gewitzt. Es ist ein großer Lesespaß, wenn er dem stummen Willis damit droht, jederzeit Hubschrauber auffliegen lassen zu können oder wenn er seinen eigenen Verlag inständig bittet, ihm aus dem gut bestückten Verlags-Fundus doch bitte ein Buch zukommen zu lassen, in dem ein Gefängnisausbruch erklärt wird.
Die Emails haben deutliche Längen, da gerät der Autor gelegentlich ins Schwafeln. Doch die Einschübe mit den Erinnerungen an den Bankberater und dessen traurige Parabeln sind bei aller Lakonie sprachlich ungeheuer dicht und ausgefeilt. Bei aller Überspitzung ist Rammstedt da sehr nahe dran an der Realität.
Der Ausgang der Abenteuer bleibt ungewiss. Auf Seite 155 weiß Tilman Rammstedt noch nicht, an welcher Stelle der Geschichte er sich befindet. Auf Seite 999 verabschiedet er sich und wünscht Bruce Willis viel Glück. Leider haben es die Seiten 156-998 nicht mehr ins Buch geschafft und es bleibt somit der Phantasie des Lesers überlassen, ob Rammstedt sein so sehnlich erwünschtes glückliches Ende bekommt. Vielleicht hat er ja sogar statt Hollywood das Ruhrgebiet um Hilfe gebeten und Helge Schneider gefragt. Diesen hatte nämlich ich dauernd vor Augen, wenn es um den Bankberater ging. Warum auch immer.
Sicher hätte Helge sich gemeldet und sehr wahrscheinlich wäre ihm auch etwas eingefallen. Auf jeden Fall hätte er verstanden, dass man „manchmal ein Ziel erst hinter sich lassen muss, um es zu verstehen.“ So bleibt neben diesen Ungewissheiten noch die Frage offen: Werden wir je wieder einen Bruce-Willis-Film sehen können, ohne daran denken zu müssen, dass dieser Tilman Rammstedt im Stich gelassen hat?
Tilman Rammstedt: „Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters“. DuMont Verlag. 999 156 Seiten, €18,99.