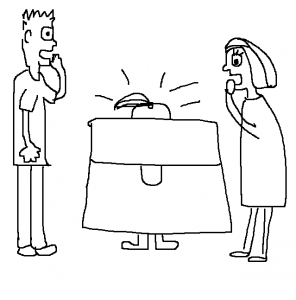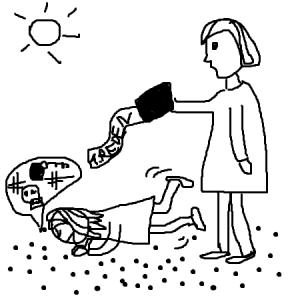Familienfreuden XXX: Das leuchtende Fest

Weihnachten – ein leuchtendes Fest für die Familie. Zu diesem besonderen Anlass gibt es einen künstlerischen Gastauftritt von Fi, die dieses Bild gemalt hat.
Rituale – das klingt mit dem rollenden „R“ vorneweg ein wenig altbacken. Und trotzdem gibt es für mich gerade zur Weihnachtszeit ein paar, die mir lieb sind. Nicht von ungefähr wünsche ich auf meinen Weihnachtspostkarten oft ein „leuchtendes“ Fest.
Der erste Advent ist so etwas wie der Weckruf für mich. Dieses Jahr, das muss ich zugeben, hätte ich ihn allerdings beinahe verschlafen. Der 27. November erschien mir innerlich irgendwie zu früh. Aber als mir die Menschen im Supermarkt unisono ein schönes Adventswochenende wünschten, wusste ich, was die Stunde geschlagen hatte. Schnellen Schrittes und mit entschlossener Miene ging ich unverzüglich in den Keller – in einem Michael Bay-Film wäre es Zeit für eine Zeitlupe mit hochschießenden Flammen im Hintergrund kurz vor dem Finale gewesen. In unserem Kellerregal drängen sich mittlerweile diverse große Kisten, prall gefüllt mit unserem Weihnachtsschmuck.
Ein Anfall von Energiespardrang
Zielgerichtet zog ich den Beutel mit den Lichterketten heraus und wühlte darin. Letztes Jahr hatte ich in einem Anfall von Energiespardrang eine Außenfestbeleuchtung mit Mini-Solarpanel erstanden. Jetzt rammte ich sie neben unseren Kirschbaum und balancierte wackelnd auf einem Tritt, um die Lichter einigermaßen gleichmäßig über die Äste zu verteilen. Mit Abstand betrachtete ich mein Werk. Das kleine Plastik-Panel und die im Wind baumelnden, dunkelgrünen Kabel ergaben nicht gerade ein elegantes Bild – aber im Dunkeln würde das sicher ganz anders aussehen. Nun war der große, rote Stern an der Reihe, der allerdings nur mit Steckdose zum Leuchten gebracht werden konnte. Unverzagt hängte ich ihn ebenso über den Baum und holte eine ellenlange Verlängerungsschnur, um die Meter zur Terrasse zu überbrücken.
Kabelsalat für Nager
Ich hielt inne und sah zu unseren Meerschweinchen. Hmmm… wenn die kleinen süßen, aber nicht unbedingt zu unmäßiger Reflektion neigenden Nager in unserem Garten herumrennen würden, könnten sie durchaus auf die Idee kommen, auch mal eine Kostprobe von dem Kabel zu nehmen. Keine schöne Vorstellung. Also spannte ich die Konstruktion so hoch, dass sie für unsere drei Damen aus dem Stall unerreichbar war.
Jetzt aber flott nach drinnen. Adventskranz dekorieren, Sterne aufhängen, Lichterkette um die Treppengeländer winden, Kerzenständer aufstellen… Diesmal hatte ich sogar Schneespray für die Fenster gekauft. Ich sage mal: Stylingschaum für die Haare ist nichts dagegen! Mühsam wischte ich die klebrige Masse, die zuhauf von den Schablonen abgefallen war, vom Boden. Am Ende der Deko-Attacke fühlte ich mich ähnlich erschöpft wie nach einem Halbmarathon (den ich allerdings noch nie gelaufen bin).
Schmucke Stolperfalle
Als Normen nach Hause kam, saß ich gerade nach Luft schnappend auf dem Sofa. Er sah die Sterne, die Kerzen, schmunzelte über die Schneebilder – und blickte nach draußen. „Meinst Du nicht, dass Du da eine ziemliche Stolperfalle gebaut hast, vor allem im Dunkeln?“, fragte er vorsichtig mit Blick auf mein außer Meerschweinchen-Reichweite gespanntes Kabel. „Ach Quatsch! Wir rennen doch abends sowieso nicht mehr im Garten herum“, tat ich den Einwurf ab.
Inzwischen war es dunkel geworden. Die solarbetriebene Lichterkette sprang an. Und in dem Moment fiel mir wieder ein, was ich erfolgreich verdrängt hatte: Dieses Fest der Beleuchtung war mit acht verschiedenen Modi ausgestattet: von hektischem Blinken über schnelles Hin- und Herspringen bis zu einer Art Fading. Nur, wenn man mehrfach auf einen Knopf drückte, konnte man es schaffen, dieses Feuerwerk einzufrieren und konstantes, nicht zu einem Besuch in der Augenklinik führendes Licht einzustellen. Und das J-E-D-E-N Abend aufs Neue! Ich rannte raus. Stolperte beinahe über das Kabel. Fluchte. Drückte den Knopf.
Eine einsame Kerze
Am Abend erzählte ich einer Freundin von meinem Dekowahn. Sie lachte sich kringelig. „Hast Du denn schon geschmückt?“, fragte ich. „Ach Nadine, Du kennst mich doch. Mir reicht es, wenn ich eine Kerze anzünde.“ Ich war fassungslos. Normen und Fi immerhin auch. „Wenn Du nicht schmücken würdest, hätte ich das gemacht“, meinte Normen. „Irgendwie gehört das doch zu Weihnachten.“
Eben! Und der Höhepunkt von all dem ist natürlich: der Weihnachtsbaum.
Die Erweckung
Dessen Erweckung folgt erst recht gewissen Regeln. Die erste: Lasst mich besser in Ruhe, wenn ich die Lichterketten aufhänge! Früher hat es mich gefühlte Stunden und diverse Tobsuchtanfälle gekostet, sie überhaupt auseinander zu friemeln. Aufwickeln hat dieses Problem immerhin gelöst. Bleibt noch, die Kabel so über die voluminöse Tanne zu wuchten, dass sie sich a) nicht verheddern, b) die Lichter gleichmäßig verteilt sind und c) die natürlich kaputten Lämpchen zwischendurch nicht auffallen.
Normen hält sich aus dieser Schmück-Challenge seit Jahren wohlweislich raus. Fi hingegen scheint mittlerweile ein Gespür dafür zu haben, wann sie sich wieder nähern kann. Die Lichter hingen, die Ungeduld war verraucht, die Weihnachtslieder konnten angemacht werden, die Stimmung wurde langsam festlich. Zu „Last Christmas“ – Rolf Zuckowski geht gar nicht mehr – verteilten Fi und ich unsere Lieblingskugeln: eine Kuh mit Kochschürze, einen Drachen mit Weihnachtsmütze, einen dirigierenden Frosch und, neu in diesem Jahr, einen Weihnachtsmann im Fesselballon.
Willkommen Becky!
Jetzt strahlt der Baum bunt und ein bisschen verrückt in unserem Wohnzimmer. Wir haben ihn „Becky“ getauft. Entspannt sehe ich ihn an, wie er dem Dunkel draußen ein festliches Leuchten entgegensetzt. Ich seufze und freue mich. Da bemerke ich draußen ein hartnäckiges Blinken. Die Lichterkette! Sorry, ich muss kurz raus: einen Knopf drücken!
Fi, Normen und ich wünschen allen Leser*innen der Revierpassagen frohe und natürlich leuchtende Weihnachten!
____________________________________________
(Diesen Wünschen schließen sich die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Revierpassagen selbstverständlich vollumfänglich an).