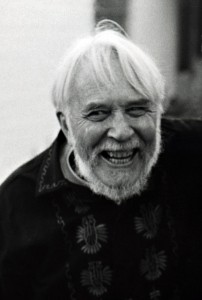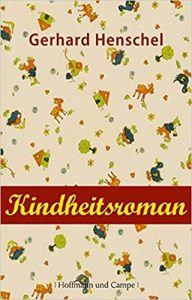Der Mann wirft einen prüfenden Blick ins Parkett des Aalto-Theaters, dreht sich um, schaut scharf in die Runde. Ruhe. Jeder Atemzug scheint kontrolliert. Spannung. Erwartung. Dann ein kurzes Anspannen der Schultern, ein Schlag – und die ersten dunklen Akkorde von Richard Strauss‘ „Frau ohne Schatten“ fluten den Raum: transparent, untergründig, mit dräuendem Nachdruck.

Stefan Soltesz. Foto: Matthias Jung
Stefan Soltesz beim Dirigieren: Das war stets eine Studie wert. Zu beobachten, wie er über den Rand seiner Brille eisblaue Blicke wirft. Zu verfolgen, wie der Finger hochschnellt, einem Sänger „Achtung“ signalisiert, im Abtauchen den Einsatz markiert. Mitzufiebern, wie er bald hundert Frauen und Männer im Orchestergraben antreibt, mitreißt, befeuert. Oder wie er mit unendlicher Geduld eine Innenspannung in der Musik aufbaut, einen schwerelosen Bogen trägt, eine Entladung vorbereitet.
Wucht und Macht: Nur sehr dosiert setzt Soltesz diese Mittel ein. Er weiß, dass sich die Riesengebärde, der massierte Klang schnell abnutzen. Gerade bei Richard Strauss, der so viele Dirigenten zu knalliger Koloristik verführt, setzt Soltesz auf Transparenz, auf Präzision, auf luftiges Acryl statt auf fettes Öl. Er hat damit einen Trend gesetzt, den andere inzwischen auch entdeckt haben. Ähnlich arbeitet er mit Partituren Puccinis: „Tosca“ oder „La Bohème“ sind bei ihm Chefstücke. Da gibt es keine hingeschmierte Kapellmeister-Routine, keine zuckersüße Opulenz. „Madama Butterfly“ gewinnt bei ihm emotionale Intensität aus einem – fast möchte man es so nennen – emotionsgedrosselten Zugang: Sehr nah am Notentext, mit allergrößter Sorgfalt gelesen.
Auch der üppige Orchesterzauber liegt ihm
Auf diese Weise setzte Stefan Soltesz am Aalto-Theater auch Vincenzo Bellinis „I Puritani“ mit einer suggestiven Qualität um, die das schnell vergebene Prädikat „einzigartig“ wirklich einmal verdient hat. Wer weiß, wie hilf- und lieblos Bellini-Opern abgewedelt werden, musste bei Soltesz ins Schwärmen geraten: So präzis, nuanciert, gleichzeitig auf die kantable Entwicklung geachtet und mitgeatmet sind die scheinbar einfachen, in Wahrheit unendlich sensiblen Notenbilder des sizilianischen Meisters selten in klingender Musik vollendet worden. Soltesz kennt nicht nur die Noten – er kennt auch die Tradition, wie sie zu lesen sind. So hat er die weiten, schwermütigen Seelenlandschaften Bellinis erschlossen,
Na gut: Auch Soltesz will sich dem Glanzvollen, dem Üppigen, der saftigen Entfaltung orchestralen Zaubers nicht entziehen. Sonst würde er Strauss nicht so lieben – obwohl er nicht als „Strauss-Dirigent“ gelten will. In der „Frau ohne Schatten“ ist er mit solchem Streben in seinem Element: Da klingen das Leuchtende und das Fahle, die schwelgerischen Aufschwünge und die harten Attacken, die sorgsam ausbalancierten Mischungen und die aggressiven Tutti. In der Wiederaufnahme im Aalto-Theater gibt es schon nach dem ersten Aufzug Bravi, nach dem zweiten Begeisterung, nach dem dritten eine herzliche, enthusiastische Ovation.

Szenenfoto aus der Inszenierung von Strauss‘ „Die Frau ohne Schatten“ am Aalto-Theater Essen. Foto: Bernd Schmidt
Das Publikum in Essen liebt den Dirigenten, jubelt ihm zu, bereitet ihm in diesen Tagen bei seinen Abschiedsvorstellungen einen herzlichen, von Zuneigung und Hochachtung geprägten Empfang. Ein Flug der Herzen. Aber auch eine Ovation, die in der Stadt merkwürdig wenig Widerhall findet: Die Frage nach der Form von Soltesz‘ Abschied nach sechzehn Jahren Intendanz in Essen, die Kabale um den Titel des „Ehrendirigenten“: seltsame, hinter vorgehaltenen Händen geführte Debatten. Es scheint zur Unkultur unserer Zeit zu gehören, dass man Menschen wie Soltesz nicht mehr mit großzügiger, freier Anerkennung verabschieden kann.
Vielleicht hat er es seinen Partner auch nicht einfach gemacht: „Mal will er, mal will er nicht“, seufzte Hans Schippmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Theater und Philharmonie, in der WAZ. Soltesz selbst hat seinen Abschied aus der machtvollen und in Deutschland seltenen Kombination des Intendanten und Generalmusikdirektors gern mit feinem Humor leichter dargestellt, als er ihm vielleicht fällt. Es ist nicht einfach, nach sechzehn Jahren äußerst erfolgreicher Arbeit in der letzten Saison den komplexen Betrieb zusammenzuhalten und bis zum letzten Tag zu motivieren.
Kämpferischer Theatermensch mit eindeutigen Positionen
Sicher: Soltesz war kein einfacher Chef, kein unkomplizierter Partner. Seine Wutausbrüche sind legendär. Dass seine Musiker auf der Stuhlkante spielen, wenn er dirigiert, ist ein offenes Geheimnis. Es gab heftige Worte, aber im Endeffekt war allen klar: Ohne Soltesz` unerbittliches und manchmal auch mit harten Bandagen durchgesetztes Regiment wäre die Qualität nicht möglich gewesen, die Essen über Häuser vergleichbarer Größe hinaushebt. Das hat dem Aalto-Theater beispielsweise 2008 das ehrenvolle Doppel des „Opernhauses des Jahres“ und des „Orchesters des Jahres“ eingebracht.
Und wer den Betrieb kennt – und der „Theatermensch“ Soltesz kennt ihn wie kaum ein zweiter – weiß, dass Koordination, Minimierung von Reibungsverlusten, aber auch der Kampf an den Fronten von Verstiegenheit oder Schlendrian aufreibend sind: Ein „netter Kerl“ erreicht da wenig. Dass er vor der Politik nicht kniff, muss man ihm hoch anrechnen. In der Debatte um die katastrophale Finanzlage der Städte und die notwendige Haushaltskonsolidierung bezog er eindeutig Position. Was er in einem offenen Brief vom 7. Januar 2010 in die Diskussion warf, ist ein ebenso schlüssiges wie notorisch nichtbeachtetes Argument:
„Die Kultur wird … zu einem Hauptverantwortlichen für die finanzielle Malaise der Kommunen gestempelt. Dass die Kultur dies nicht ist, wissen Sie genau. Selbst bei völliger Streichung der Kulturförderung wäre eine Haushaltskonsolidierung auch nicht ansatzweise erreicht. Die Staatsausgaben für Kultur in Deutschland betragen über alle öffentlichen Haushalte hinweg 0,8 Prozent der Etats. Ich appelliere daher dringend an Sie, das Thema Kultur weit hintanzustellen, wenn Sie über Haushaltssanierung diskutieren.
Als Stefan Soltesz mit der Spielzeit 1997/98 seinen Posten antrat, war noch nicht klar, mit welchem hingebungsvollen Einsatz er sich künftig seinem Stammhaus widmen würde. War er doch bereits ein Dirigent mit weitreichendem Aktionsfeld und hoher Reputation: von Hamburg bis Berlin, von München bis Amsterdam. Er brachte Leitungserfahrung mit, war in Braunschweig Generalmusikdirektor und in Antwerpen Chefdirigent. In Wien steht er seit seinem Debüt mit Rossinis „Barbiere di Siviglia“ 1983 regelmäßig am Pult, leitet in der kommenden Saison erneut den „Barbiere“ und Puccinis „Tosca“.
Entrée und Abschied mit Richard Strauss
Für Essen wählte er sich als Entrée ein Strauss-Werk, das nicht häufig gespielt und gerne gering geschätzt wird: „Arabella“. Das Publikum ging mit, erinnert sich der Dirigent, und so kam 1998 die „Frau ohne Schatten“ in der heute noch tragfähigen Regie von Fred Berndt heraus. Soltesz setzte auf Strauss: 1998, im 50. Todesjahr des Komponisten, folgte noch die Rarität „Daphne“ in einer Inszenierung Peter Konwitschnys, später „Elektra“, „Ariadne“, dann eine ehrgeizige „Ägyptische Helena“ und „Der Rosenkavalier“. Mehr Strauss gab es nicht einmal in München oder Dresden – und irgendwie ist es schade, dass ausgerechnet im Strauss-Jahr 2014 diese spezielle Essener Tradition abbricht: das sensible Alterswerk „Capriccio“ oder die Petitesse „Intermezzo“, von Soltesz dirigiert, wären das Schlagobers auf dieser feinen, reichen Tafel gewesen.

Der „Parsifal“ Joachim Schloemers in Essen. Szene aus dem ersten Aufzug im Bühnenbild von Jens Kilian. Foto: Thilo Beu
Soltesz ist ein Pragmatiker: Die großen Stücke des gängigen Repertoires gehören für ihn zu jedem publikumsfreundlichen Spielplan: Mozart, Verdi, Puccini, Wagner. In Essen machte sich Soltesz 2008 an seinen allerersten „Ring“. Seine letzte eigene Premiere war Wagners „Parsifal“: musikalisch krönender, szenisch verunglückter Schlussstein der Reihe der zehn Opern des Bayreuther Kanon, die er im Lauf der Jahre in Essen dirigiert hat. Ausgrabungen waren seine Sache nicht – auch wenn er sich einen Meyerbeer durchaus auf der Aalto-Bühne hätte vorstellen können.
Gelegentlich ließ er sich auf Ausflüge ein: Verdis „Luisa Miller“, Umberto Giordanos „Andrea Chenier“, Alexander Borodins „Fürst Igor“ oder Händels „Hercules“ kamen unter seiner Intendanz heraus – und vor kurzem zum Verdi-Jahr „I Masnadieri“ nach Schillers „Die Räuber“. Soltesz machte sich auch für Aribert Reimanns „Lear“ stark und erinnerte an Hans Werner Henzes kluge Reflexion über das Künstlerdasein: „Elegie für junge Liebende“. Dass er sich 2008 mit Christian Josts „Die arabische Nacht“ abplagte, zeigte, wie undankbar der Einsatz für Zeitgenössisches sein kann.
Alles was ist, endet, sagt Erda im „Rheingold“. Das ist für sterbliche Menschen auch gut so. Mit dem Weggang von Stefan Soltesz geht eine lange, stabile und künstlerisch fruchtbare Ära am Aalto-Theater zu Ende. Seine Nachfolger werden die Akzente anders setzen. Die Zeiten, in denen eine starke Persönlichkeit Orchester und Ensemble prägte, sind wohl auf absehbare Zeit vorbei. Gastdirigenten kommen, neue Regisseure, andere Schwerpunkte im Spielplan. Soltesz‘ Erbe ist eine Herausforderung: Das hohe Niveau will gehalten sein. Die Zuversicht ist groß, dass es gelingt.
Als Dirigent wird Soltesz dem Essener Publikum erhalten bleiben: Am 10. November leitet er die Wiederaufnahme von „Tristan und Isolde“; weitere Vorstellungen der „Zauberflöte“, des „Fliegenden Holländer“, von „La Traviata“, „Ariadne auf Naxos“ und „Madama Butterfly“ sind geplant. Seine „riesige Musizierlust“ kann er wieder außerhalb Essens ausleben – bei Gastspielen, die er zugunsten seines Stammhauses stets zurückgestellt hat. In der kommenden Saison steht er u.a. in Wien, Budapest („Der Rosenkavalier“ und „Elektra“), Warschau („Lohengrin“) und Hamburg („Arabella“) am Pult.
Die letzten Vorstellungen: Strauss, Die Frau ohne Schatten, am 21. Juli (ausverkauft); Puccini, Tosca, am 14. Juli (Restkarten); Mahler, Sinfonie Nr. 2, am 18. und 19. Juli in der Philharmonie (ausverkauft).