Zur Abwechlung hier mal ein Gedicht
Sonne
und immer
wechselt das Wetter und
wir werden unsere
Trauer nicht los
bei Sonne
und anderem Wetter
warum sind die
Menschen in
Kalifornien
nicht immer nur
glücklich unter der
Sonne
Sonne
und immer
wechselt das Wetter und
wir werden unsere
Trauer nicht los
bei Sonne
und anderem Wetter
warum sind die
Menschen in
Kalifornien
nicht immer nur
glücklich unter der
Sonne
Was erwartet man, wenn ein Schriftsteller vier Lesetourneen absolviert hat und dann ein Buch „Deutschlandreisen“ nennt? Wahrscheinlich doch Anmerkungen über den oder jenen Landstrich und seine Bewohner, womöglich auch Sticheleien oder gar vernichtende Urteile über gewisse Gemeinden.
Diese Erwartungen enttäuscht Helmut Krausser gründlich. Die Städte, in denen der Autor zwischen 2006 und 2012 zu Gast war, stiften ihn nur selten zu substanziellen Bemerkungen an. Und so wird Augsburg kurz abgefertigt, gibt es einen Ulk über Ulm, wird Stuttgart achtlos gestreift, Heidelberg en passant behandelt, Freiburg kurzerhand als belanglos abgetan. Köln ist hässlich, die Leute dort sind aber freundlich und bei Lesungen allzeit lachbereit. In Nürnberg läuft nichts Vernünftiges im Kino, Dresden findet der Autor kulissenhaft, Flensburg zauberhaft, Lübeck ist recht schön, weckt aber den Unmut über Thomas Mann. Und so weiter. Die Schönheitstrophäe trägt übrigens Potsdam davon. Und auch Wismar ist schmuck.
Oft fällt Krausser zu den Städten lediglich ein, ob sie mit seiner eigenen Publikations- oder Aufführungsgeschichte zu tun haben. Beispiel: „Eisenach: Hier wurde nie etwas von mir aufgeführt, und es regnet. Wartburg durcheilt, Bachhaus gegrüßt, Lutherhaus links liegengelassen…“ Ein passender Titel für weite Strecken des Textes wäre gewesen: „Auf Ego-Trip durch Deutschland“. Nach der Lektüre ließe sich eine Landkarte der wechselnden Launen zeichnen. Der Klappentext erweist sich jedenfalls als Geflunker: „Krausser charakterisiert Städte aufmerksamer und sensibler als andere Autoren ihre Romanfiguren.“ Es sei denn, wir redeten von Heftchenromanen.
Doch natürlich erschöpft sich das Buch nicht darin. Krausser streut Kapitel aus seinen Münchner Poetik-Vorlesungen ein, die vom Pathos-Begriff handeln. Arg verkürzt gesagt: Angesichts grassierender Ironie solle man ruhig wieder mehr Pathos riskieren. Nicht zu viel nachdenken, keine Angst vor Kitsch haben, in allen Künsten lieber tonal, narrativ und figürlich schaffen als abstrakt. Darüber ließe sich immerhin debattieren.
Zwischendurch gibt’s häufig wohlfeile Rezensentenschelte, vor allem gegen die – so Kraussers Sicht – Dilettanten der landläufigen Opernkritik. Oder gleich ganz pauschal: „Im Journalismus sucht man gereifte Menschen leider oft vergeblich. Man gerät an böse, frustrierte, tyrannische Kinder, die glauben, ihnen gehöre die Welt.“
Vor allem nimmt es Krausser der Kulturjournaille übel, dass sie von seinem Buch über den nahezu vergessenen Komponisten und Puccini-Zeitgenossen Alberto Franchetti kaum Notiz nimmt oder es nicht als Entdeckertat würdigt. Furor auch auf diesem Felde. Über „Florian I.“ (Illies) heißt es: „Wie winzig er ist. Ich könnte auf ihn treten und sagen, es war ein Versehen.“ Und die „Zeit“ gilt ihm sowieso in Bausch und Bogen als pesudointellektuelles Revolverblatt.
Krausser selbst erlaubt sich steile Thesen und grässlich ignorante Urteile etwa über Brahms, Claude Chabrol, Bob Dylan oder Thomas Bernhard („Kaum ein Satz von diesem Homunculus, der nicht nach Scheiße schmeckt. Ein unglaublich dummer, ekelhafter Proll.“) und versteigt sich zu einem derartigen Satz ohne jede historische Rücksicht: „Irgendwann wird dieses von Schönberg und Konsorten ausgehende Intermezzo der Musikkultur von der Zukunft als gewissermaßen geisteskranke Zeit bezeichnet werden.“ Gewissermaßen. Geisteskrank. Der Ton macht die Musik.
Wir müssen uns aber wohl nicht darüber grämen, dass Ernst Jünger und Céline zu Kraussers literarischen Leitsternen zählen. Das politisch gegen ihn zu wenden, wäre sicherlich ungerecht. Auch Hemingway, Bukowski, Fallada, Friedo Lampe und Robert Gernhardt gehören ja erklärtermaßen in diese Reihe. Dass Krausser im Faschismus eine revolutionäre Idee sieht, die „nicht einfach als Biertischhybris sadistischer Idioten abgetan werden kann“, könnte allerdings schon Widerworte auslösen. Über Grass’ „Blechtrommel“ und deren Hauptfigur Oskar heißt es sodann: „Unerträglich. Heute geht dieses Gör wohl jedem auf die Nerven in seinem angemaßten Gutmenschentum.“ Dieses diffamierende Wort hat noch gefehlt. Und nach all dem fragt sich Krausser: „Warum polarisiert mein Werk?“ Ja, warum nur?
Aber hören wir auf damit, bevor Krausser auch hier gleich wieder eine Gedankenpolizei am Werk sieht, die seine schöpferischen Energien verkennt. Sein Buch enthält – neben mancherlei Ressentiments – denn auch durchaus anregende Passagen und Gedanken, die einem nachgehen. Hier eines von etlichen Beispielen, in denen Wahrheit und Weisheit walten und bei denen er sich nicht auf der Klaviatur vergreift: „…jeder macht, sofern er kann, mehr aus sich, als er ist, das ist begreiflich vor dem Nichts, das uns erwartet.“ Wo Krausser so ruhig und abgeklärt spricht, überzeugt er mehr als mit allem Geschrei.
Helmut Krausser: „Deutschlandreisen“. DuMont Verlag, 302 Seiten, 19,99 Euro.
Deutsche litten unter Geständniszwang, heißt es, da mag man nicht nachstehen.
Ja, ich bekenne, ich habe als Abiturient eines neusprachlichen Duisburger Gymnasiums die „Ilias“ des Homer nie kennengelernt, habe als Schüler des Huckinger Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasiums in solchen Dingen in die Röhre schauen müssen, obgleich der Lateinlehrer vorrömische Ausblicke sicher hätte eröffnen können. Auch später im Studium lockte uns kein Professor in ureuropäisch-asiatische Gefilde (dazu unten mehr). Und noch viel später bin ich zwar als wilder Leser in die Literatur der Länder und Zeiten aufgebrochen, aber auch dabei habe ich die „Ilias“ weiträumig umgangen.
Und mich immer ein bisschen geschämt dafür, meine Unkenntnis völlig zu Recht als Mangel empfunden. Also kam mir die Gelegenheit gerade recht, vor einiger Zeit Raoul Schrott mit seiner Neubearbeitung der „Ilias“ zu einer Lesung nach Duisburg-Ruhrort einzuladen und im Vorfeld dieses Abends seine Übertragung des Homerschen Epos auch lesen zu müssen, besser: zu dürfen. Die in den Stoff, die Form und die zypriotischen Vor-Geschichten einführenden Kommentare Schrotts hätten mich fast erneut abgeschreckt, doch endlich begannen die 24 Helden-Gesänge selbst und ich war wie gebannt, habe in ein paar Tagen die ganzen gut 500 Seiten plus vieler Anmerkungen verschlungen, habe mit Grausen vom Hand-Werk des Tötens gelesen, habe über den zornig-trotzigen Achill und seine heroischen oder göttlichen Supporter und Widersacher auch manchmal gelacht: Alphamännchen auf dem Affenfelsen.
Erstaunt haben mich die Göttinnen und Götter, hat mich der Macho Zeus, der hinter den Kulissen aber längst durch ein Göttinnenkollektiv entmachtet scheint. Überhaupt die Göttinnen: Anders als die Frauen der Griechen und Troianer sind sie mehr als Heimchen, Schönheiten oder Kriegsbeute – diese Göttinnen, das sind selbstbewusste Frauen, die an Zeussens Patriarchat sägen, Vorbilder für Emanzipationsstreben einige Jahrhunderte vor Christi Geburt.
Erzählt wird im Kern von vier ausgewählten Tagen (und Nächten) des zehnjährigen Krieges und ihrem zeitlichen Umfeld. Mit diesem Kern verknüpft Homer eine Unzahl von zeitlich-räumlichen Aus- und Einblicken in Genealogie der Helden und Götter, in ihr Leben und ihren Alltag, sogar in den Alltag des Olymps.
Mit gründlicher Recherche, mit Respekt und Komik, mit Wortwitz, Spott und Menschenfreundlichkeit, mit Geschichts- und Menschenkenntnis hat Raoul Schrott die „Ilias“ des Homer neu übertragen – und damit wieder sichtbar gemacht, was für ein eminent politischer und gegenwärtiger Text die „Ilias“ ist – auch darüber, wie sich persönliche Motive und taktisch-strategische Absichten in Kriegen auf barbarische Weise verbinden.
Homers spannende Story erzählt vom Groll des Achilleús, dem sein Feldherr Agamemnon die schöne Briseis als Kriegsbeute streitig macht, und von den Abgründen der Schlachten um Troia. Sie schildert Blut, Schweiß und Tränen des Krieges zwischen Griechen und Troianern, einst ausgelöst von Paris’ Raub der Helena. Und dieser Kriegsausschnitt wird beobachtet und kommentiert von den allzumenschlichen Göttern im Olymp, die es sich nie nehmen lassen, mit den Helden auch mal Marionettentheater zu spielen, Partei zu ergreifen oder selbst ordentlich dreinzuschlagen.
Raoul Schrotts großartige Fassung der „Ilias“ eröffnet so einen äußerst lebendigen Zugang zum Troia-Stoff, den viele nur verkürzt über den Film „Troja“ (mit Brad Pitt, Diane Kruger) kennen. Schrott befreit die 24 Gesänge der „Ilias“ in deutscher Sprache von jeder Patina und bringt darunter jenes Epos wieder zum Glänzen, dessen Lebendigkeit den Ruhm begründete. Dies in einem sinnlichen Deutsch, das ebenso direkt wie poetisch, ebenso musikalisch wie anschaulich spricht, das einem manchmal wie ein kunstvoller Rap erscheint, dann wie atemloses Erzählen oder wie Klagegesang, Trauerrede oder Zornesgeschrei – reich variiert in Vokabular, Rhythmen und Tonlagen.
Und auch dies sei noch erwähnt: Man kann Raoul Schrott getrost als einen großen Reisenden beschreiben. Er reist durch die Welt und die Zeit, also auch durch die Literatur, deren äußere und inneren Welten. So hat er denn neben der Arbeit an der Neuübertragung der „Ilias“ auch lange zur (Archäologie-)Geschichte Troias recherchiert. Seine nicht unumstrittenen Ergebnisse dazu präsentierte er in seinem Buch „Homers Heimat. Der Kampf um Troia und seine realen Hintergründe“. Dabei führt er uns vor das – seiner Meinung nach – eigentliche Modell für Troia: die Bergfestung von Karatepe (heute Türkei), einst Blüte der kilikischen Hochkultur. Von dort nämlich sollen sie stammen: die Landschaften und sagenhaften Hintergründe, die Homer in den Troia-Stoff projizierte. Mehr dazu im Gespräch Denis Schecks mit Raoul Schrott unter: http://www.youtube.com/watch?v=T6HQ8idx13Q
Homer: „Ilias“. Übertragen von Raoul Schrott. Hanser Verlag, München 2008. 692 Seiten, 34,90 Euro.
Raoul Schrott: „Homers Heimat. Der Kampf um Troia und seine realen Hintergründe“. Hanser Verlag, München 2008. 432 Seiten, 24,90 Euro.
„Vielleicht ist es das, was mich an Oberhausen herausfordert: Daß man die Stellen kennen muß. Die Plätze, an denen aus nichts ‚etwas‘ wird. Daß es Orte gibt, direkt in Oberhausen, die sind genau wie Frankreich, Berlin oder Neapel, ich schaue mich nur um und kann atmen, es gibt Stellen in Oberhausen, an denen kann man tatsächlich atmen.“
Martin Skoda in seiner Erzählung „Oberhausen“ (in: Dokumentation zum Oberhausener Literaturpreis 1999, Verlag Karl Maria Laufen, Oberhausen 1999)
Abseits aller „Masterpläne“:
Das Europäische Literaturhaus/Literaturnetz Ruhr (ELR)
Neben Verlagsförderung, Reisestipendien und Schreibaufträgen für Schriftstellerinnen und Schriftsteller werbe ich vom Literaturbüro Ruhr e.V. aus (seit fast zwei Jahrzehnten!) beharrlich für die Gründung eines regional verankerten Europäischen Literaturhauses Ruhr (ELR) mit offenem Konzept. Dieses ELR könnte auch der Mittelpunkt eines möglichen Europäischen Literaturnetzes Ruhr sein, das literarische Initiativen aus der Region aufnähme und in sie hineinwirkte, sie förderte und weiterentwickelte.
Wäre eine solche Gründung kulturpolitisch gewollt, sie ließe sich zügig diskutieren und umsetzen. Ein EUROPÄISCHES LITERATURHAUS RUHR könnte bescheiden (aber bitte nicht zu bescheiden) starten, um dann nach und nach zu wachsen. Im Verhältnis etwa zu noch mehr Philharmonien und Kreativwirtschafts-Zentren benötigte ein ELR erheblich weniger Zuschüsse, wäre preiswerter und eine echte (überfällige) Bereicherung des kulturellen Lebens an der Ruhr.
Das Ruhrgebiet hat hier enormen Nachholbedarf, ist zurzeit schlicht abgekoppelt von vielen Strukturen literarischen Lebens im deutschsprachigen Raum. Literaturhäuser finden sich zwar nicht, wohin man schaut, aber wenn man erst einmal genauer schaut, dann sichtet man respektable Häuser z.B. in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, Kiel, Köln, Leipzig, Dresden, Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg, Zürich und Basel. Insgesamt gibt es weit über 20 Einrichtungen, die Literaturhäuser sind – oder sich manchmal auch nur so nennen. Gemeinsam bilden elf von ihnen das ‚Netzwerk Literaturhäuser‘, www.literaturhaus.net/.
Daneben gedeihen zudem verwandte Einrichtungen: in Berlin etwa die LiteraturWERKstatt, das Literarische Colloquium (LCB) und das Literaturforum im Brecht-Haus, andernorts auch Künstlerhöfe wie in Schöppingen oder Edenkoben, dazu die Akademie Schloss Solitude …
Allein in Berlin also leistet man sich nicht nur mehrere Häuser für Literatur (mit unterschiedlichen Konzepten und Programmen), Berlin nutzt sie auch, um seine metropole Vorrangstellung im Literaturbetrieb auszubauen. Man sieht in prominenten Orten der Literatur die Facetten eines lebendigen ‚Kulturbetriebs‘, der auch vom Literaturmarkt lebt und ihn vice versa bereichert. Über 300 Verlage beherbergt Berlin und ist mit Milliarden-Umsatz die größte Stadt des Bucheinzelhandels. Anderswo weiß man also sehr gut um die Verbindung von geistigem Leben, lebendigen Orten und Geschäft.
Schaut man dagegen auf der Suche nach einem Literaturhaus im deutschsprachigen Raum ins fünf Millionen Einwohner starke Ruhrgebiet, dann heißt es: Fehlanzeige, kein solch ausstrahlender singulärer Ort, nirgends.
Ein Ort für die Lust am Text
Dabei könnte ein Europäisches Literaturhaus Ruhr als Knoten- und Kristallisationspunkt fürs literarisch-künstlerische Leben im Revier viel bewegen, sogar – aber eben nicht zuallererst – unter kulturwirtschaftlichen Aspekten. Es böte endlich einen sichtbaren und begehbaren Ort für Literatur. Es könnte das Forum sein für die Begegnung mit Literatur in all ihren Schattierungen, ein Ort „für die Lust am Text“ (Roland Barthes), ein Ort der Literaturvermittlung, der Konzentration, des spielerischen Umgangs wie des Widerspruchs, ein Ort für Leser, Schriftsteller, Verleger und Kritiker im Gespräch und Ideenaustausch, ein Ort der Vorstellung vergessener und zu entdeckender Schriftsteller, ein Haus der Zusammenarbeit von Literaten mit anderen Künsten und Medien. Regional verwurzelt und weltoffen, wäre ein Europäisches Literaturhaus Ruhr (auch als Mittelpunkt eines Literaturnetzes Ruhr) ein Tor zur Welt der Sprache und Dichtung.
Tagtraum
Man stelle sich vor: In einem Europäischen Literaturhaus Ruhr träfen sich gute Autorinnen und Autoren aus aller Welt, also auch aus NRW und der Region. Gespräche über alles, was mit Literatur zu tun hätte, würden dort geführt, man stritte, äße und tränke, kaufte sich Bücher, läse, sähe Literatur-Ausstellungen, Literaturverfilmungen, hörte mit Freunden Lyrik & Jazz, mit den Kleinen die besten Kinderbuchautoren, wärmte sich gelegentlich Herz und Verstand an literarisch-politischer Kleinkunst, hörte eine Nacht lang Mülheimer oder Bochumer Schauspielern zu, die aus dem „Ulysses“ läsen, besuchte zum ersten Mal ein „poetry café“, griffe gelegentlich sogar in literarische, politische und philosophische Debatten ein, um nicht als Konsumenten-Narziss das Leben nur blöde zu vertrödeln.
Junge und ältere Autoren träfen sich zu Textdiskussionen und Werkstattgesprächen, lernten von versierten Kollegen in Meisterklassen auf Zeit etwas über das Handwerk des Schreibens. Schriftsteller lüden Musiker, Maler … ein, um an Libretti zu arbeiten, Texte und Grafik zu einem Buch zusammenzustellen oder gleich gemeinsam eine Graphic Novel zu gestalten, während nebenan Videokünstler ihren Clip zu einem Gedicht Barbara Köhlers aus Duisburg schnitten. Was für ein lebendiges Haus! Und die Wahrnehmung durch die Literatur-Community des deutschsprachigen Raumes ergäbe sich durch die Qualität der Projekte und teilnehmenden Autoren ganz nebenbei.
„Wo kämen wir denn da hin“, dichtete der Schweizer Kurt Marti, „wenn alle sagten, wo kämen wir denn da hin, und niemand ginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.“
Nüchternheit und Mut zur Größe
Argumente gegen ein Literaturhaus gibt es natürlich genug. So einst auch rund um die Gründung der Literaturhäuser in Frankfurt, München und anderswo. In den Diskussionen um die Literaturhäuser in Berlin oder Hamburg hörte man einst vor deren Gründung ziemlich düstere Horrorvisionen eitler Vereitler. Zum Beispiel die von den Villen, in denen die Avantgarde ganz nebenbei zwischen Plüsch und Pomp erstickt würde. Oder die Vision vom Clubhaus für den Klüngel, von der Schwätzerbude für Hobby-Literaten, oder die von der subventionierten Sozialstation für alle, die ihre Tinte nicht halten könnten, von der Wärmestube für lokale Heimatdichter.
Ähnlich Überzogenes raunten aber auch die Befürworter von Literaturhäusern. In ihren Konzepten überfrachteten sie die Literaturhäuser so mit Hoffnung, dass die unter solcher Last als virtuelle Luft- und Lustschlösser schon einstürzten, bevor sie als Bau dastanden.
Ein Literaturhaus auf dem Papier bot und bietet tausendfach alles unter einem Dach: „die zeitgemäße Form des Salons der Rahel Varnhagen“ (Diepgen in Berlin), Caféhaus für Autoren und die demokratisch-literarische Öffentlichkeit, Schreibschule, Haus der Autorinnenförderung und Multi-Kulti-Austausch, Dokumentationszentrum, Medienwerkstatt, Autorenwohnung, Buchladen, Experimentierbühne und so weiter…
Auch dieses Statement hier steht in der Gefahr, einem Europäischen Literaturhaus Ruhr und seinen möglichen Befürwortern zu viel zuzumuten, doch andererseits: Das Literaturhaus wird hier präsentiert als ein Ort, an dem nichts weniger geschähe, als dass mit Hilfe der Literatur über Kunst, uns und unsere Gesellschaft nachgedacht würde.
Lernen am Modell: Hamburg und Berlin
Wer wirklich ein Europäisches Literaturhaus Ruhr will, sollte genauer z.B. nach Hamburg und Berlin schauen und von den dortigen Muster-Häusern gründlich lernen.
In Berlin erklärte einst Herbert Wiesner: „Wir verstehen uns als ein Haus der Literatur für Berlin, aber nicht als ein Haus der Berliner Literatur, nicht nur jedenfalls. Obwohl Berliner Autoren bei uns auftreten, sind wir sind kein Clubhaus für Berliner Schriftsteller. Wir arbeiten, um eine im Grunde zwar anerkannte, aber schwierigere, sich nicht von selbst schon vermittelnde Literatur vorzustellen. Ein Literaturhaus, das nur eine Aneinanderreihung von Lesungen böte, hätte keine Berechtigung“.
Ähnlich sah es auch Uwe Lucks, einer der ersten Geschäftsführer in Hamburg: „Also populistisch gehen wir nicht vor. Uns interessiert Qualität. Wir konzentrieren uns auf das, was uns wichtig erscheint. Das ist die Präsentation der aktuellen internationalen literarischen Szene.“
Im Hamburger Haus an der Innenalster präsentiert man noch heute ein anspruchsvolles, manchmal sperriges Programm, das Flagge zeigt, ohne zu vergessen, dass es viele verschiedene Leser gibt, mit vielen verschiedenen Lesebedürfnissen.
Ansteckend lebhaft
Beide Häuser öffnen anderen literarischen Vereinigungen ihr Haus als Forum und geben ihnen die Möglichkeit, kostenlos Veranstaltungen durchzuführen. So reicht man etwas von den eigenen Subventionen weiter. Unkenrufe von Kritikern, die glaubten, ein zentrales Literaturhaus veröde die literarische Szene einer Großstadtregion und nähme den anderen Initiativen Geld oder Publikum weg, haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil. „Es hat ja nur einen sehr kleinen Literaturetat gegeben, bevor wir überhaupt antraten. Wir haben die Kulturbehörde über unsere Existenz eher motiviert, viel mehr für Literatur in Hamburg insgesamt zu tun“, sagte Uwe Lucks in Hamburg, und Herbert Wiesner bilanzierte in Berlin: „Was kleinere Literaturinitiativen angeht, da gab´s sogar einen Schub von Neugründungen, seitdem unser Literaturhaus die Arbeit aufgenommen hat.“
Die Trägervereine beider Literaturhäuser bekamen ihre denkmalgeschützten Gebäude kostenlos renoviert und residier(t)en dort mietfrei. Beim Berliner Literaturhaus jedoch wurden (anders als in Hamburg) Programm und Haus noch stärker von der öffentlichen Hand gefördert. Aber auch die Berliner müssen dazuverdienen. Über Mitgliederbeiträge, Spenden, Eintrittspreise bei Veranstaltungen, die Verpachtung des Erdgeschosses ans Café „Wintergarten“ und des Souterrains an den Buchladen, über Vermietungen und wechselnde Sponsoren.
Ankommen und stiften gehen
Ich fasse einmal das Rezept für ein Literaturhaus zusammen:
Man nehme eine Handvoll Enthusiasten, die hoffentlich wenig Image- oder Ego-Probleme haben. Die tatkräftig sind, die konzeptionell denken können. Die Fortune haben, Ausdauer bei der Suche nach einem geeigneten Haus (gefördert aus Mitteln des Denkmalschutzes oder der Städtebauförderung des Landes), bei der Einbindung gediegener Mäzene und Stiftungen, souveräner Sponsoren, bei der Ansprache von Politikern und den Kulturbehörden.
Sicher jedenfalls ist: Ohne eine Stiftung geht wahrscheinlich gar nichts.
Vom Duisburger Lehmbruck Museum zum Beispiel und seinem engagierten Ex-Leiter, Dr. Christoph Brockhaus, wäre zu lernen, wie man sich über eine Stiftung finanziell unabhängiger macht und auf Teile von Dauer-Subventionen verzichten kann.
Warum überhaupt ein Literaturhaus?
Weil der Geist weht, wo er will, aber am liebsten dort, wo Intelligentes schon in der Luft liegt. Weil alle Künste im Ruhrgebiet feste Häuser haben, in denen Kunst gemacht und/oder dem Publikum präsentiert wird, die Literatur aber nicht.
Buchhandlungen und selbst (Stadt-)Bibliotheken bieten hier keine Alternative, auch weil es ihnen zurzeit in den Städten finanziell und auf dem Markt an den Kragen geht. Stadtbibliotheken bleiben vor allem Orte der Ausleihe, des Lesens, die daneben vielen anderen Zwecken dienen. Mit großer Anstrengung leisten es die besten unter ihnen, temporäre, flüchtige Veranstaltungsorte für zwei, drei Stunden zu sein, Mittelpunkte aber des literarischen Lebens in all seinen Facetten, Impulsgeber des literarischen Diskurses, der literarischen Produktion sind sie so nicht.
Insel der Phantasie
In einem Literaturhaus bestünde die Chance, die Begegnung mit Literatur und Schriftstellern tatsächlich zu kultivieren, abseits von bloßem Bestseller-Marketing oder Lesung-als-Gottesdienst-Kulisse. Literatur, Schreiben und Lesen, öffentliche Lektüre und Diskussion haben das Zeug dazu, „Kult“ zu werden. Literarische Geselligkeit erlebt seit längerer Zeit eine Renaissance, bietet genau den geistigen Luxus, den sich in einer offenen Gesellschaft alle die leisten, die kritisches Denken nicht nur simulieren, sondern auch stimulieren wollen.
Ein Literaturhaus wäre die Insel der hintergründigen Phantasie im Meer der vordergründigen Fun-Kultur. Der Literatur, den Gesprächen über Literatur täte es gut, etwas mehr als bisher um ihrer Inhalte willen ‚inszeniert‘ zu werden. Dazu bedarf es einer kultivierten Umgebung. Es wird Zeit, dass der Stil, den man von Autoren und ihren Texten fordert, endlich auch im Umgang mit Schriftstellern und ihren Werken geboten würde.
Warum ein E-u-r-o-p-ä-i-s-c-h-e-s Literaturhaus?
Das wissen wir alle: Historisch ist das Ruhrgebiet geprägt von Zuwanderern, kulturellen Einflüssen aus ganz Europa und weltweitem Handel. In dieser Metropolregion, zentral gelegen in einem Europa der Regionen, lässt sich Literaturförderung gar nicht anders denken als im Spannungsfeld von lokaler Verwurzelung und internationalen Beziehungen, von Identitätssuche und Weltoffenheit. Ein Europäisches Literaturhaus Ruhr hätte die Vielfalt und Einzigartigkeit internationaler Literaturen und Sprachen zu präsentieren und zu vermitteln, das darin zu entdeckende Widerständige, Fremde und Neue. Das Literaturhaus hätte Leserinnen und Lesern Orientierungen in der Welt der Bücher zu ermöglichen und mit internationalen Projektpartnern Lesekultur zu gestalten.
Eine Adresse für die Präsentation von Weltliteratur
Die literarische Öffentlichkeit könnte vom regen „Import“ internationaler Literatur profitieren. Schon für das Literaturbüro Ruhr e.V., das ich leite, lasen und lesen von den frühen Nächten der Literatur bis zu den interkulturellen Literaturprojekten heute Österreicher, Schweizer, Spanier, Franzosen, Türken, Russen, US- und Süd-Amerikaner, Ungarn und Polen, Argentinier und Nicaraguaner, Marokkaner und Algerier. Endlich hätte die Vorstellung von Weltliteratur im Ruhrgebiet auch eine feste Adresse.
Daran wären nicht zuletzt die (großen) Verlage interessiert, für die erst in einem solchen Rahmen Kooperationen und Förderungen interessant werden. So unterstützte die Bertelsmann Buch AG im Literaturhaus Frankfurt z.B. das 1. Internationale Literaturgespräch; das Thema: die Rolle der deutschsprachigen Literatur im Ausland. Die Bertelsmann Stiftung veranstaltete im Literaturhaus München und im Europäischen Übersetzer Kollegium Straelen am linken Niederrhein Autorenweiterbildungen und internationale Übersetzer-Treffen.
Seit jeher beeinflussen sich Literaten und Literaturen über alle Grenzen und Zeiten hinweg in ihren Themen, Figuren, literarischen Mitteln. Jede Literaturvermittlung – auch in einem Literaturhaus – hat heute auf diese Intertextualität durch ein internationales Programm zu reagieren, das von der literaturwissenschaftlichen Komparatistik profitieren sollte, wo immer es ginge.
Dass ein Europäisches Literaturhaus Ruhr sich nicht als ein Haus versteht, das sich auf die Präsentation europäischer Literatur beschränkt, versteht sich so von selbst. Im Gegenteil: Im komparatistischen und intertextuellen Vergleich von Nationalliteraturen, europäischer Literatur und Literatur der Welt, im lebendigen Austausch mit Autorinnen und Autoren erst ergeben sich die neuen Perspektiven einer international-globalisierten Literatur, die ohne ihre jeweiligen Wurzeln nicht zu verstehen ist.
Warum ein Europäisches Literaturhaus R-u-h-r?
Das literarische Leben hat – wie beschrieben – kein wirklich adäquates Zuhause im Ruhrgebiet, kein Obdach, bestenfalls Unterstellplätze und Tagesherbergen. Ein Europäisches Literaturhaus Ruhr hätte auf die besonderen Gegebenheiten des Reviers zu reagieren (karge Verlagslandschaft, fehlende Feuilletonvielfalt, fehlende Medienpräsenz).
Ein Europäisches Literaturhaus R-u-h-r hätte die junge Literatur, die Verlage und Literaturzeitschriften aus dem Ruhrgebiet (etwa den Grafit und Klartext Verlag oder das ‚Schreibheft‘) in gelungenen Veranstaltungen sozusagen in einer Art „Schaufenster nach außen“ auch bundesweit zu präsentieren. Parallel dazu würde internationale Literatur gleichsam über ein „Schaufenster nach innen“ vorgestellt.
Ein Europäisches Literaturhaus R-u-h-r wäre kein Allheilmittel gegen alle Defizite des literarischen Lebens im Revier, aber es könnte genau die Initialzündungen auslösen, die nötig wären, um eine lebendigere literarische Szene im Ruhrgebiet entstehen zu lassen und damit vielleicht auf Dauer auch mehr Autoren, Verleger und Medien ans Revier zu binden. Zurzeit wandern viele große Talente noch nach Berlin und anderswo ab, kaum ein Autor von Rang läßt sich dagegen im Ruhrgebiet nieder.
Binden und fesseln durch Abenteuer für den Kopf
Zudem: Auch das Publikum will gepflegt werden. Nicht nur die Folkwang-Hochschule oder Schauspielhäuser wie das Bochumer Theater oder das Theater an der Ruhr, auch die Einrichtungen der soziokulturellen Szene haben in der Vergangenheit deutlich gemacht, wie wichtig Treffpunkte, feste Einrichtungen für die Entwicklung der (klein-)künstlerischen Szene und die Herausbildung eines dazugehörenden Publikums sein können.
Ein Europäisches Literaturhaus R-u-h-r sollte zwar einen Sitz haben, ein Domizil mit angemessenen Veranstaltungs- und Büroräumen, gleich ob nun in einer Villa, einem Industriekultur-Gebäude oder im Rahmen eines attraktiven Innovations- oder Gründerzentrums, aber es dürfte als Europäisches Literaturhaus R-u-h-r keinesfalls nur dort tätig sein.
Das Ruhrgebiet braucht ein LITERATURHAUS als regionalen Veranstalter, als Agentur, als Markenzeichen, als Mittelpunkt eines Literaturnetzes Ruhr. Das Europäische Literaturhaus Ruhr hätte als Literaturhaus auch in der Region Veranstaltungen durchzuführen. Unter dem Titel „Das Europäische Literaturhaus Ruhr zu Gast in …“ könnten Autoren, Diskussionen, interdisziplinäre Kunst-Projekte (zum Beispiel) im Landschaftspark Duisburg-Nord, im Gasometer Oberhausen, in der Zeche Zollverein usw. durchgeführt werden. Nicht zuletzt deshalb, um das Publikum in der Region auf das Mutter-Literaturhaus aufmerksam zu machen und es fest daran zu binden.
Die leidigen Finanzen
Allerdings hätte ein solches Europäisches Literaturhaus Ruhr auch seinen Preis. Karge Zuschüsse, halbherzige personelle und materielle Förderung wie etwa die für das engagierte Literaturbüro Ruhr e.V. verweigern von vornherein die finanzielle Mindestausstattung für dauerhaften internationalen Literaturaustausch und ein professionelles Kulturmanagement, das nicht nur auf Kosten der Mitarbeiter ginge. Hohe Kompetenz der Mitarbeiter allein kann kein erfolgreiches Europäisches Literaturhaus Ruhr begründen. Der kulturpolitische Wille zu profilierter regionaler Literaturpolitik mit bundesweiter und internationaler Ausstrahlung, der Wille zur Bündelung der Kräfte ließe sich nur umsetzen, wenn endlich auf solider materieller Grundlage hochkarätige Literaturförderung in der Region betrieben werden könnte.
Wer ein Netz knüpfen will, darf die Knoten nicht vergessen
Noch einmal: Es gibt ein reges literarisches Feld im Ruhrgebiet, es gibt bereits ein Netz engagierter, aber oft isolierter Autoren, Vermittler, Förderer, Vereine und Institutionen. Was uns fehlt, sind belastbare Knotenpunkte. Ein Literaturhaus gäbe als ein solcher Knotenpunkt diesem oft noch zu wenig sichtbaren Literaturnetz mehr Halt. Sagen wir aber nichts gegen dieses Netz der Enthusiasten, fordern wir nur ein anderes, ein besseres, das in dieser „großen Großstadt Ruhr mit seiner immer stärker werdenden sozialen Polarisierung“ (Prof. Strohmeier, ZEFIR) das geistige Leben selbstbewusst weiterentwickeln hilft.
(Dieser aktualisierte Vorschlag zu einem Europäischen Literaturhaus Ruhr erscheint zeitgleich auch auf der Homepage des Literaturbüros Ruhr.)
Aufatmen: Jörg Albrecht darf aus Abu Dhabi ausreisen. Der Schriftsteller war wegen angeblicher Spionage festgehalten worden.
Heute morgen kam die Nachricht von Holger Bergmann, künstlerische Leitung Ringlokschuppen, und Thorsten Ahrend, Wallstein Verlag, sowie weiteren Künstlern über Change.org, wo sie eine Online-Petition für die Ausreise des Autoren verfasst hatten: Demnach hat Jörg Albrecht gestern, am 13. Mai, nachmittags geschrieben, dass er die Vereinigten Arabischen Emirate verlassen dürfe. Auch die ZEIT berichtet, dass laut Informationen des Göttinger Wallstein-Verlages und des Auswärtigen Amtes die Ausreisesperre aufgehoben worden sei.
In Ihrer Mail schreiben Ahrend, Bergmann & Co., dass Jörg Albrecht sich schon darauf eingerichtet hatte, „dass alles viel länger dauern könnte. Hat es aber nicht. Und das ist auch euch allen zu verdanken“. Über 6000 Menschen hatten demnach den offenen Brief unterzeichnet.
Jörg Albrecht war am 1. Mai zur internationalen Buchmesse in die Hauptstadt der Arabischen Emirate gereist. Dort wurde er einige Tage inhaftiert und durfte danach nicht ausreisen. Er hatte in einer Straße Fotos gemacht, in der auch Botschaften ansässig sind, und wurde deshalb der Spionage verdächtigt – siehe auch den ersten Bericht auf Revierpassagen.
Die Verfasser der Online-Petition schreiben weiter: „Erstmal holen wir jetzt Jörg hoffentlich vom Flughafen ab. Dann atmen wir auf. Ihr wart großartig! Danke, danke, danke für alles!“
Gute Heimreise!
P.S. mit kurzem Update: Anne Levy, die die Online-Petition mitinitialisierte, hat einen Tweet mit den Worten „united! #joergalbrecht #friendshipisthenewlove“ veröffentlicht, der auf ein Instagram-Foto mit Jörg Albrecht und seinen Freunden verweist.
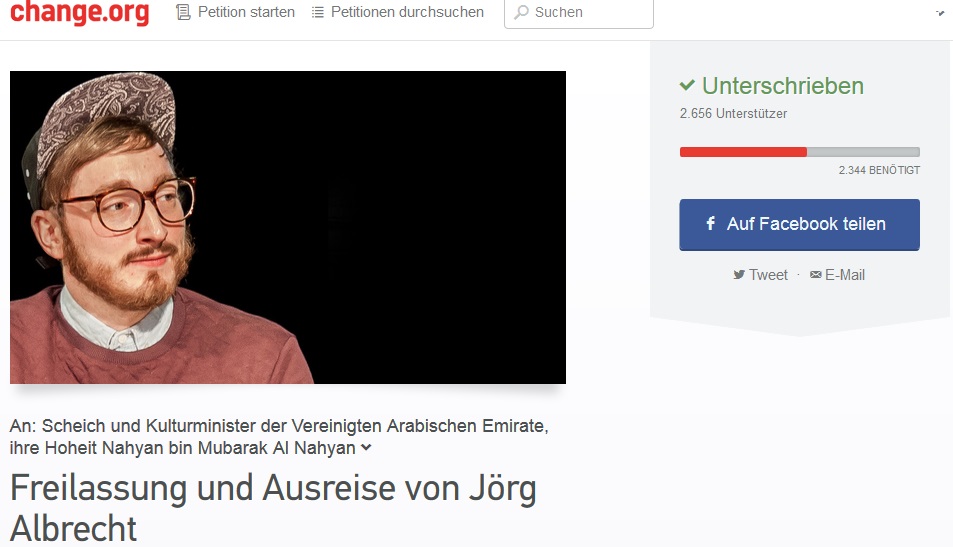
Die Petition von Holger Bergmann und Thorsten Ahrend für die Ausreise von Jörg Albrecht auf change.org. (Screenshot von http://www.change.org)
Jörg Albrecht ist ein Sprachkünstler. Ein leiser, ein höflicher Mensch. Einer der zuhört, einer der viel überlegt. Einer, der voller spannender und bemerkenswerter Gedanken steckt. Und einer, der sich nicht im Eindimensionalen bewegt. Einer, der sich für andere Menschen, andere Kulturen interessiert, der neugierig und aufgeschlossen ist, reflektiert und respektvoll. So habe ich den mittlerweile in Berlin lebenden Jörg Albrecht in seiner Heimat Dortmund kennengelernt, bei Gesprächen und Interviews zu seinen Büchern und Theaterinszenierungen.
Jetzt sitzt Jörg Albrecht in Abu Dhabi fest. Der Vorwurf: Spionage. Eingereist war er als Gast der Internationalen Buchmesse. In einem Interview mit ZEIT Online berichtet er, dass er unmittelbar nach seiner Ankunft am 1. Mai in der Nähe seines Hotels Bauten fotografierte, die ihn architektonisch interessierten. Daraufhin wurde er festgenommen und inhaftiert.
ZEIT und NZZ schreiben, man habe ihn der Spionage verdächtigt, da er in einer Straße fotografiert habe, in der auch Botschaften seien. Den Berichten zufolge ist Jörg Albrecht zwar wieder aus der Haft entlassen worden, dürfe das Land derzeit aber nicht verlassen. In dem ZEIT-Interview sagt Albrecht, er fürchte, „bald psychisch“ einzubrechen, „da ich hier nun erst mal auf mich gestellt bin“.
Ein Alptraum.
Holger Bergmann und Thorsten Ahrend haben eine Online-Petition für seine Ausreise ins Leben gerufen. Hoffentlich haben sie schnell Erfolg.
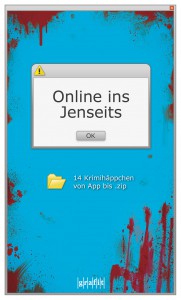 Geschichten über Verbrechen gibt es seit Kain und Abel. Doch jede Zeit bringt ihre eigenen Waffen hervor. Was dem Kain sein Stein war, ist dem Kriminellen im world wide web seine Tastatur. Im Zeitalter des unbegrenzten Surfens ist das perfekte Verbrechen manchmal nur einen Mausklick entfernt.
Geschichten über Verbrechen gibt es seit Kain und Abel. Doch jede Zeit bringt ihre eigenen Waffen hervor. Was dem Kain sein Stein war, ist dem Kriminellen im world wide web seine Tastatur. Im Zeitalter des unbegrenzten Surfens ist das perfekte Verbrechen manchmal nur einen Mausklick entfernt.
Grund genug für den Dortmunder Grafit Verlag, eine seiner beliebten Kurzkrimi-Anthologien dem zwar reellen, aber im Virtuellen gestarteten Verbrechen zu widmen. Mit der neuen Sammlung „Online ins Jenseits“ serviert der Verlag 14 Krimihäppchen namhafter Krimi-Autoren – von A wie App bis Z wie .zip. Schnell wird klar, mögen sich auch die Waffen geändert haben, gleichbleibend auch im virtuellen Raum sind die Motive. Gekränkte Eitelkeit und Bloßstellung durch entlarvende Youtube-Videos, Kontrollverlust, bedrohtes Eigentum, enttäuschte Liebe – das war schon im Alten Testament so, das bleibt auch im Internet.
14 Autoren, etliche davon Mitglieder in der renommierten Krimi-Autoren-Vereinigung Syndikat, sind online gegangen und haben die heimtückischsten Fallen im Cyber-Space aufgespürt. Ganz ohne Frage ist es in Zeiten allgegenwärtiger digitaler Beobachtung, in denen sich Blogger berufen fühlen, eine Rede zur Lage zur Nation zu halten, gut und wichtig, auch im Unterhaltungssektor auf die Gefahren des Internet aufmerksam zu machen. Schließlich kann man nicht alles mit der Escape-Taste wieder rückgängig machen,
Leider wirken die meisten Krimihäppchen eigenartig fade und selten wirklich appetitanregend. Die Autoren verstehen ihr Handwerk, wie gewohnt sind einige Plots richtig spannend, andere eher augenzwinkernd amüsant. Aber es bleibt ein seltsam diffuses Gefühl von „Hier wird zusammengebracht, was (noch) nicht richtig zusammengehört“. Es scheint, als ob die Kreativität der schreibenden Zunft exakt diametral zur Kreativität der Computer-Nerds verläuft (und wahrscheinlich auch umgekehrt). So richtig versteht man einander nicht, zu fremd sind letztlich doch wohl die unterschiedlichen Lebenswelten, als dass eine Schnittstelle zu definieren wäre. Die geschilderten virtuellen Verbrechen kratzen nur an der Oberfläche, viele Protagonisten scheinen wie mit einer Schablone gezeichnet.
Dennoch sind die Geschichten professionell aufgebaut und reichen durchaus für ein paar spannende analoge Stunden. Und ganz sicher verhilft der Offline-Genuss dieser Krimihäppchen dazu, später beim Internet-Surfen die ein oder andere Klippe zu umschiffen, von der man sonst vielleicht gestürzt wäre. Dabei sind die den Kurzkrimis vorangestellten meist skurrilen webfacts ein willkommenes Amuse Geule, die den Krimis nachgestellten „heimlichen“ Online-Wünsche der Autoren ein nettes Dessert.
Von den 14 Geschichten gefielen mir zwei besonders: Zum einen Katzenauge 2.0. von Sabine Thomas, der damit die Ehre gebührt, dem im Netz so gleichermaßen beliebten wie nervigen Cat-Content eine ganz neue Bedeutung gegeben zu haben. Zum anderen interessanterweise die Geschichte von Sebastian Stammsen www.krimi-hexen.de, in der ausgerechnet bloggende Rezensentinnen zum Mordopfer wurden. Wahrscheinlich war ich einfach froh, dass es mich nicht getroffen hat und ich weiter unbehelligt meine unmaßgebliche Meinung in die Tasten hacken darf.
„Online ins Jenseits“. 14 Krimihäppchen. Grafit Verlag, Dortmund, 184 Seiten, 10 €
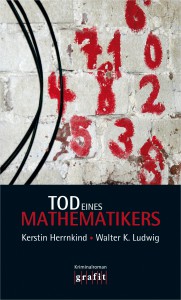 Er verkörpert den Prototyp eines Professors, zumal eines Wissenschaftlers in der Disziplin Mathematik: verschlossen, eigenbrötlerisch und ein wenig vergesslich. Wer sollte schon Interesse haben, einen solchen Mann umzubringen?
Er verkörpert den Prototyp eines Professors, zumal eines Wissenschaftlers in der Disziplin Mathematik: verschlossen, eigenbrötlerisch und ein wenig vergesslich. Wer sollte schon Interesse haben, einen solchen Mann umzubringen?
Diese Frage stellt sich die Kripo auch, als sie im Fall des Todes von Albert Katzenstein ermittelt – und hat die Antwort schnell parat: Hier handelt es sich nicht um Mord, sondern um einen klaren Fall von Suizid. Der hoch angesehene Experte hat das eigene Ende selbst verbeigeführt. Doch seine Tochter, von Beruf Journalistin, mag daran nicht glauben. Da sie das Recherchieren gelernt hat, beginnt die junge Frau selbst mit der Spurensuche. Ihre Kontakte zur Polizei sind hilfreich, um Beamte von ihrem Zweifel an der Selbstmordversion zu überzeugen.
Kerstin Herrnkind und Walter K. Ludwig haben mit „Tod eines Mathematikers“ einen ungemein spannenden Krimi geschrieben, der vor allem durch überraschende Wechsel und Wendungen überzeugt. Indem das Autorenduo immer wieder neue Nebenschauplätze eröffnet, kommen zusätzliche Motive und Täter in Betracht, die für den Tod des Professors und weitere ungelöste Kriminalfälle aus der Vergangenheit verantwortlich sein könnten. Es gelingt den Verfassern, die einzelnen Handlungslinien geschickt miteinander zu vermischen, ohne dass der Leser den Überblick verliert. Der Roman gewinnt vor allem auch dadurch an Dynamik, dass Romanfiguren in höchste Gefahr geraten, die bis dahin mit einem absolut sicheren Auftreten beeindruckten und nicht für eine Opferrolle geschaffen schienen.
Der Leser erfährt darüber hinaus, das aber eher beiläufig, wie es in Zeitungsredaktionen zugeht. Die Tochter des Mathematikers arbeitet für ein Blatt in Bremen, das, wie viele andere Printerzeugnisse, unter Auflagenschwung leidet und Stellen abbauen muss. Scheinen auch hier und da die Umgangsformen von Journalisten etwas überzeichnet zu sein, ist es amüsant zu lesen, wie es im Redaktionsalltag ab und an zugehen kann. Das gilt ebenso für die Kripo, zu deren Mitarbeitern einige schräge Typen gehören. Ohne sie wäre allerdings die gesamte Geschichte nur halb so unterhaltsam. Zu den Annehmlichkeiten dieser Lektüre gehört ferner eine einfache wie aber auch sehr lebendige Sprache, die durchaus mal ganz derb sein kann.
Wer übrigens meint, man könne gegen Ende das Buch aus der Hand legen, weil alle Unklarheiten beseitigt sind, der sollte sich eines Besseren belehren lassen. Zum Schluss folgt noch ein Clou – vielleicht Stoff für eine Fortsetzung?
Kerstin Herrnkind/Walter K. Ludwig: „Tod eines Mathematikers“. Grafit Verlag, Dortmund. 351 Seiten. 10,99 Euro.
 Es gibt Menschen, die haben Stimmen im Ohr und verstehen sie nicht. Franz Walter hört nur eine einzige Stimme und die versteht er sehr gut. Es ist die seiner Mutter. Nach halbwegs geglückter Psychotherapie hört er auch diese nicht mehr, dafür hält nun ein einziges Wort sein Ort besetzt. „Mutter, Mutter, Mutter“ – so kreist es unablässig in seinem Ohr. Und nicht nur dort.
Es gibt Menschen, die haben Stimmen im Ohr und verstehen sie nicht. Franz Walter hört nur eine einzige Stimme und die versteht er sehr gut. Es ist die seiner Mutter. Nach halbwegs geglückter Psychotherapie hört er auch diese nicht mehr, dafür hält nun ein einziges Wort sein Ort besetzt. „Mutter, Mutter, Mutter“ – so kreist es unablässig in seinem Ohr. Und nicht nur dort.
Das Wort Mutter kreist in seinem Kopf, ach was: in seinem ganzen Leben. Da hilft es auch nichts, dass die biestige und zwanghaft besitzergreifende Mutter sich längst aus dem Leben verabschiedet hat. So wie auch schon der charmanteste Berliner Kiez nichts geholfen hat, wenn dieser auf ein Bett zusammenschrumpft, in dem der kleine Franz Walter mit seiner Mutter Mittagsschläfchen halten muss und dabei ihren Schweiß riecht. Es hilft erst recht nicht, wenn der zumindest dem Alter nach erwachsene Franz Walter mit seiner Mutter auf die kleine Insel Darß reist und zur Sicherheit das immer gleiche Fischrestaurant aufsucht. Über diese Insel und ihre Region schreibt der zumindest dem Alter nach erwachsene Franz Walter Reiseführer, die eher Gebrauchsanweisungen ähneln und so mutlos sind wie sein ganzes Leben.
Sonst noch was? Ach ja, die Mutter hatte Brustkrebs, der Sohn weilte während der OP in Rom. Die Mutter lag im Sterben, der Sohn weilte in Kalkutta. Nachsehen, ob man nicht vielleicht auch Mutter Teresa ein paar negative Seiten nachweisen kann. Sonst noch was? Nicht wirklich. Im Großen und Ganzen ist dies der Inhalt von Hans-Ulrich Treichels neuem Roman „Frühe Störung“.
Schade nur, dass man über diese Inhaltsfragmente schon nach gut einem Viertel des Romans Bescheid weiß. Noch bedauerlicher, wenn man danach auf knapp 190 Seiten bis auf eine Entblößung der zerstörten Mutterbrust und zwei ungelenke Beziehungsversuchen nichts Neues mehr erfährt. Der Rest ist Wiederholung, langweilende, irritierende, nervende Wiederholung ohne jede Variation. Die Speisekarte des Fischrestaurants kennt der Leser bald besser als die Mutter, der Mittagsschlaf schafft es gefühlt auf jede zweite Seite und was der arme Therapeut dazu zu sagen hatte, das können wir alsbald auch auswendig repetieren.
Vollkommen ratlos lässt einen dieses Buch zurück. Nicht ratlos ob der „frühen Störung“ des auf ewig in kindlichen Animositäten verharrenden Franz Walter. Dessen Störung reicht noch nicht mal für einen ordentlichen Ödipus-Komplex, sondern ist eher lapidar. (Vielleicht liegt darin das Problem des Romans. Hätte ein ordentlicher ausgewachsener Ödipus-Komplex mehr hergegeben?) Dazu kommt die leider gesicherte Existenz des ewigen Muttersöhnchens. Leider, denn müsste Franz Walter sich mit etwas so Profanem wie Existenzsicherung auseinandersetzen, wäre wohl weniger Zeit, derart episch und larmoyant sein Zivilisationsproblem einer überbehüteten Kindheit wieder und wieder durchzukauen. Nein, das Buch lässt einen ratlos mit der Frage zurück: Wer bitte, soll und will das lesen?
Es scheint, als ob sich jemand diese „frühe Störung“ von der Seele hat schreiben müssen. Das ganze Buch wirkt wie eine dringend benötigte Aufarbeitung frühkindlicher Traumata ohne Rücksicht auf den, der es lesen soll. Der Klappentext verkauft es als Literatur mit schmerzlich-ironischem Unterton. Ein bißchen Ironie fehlt in der Tat schmerzlich, aber das war wohl nicht gemeint. Wo jedenfalls der Autor und der Verlag diese Ironie gefunden haben wollen, bleibt ihr Geheimnis.
Ganz besonders irritierend ist das Buch auch deshalb, weil es formal und sprachlich außerordentlich gut geschrieben ist. Erzähltechniken wie das Einfügen von Rückblenden beherrscht Treichel perfekt. Seine Sätze sind elegant und kristallklar formuliert, man liest sie der Fomulierungen wegen mit Respekt und auch Freude an der Sprache. Das ist aber auch fast der einzige Grund, der einen zum Weiterlesen bewegt. Manches, etwa das Alltagsleben auf dem Darß, ist durchaus angenehm schrullig beschrieben und macht Freude beim Lesen. Aber eben nur einmal. Danach wird es – aber egal. Ich will mich jetzt nicht auch noch ständig wiederholen.
Noch irritierender wirkt der Roman, wenn man an das bisherige literarische Werk Hans-Ulrich Treichels denkt. Der promovierte Germanist und Mitglied des PEN-Zentrums begeisterte mit seinen bisherigen Werken Publikum wie Kritik gleichermaßen. Zwar setzt er sich auch in seinem wohl bekanntesten Roman „Der Verlorene“ mit Schuldgefühlen innerhalb einer Familie auseinander und der titelgebende „Verlorene“ ist auch in diesem Buch der Sohn, aber im Punkt erzählerischer Dichte sind es Welten, die diese Bücher trennen. So gesehen, erscheint „frühe Störung“ eher als eine späte Störung.
Zu autobiographischen Bezügen seiner Romane äußerte sich Hans-Ulrich Treichel bisher ambivalent. Angenommen, der Autor habe sich selbst die „Mutter, Mutter, Mutter“ von der Seele schreiben müssen, bleibt die Hoffnung, dass er sein unbestreitbar enormes schriftstellerisches Talent in seinen nächsten Werken störungsfreier entfalten möge.
Hans-Ulrich Treichel: „Frühe Störung“. Roman. Suhrkamp Verlag, 189 Seiten, €18,95
„Das Gartenhaus“ – der Titel klingt eher nach einem beschwingten Sommerabend oder nach einem Tête-à-Tête im Grünen. Tatsächlich geht es in der gleichnamigen Uraufführung nach einer Novelle des Schweizer Autors Thomas Hürlimann am Theater Oberhausen um ein gewichtigeres Thema: Tod und Trauer.
Ein älteres Ehepaar hat den Sohn verloren, nun stellt sich die Frage: Rosenstrauch oder Grabstein? Lucienne (Margot Gödrös) setzt sich durch und lässt einen künstlerisch ansprechenden Gedenkstein anfertigen, aber sie brüskiert damit ihren Ehemann (Hartmut Stanke). Das führt zum ersten Zerwürfnis zwischen den Eheleuten, im Laufe der Inszenierung von Oberhausens Intendant Peter Carp vertieft sich dieser Graben. Eingekapselt in die je eigene Trauer verlieren die beiden Alten beinahe den Kontakt zueinander. Und schlimmer: Sie belauern sich, sie misstrauen sich, sie fügen sich Gemeinheiten zu.
Carp trifft genau den Ton und die Atmosphäre in diesem Seniorenhaushalt. Den Starrsinn, die Sturheit, das Verlieren in Erinnerungen, aber auch die Hilflosigkeit und die Unfähigkeit, mit dem Schmerz um den zu früh Dahingeschiedenen umzugehen. Doch die deprimierende Szenerie lässt auch komische Momente zu: Wie Hartmut Stanke in der Rolle des Oberst sich hinter dem Rücken seiner Frau um eine herrenlose Friedhofskatze kümmert und dazu Fleischbrocken im Kleiderschrank aufbewahrt, die leider angeschimmelt aufgefunden werden, weil er die Bevorratung vergessen hat. Wie der Militär a.D. die heimliche Versorgung der Katze wie einen Feldzug plant und sich dabei keine Geringeren zum Vorbild nimmt als Napoleon oder den Vietkong.
Nicht zuletzt überzeugt Hürlimanns präzise hochliterarische Sprache. Die Tatsache, dass es sich nicht um einen dramatischen, sondern um einen Prosa-Text handelt, kommt der Aufführung sogar zugute: So sprechen die Akteure in der dritten Person übereinander statt miteinander. Dies ruft eine eigentümliche Distanz hervor, die genau den Nerv dieser Beziehung trifft. Längst haben Lucienne und der Oberst aufgehört miteinander zu reden. In ihrer Hilflosigkeit wenden sie sich an Tochter (Susanne Burkhard) und Schwiegersohn (Klaus Zwick), doch Antworten bekommen sie hier nicht. Eher werden ihre Schrullen belächelt, ihre Problemchen nicht für voll genommen. So zeigt das Stück auch etwas über den Umgang mit dem Alter heute. Passend dazu bedeckt Herbstlaub das Bühnenbild von Kaspar Zwimpfer.
Margot Gödrös und Hartmut Stanke – beide selbst in vorgerücktem Alter – verkörpern Hürlimanns Paar extrem überzeugend und äußerst charmant. Und so macht sich auch im Publikum Erleichterung breit, als sie sich am Schluss doch wieder versöhnen. Ausgerechnet im Gartenhaus, wo noch die Modelleisenbahn das verstorbenen Sohnes aufgestellt ist, finden sie wieder zueinander. Indem sie sich mit der Miniaturwelt beschäftigen, schrumpft auch die Trauer auf ein erträgliches Maß. Die Züge rattern wieder durch die Schweizer Berge, das Leben geht (noch eine Weile) weiter.
Den Kamener Schriftsteller Heinrich Peuckmann (65) kannte ich bisher nur vom Telefon. Der immens fleißige Mann rührt stets selbst die Trommel für seine Bücher, denn die kleineren Verlage können sich nicht allzu wirksam in die Bresche werfen.
Also ruft Peuckmann an oder mailt, wenn es etwas Neues aus seiner Werkstatt gibt. Jetzt kam mal wieder Post, denn er hat einen Krimi rund um die Tiermafia geschrieben, die weltweit illegal mit raren, bedrohten Tierarten handelt. Das Thema hatte sich aufgedrängt, als Peuckmanns Leipziger Verleger eine seltene Agame (Schuppenkriechtier) angedient wurde. Das ging doch nicht mit rechten Dingen zu…

Der Autor Heinrich Peuckmann (rechts) und Dortmunds Zoodirektor Dr. Frank Brandstätter mit Schildkröten und Krimi im Amazonashaus. (Foto: Bernd Berke)
Peuckmann stellte sein neues Buch mit dem zunächst rätselhaften Titel „Angonoka“ nun im Dortmunder Zoo vor. Nicht nur, weil der größte Zoo Nordrhein-Westfalens zu den vielen lokalen Schauplätzen der Kriminalstory gehört, sondern vor allem, weil dessen Direktor Dr. Frank Brandstätter als bildreich erzählender Fachberater und sozusagen auch als Korrektor fungierte. Brandstätter wurden schon öfter Tiere aus dubioser Herkunft angeboten. Von den üblen Machenschaften der Tiermafia erfährt er zudem oft genug, wenn der Zoll in Zweifelsfällen seinen Expertenrat einholt.
Termin im Amazonashaus des Zoos: Bei extremer Luftfeuchtigkeit posieren Autor Peuckmann und Zoochef Brandstätter mit exotischen Schildkröten fürs Foto. Natürlich ist das eine Anspielung auf die Krimihandlung. Im neuen Roman wird zu Beginn eine Leiche gefunden, Ort des Geschehens ist zunächst der Dortmunder Vorort Kurl. In der Nähe des Mordopfers kriecht just eine Schildkröte, die die Polizei anfangs nicht in Verbindung mit der Tat bringt. Deshalb soll ihr Ex-Kollege, der pensionierte Kommissar und Tierfreund Bernhard Völkel, dafür sorgen, dass das Tier gut untergebracht wird.
Schnell stellt sich freilich heraus, dass es sich bei der Schildkröte um eine ungemein seltene Angonoka (Schnabelbrustschildkröte) aus Madagaskar handelt. Es gibt nur noch rund 700 Exemplare dieser Art, für ein Tier werden auf dem Schwarzmarkt etwa 50000 Dollar hingeblättert. Wo es um so viel Geld geht, liegen kriminelle Hintergründe nah. Wir verraten vom Fortgang jetzt nur noch dies: Der Fall wird schließlich aufgeklärt.
Einige Facetten des Krimis verdankt Heinrich Peuckmann seinem jüngsten Sohn, der Theologie studiert und sich u. a. auf Tierethik verlegt hat. Da stellen sich auch Fragen wie: Haben Tiere eine Seele, eine „Biographie“ und eine Sprache? Worin besteht letztlich der Unterschied zum Menschen? Man ahnt schon, dass es auch im Roman nicht mit bloßer Kriminalistik getan ist.
Pikantes Handlungsdetail übrigens: Kommissar Völkel vermisst schmerzlich seine altvertraute Dortmunder Zeitung. 120 Journalisten wurden da kurzerhand auf die Straße gesetzt. Nur der Chefredakteur hat seinen Job behalten… Wieso Peuckmann wohl auf so etwas kommt? Bestimmt blühende schriftstellerische Phantasie, oder?
Apropos Krimi, apropos Dortmund: Was hält Peuckmann eigentlich vom Dortmunder „Tatort“ im ARD-Programm? „Nichts!“ Eine solche Negativwerbung mit durchgeknalltem Kommissar, so Peuckmann geradezu erbost, würde man sich in keiner anderen deutschen Großstadt gefallen lassen.
Heinrich Peuckmann: „Angonoka“. Kriminalroman. Lychatz Verlag, Leipzig. 238 Seiten (Taschenbuch). 9,95 Euro.
Die Rückwand eine Spiegelfläche, einige Scheinwerfer – mehr Bühnenbild braucht es nicht, um Kassandras Denken sinnfällig zu machen: Reflexion und Erhellung (vielleicht auch Erleuchtung) kennzeichnen es, ein Verstandesmensch ist sie, eine Analytikerin, ein Intellektuelle. Und eine Leidende unter eigener Erkenntnis.
Im Studio des Dortmunder Theaters gibt die jugendliche Bettina Lieder Kassandra Gesicht und Stimme. In einem kräftezehrenden 80-Minuten-Monolog erzählt sie ihre – Kassandras – Lebensgeschichte, und sie wirft sich so bedingungslos in die Rolle, daß ein Schwächeanfall nach etwa einer Stunde den Fortgang der Aufführung für kurze Zeit fraglich macht. Doch nach wenigen Minuten ist Bettina Lieder wieder vorne. Und sie ist wieder Kassandra, die zornige Frau, die die Gabe der Weissagung haben soll und die darunter körperlich leidet.
Tochter von König Priamos und seiner Frau Hekabe ist sie, doch die hohe Herkunft erspart ihr nicht das entwürdigende Deflorationsritual, das sie ganz selbstverständlich erkennt als Teil der politisch gewollten Frauendiskriminierung. Sie will Abstand halten zu den Widrigkeiten dieser Welt, strebt das Amt der Priesterin an und wird in der Folgezeit eine mehr oder weniger involvierte Beobachterin der Verhältnisse, insbesondere der Kriegstreiberei gegen die Griechen.
Den Trojanischen Krieg sieht sie ebenso kommen wie sie späterhin auch früh die List der Griechen erkennt, die den Trojanern ein viel zu großes Holzpferd zur Opfergabe machen. Und sie weiß auch, dass das Trojanische Pferd Symbol für ein besonders grausames Gemetzel und den Untergang Trojas sein wird. So viel Inhalt im Kurzdurchlauf. Der Text, den Bettina Lieder vorträgt, berichtet natürlich ungleich mehr. Und man kann ihm recht gut folgen, wenngleich auch er mit vielen Namen und langen Sätzen gewisse Anforderungen an die Aufmerksamkeit des Publikums stellt.
Der Text nun stammt in seiner angewandten Form von Dirk Baumann und Lena Biresch und entstand „nach Christa Wolf“. Christa Wolf starb 2011 und kann sicherlich die bedeutendste Schriftstellerin der DDR genannt werden, hoch geschätzt und viel gelesen auf beiden Seiten der deutschen Grenze. Ihre „Erzählung“ (Untertitel) „Kassandra“ kam in Westdeutschland 1983 heraus, ein mit nicht einmal 160 Seiten recht schmales, also wichtiges Buch, in dem die Schriftstellerin eine antike Heldin frauenbewegt, soziologisch und mit kühlem Intellekt erforscht.
Wenn Christa Wolfs Kassandra im Rückblick ihr Leben erzählte, so vermeinte man bei der Lektüre immer auch die Schriftstellerin selbst zu vernehmen, seelisch und methodisch mit ihrer Heldin nahezu verschmolzen. Auch vom Alter her war der Rückblick eine plausible Form des Erzählens. Somit ist der Vortrag des Textes durch eine junge Frau zunächst einmal irritierend. Was Bettina Lieders Kassandra im Dortmunder Schauspiel zornig, traurig, aufgewühlt erzählt, kann sie ja noch gar nicht erlebt haben.
Doch andererseits ist alles schon angelegt, es gehört zur Menschheitstragik, daß man vieles kommen sehen könnte, wenn man es denn wollte. Und nicht den letztlich wohlfeilen Zorn der Götter zur Ursache allen Übels erklärte. So gesehen ist eine jugendliche Kassandra eine stimmige Besetzung, denn es war ja ihr Los, vorher schon Bescheid zu wissen. Und nicht gehört zu werden. Und so zum Sonderling zu werden.
Auf unerwartete Weise lädt die Einrichtung des Stoffes von Dirk Baumann und Lena Biresch (auch Regie) dazu ein, über göttliche Fügung, Tragödie, Erkenntnis oder auch Verantwortung nachzudenken, wie es das Bühnenbild (Ausstattung: Mareike Richter, Licht: Rolf Giese) beizeiten schon nahelegte. Und die Sympathie des Abends gehörte selbstverständlich der kämpferischen Darstellerin.
Die nächsten Termine: 9., 25. April, 23. Mai. www.theaterdo.de
Jüngst wurden einige gewichtige Neuübersetzungen aus dem Englischen vorgelegt. Kürzlich besprachen die Revierpassagen neue deutsche Fassungen von T.C. Boyles „Wassermusik“ und von Joseph Conrads „Lord Jim“. Hier geht es abermals um einen Klassiker: „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson.
Ob Mark Twain oder Marcel Proust, Henry James oder Bertolt Brecht: Sie alle haben „Die Schatzinsel“ geliebt und sich von Robert Louis Stevensons Reise in den Abgrund der Seele inspirieren lassen. Denn die Fahrt der „Hispaniola“ geht ja nicht nur zu einer exotischen Insel, sondern ins Herz der finstersten Gemeinheit, dahin, wo nur noch nackte Geldgier und purer Neid herrschen.
Wenn die um Long John Silver versammelten Piraten vom mutigen Jim Hawkins und seinen Freunden daran gehindert werden, sich den sagenumwobenen Schatz des Käptn Flint anzueignen, geht es nicht nur um ein blutiges Abenteuer, sondern um den Verlust aller Illusionen. Überleben kann nur, wer schlau ist und vor List und Tücke nicht zurückschreckt.
Was anderswo als Weltliteratur gilt, wurde in Deutschland bisher zumeist als Jugendbuch gelesen und in gekürzter oder kindlich eingedampfter Weise übersetzt. Die Neuübersetzung von Andreas Nohl begeistert dagegen nicht nur mit großer Werktreue und vorsichtig modernisierter Wortwahl, sondern auch mit vielen Hintergrundinformationen, Worterklärungen und Erläuterungen nautischer Begriffe.
So erkennen wir endlich Stevensons Roman als das, das er immer war: ein literarischer Geniestreich und ein Meisterwerk der Moderne. Höchste Zeit, noch einmal mit all den dubiosen und verkommenen, seriösen und skurrilen Figuren in See zu stechen und die Schatzsuche noch einmal ganz neu zu beginnen. Wie recht Italo Calvino doch hatte, als er meinte: „Ich liebe Stevenson, es gibt einem das Gefühl des Fliegens.“
Robert Louis Stevenson: „Die Schatzinsel“. Roman. Neuübersetzung von Andreas Nohl. Carl Hanser Verlag, München, 384 Seiten, 27,90 Euro.
Welch ein machtvoller Roman! Man spürt schon beim Einstieg den schweren Ernst, die Größe und Tiefe. Wahrlich kein Wunder, dass es „Lord Jim“ von Joseph Conrad zu einiger Berühmtheit gebracht hat. Jetzt liegt der monumentale Titel in neuer Übersetzung vor. Eine lohnende Anstrengung, die uns den Klassiker wieder näher bringen kann.
Jener Jim heuert auf dem Pilgerschiff „Patna“ an, das Hunderte von armseligen Passagieren an Bord hat. Das Schiff, auf dem ein wahrhaft hässlicher Deutscher das Kommando führt, ist ein durch und durch maroder Seelenverkäufer.
Durch eine fluchwürdige Reihe von Zufällen gerät Jim (Häufig wiederholter Ausruf oder auch Seufzer: „Er ist einer von uns“) in eine furchtbar schuldbehaftete Lage: Es sieht ganz danach aus, als hätte er mit dem üblen Kapitän und ein paar anderen Halunken vor einem vermeintlichen Schiffsuntergang frühzeitig die Flucht ergriffen und die schlafenden Passagiere ihrem Schicksal überlassen. Während der Käpt’n sich vollends davonstiehlt, ist Jim Manns genug, als einziger vor Gericht die Verantwortung zu übernehmen. Doch sein Leumund ist damit ein für allemal zerstört. Von der Selbstachtung gar nicht zu reden.
Joseph Conrad erzählt, zumeist aus der Perspektive des erfahrenen Seemanns Marlow, wie die – wenn auch unwillentliche – Verfehlung ein junges, anfangs aussichtsreiches Leben zerfrisst. Schon ein Gran Verderbtheit oder auch nur Trägheit kann, so erweist sich, alle guten Anlagen nachhaltig vergiften. Die Fährnisse auf hoher See führen allemal in kaum auszulotende Untiefen der Seele. Hier erfährt man, wie es gehen kann, wenn einer sich wirklich ein Gewissen macht. In Zeiten vielfachen Gewissensverlustes ist dies also per se eine aufrüttelnde Lektüre.
Die Übersetzung ergeht sich hie und da in wahren Gedankenstrich-Orgien, die Sprache gerät immer wieder ins Stocken und lässt geradezu körperlich spüren, wie sich Jim selbst peinigt und quält. Unverhofft erhält er später eine zweite Chance, indem er einen äußersten Handels-Vorposten auf einer fernab von aller westlichen Zivilisation gelegenen Insel betreuen darf und gleichsam ein hoch geachteter, weil „unfehlbarer“ Beschützer der Eingeborenen wird. Kann er dadurch sein vorheriges Versagen gleichsam tilgen? Ach!
Wenn man so will, ist „Lord Jim“ schon so etwas wie ein Vorbote des Existenzialismus. Heftiger in eine böse, grenzenlos in Unordnung geratene Welt geworfen ward bis dahin selten eine andere Figur. Und wie verzweifelt, verloren, gottfern und von allen Menschen verlassen dieser Jim sich fühlt: „Wer sein Schiff verliert, der verliert seine ganze Welt; die Welt, die ihn gemacht hat, erhalten hat, versorgt hat.“ Alle inneren und äußeren Katastrophen sind fortan denkbar, jeder Halt ist trügerisch. Wenn man nun erwägt, dass dieser Roman im Jahr 1900 erschienen ist, am Beginn eines Jahrhunderts also, das alle (un)vorstellbaren Gräuel mit sich gebracht hat…
Als Triebkräfte menschlichen Leidens werden nicht zuletzt Neugier und Zweifel ausgemacht, zwei Haltungen, die gemeinhin vor allem als Tugenden gelten. Doch hier wendet sich noch jede Hoffnung zur Nachtseite. Was Wahrheit sei, kann letztlich nicht mehr gesagt werden, ein zentraler, lapidarer Satz lautet: „Es gab keine Gewissheit (…)“. Und so erscheint denn auch Jim selbst geisterhaft undurchdringlich.
Uns Heutigen mag die schuldbeladene Gewissenserforschung allzu herzensinnig und ausufernd erscheinen, doch man sollte sich dieser unzeitgemäßen Mühe unterziehen. Dringlicher Hinweis im Roman: „Erst wenn wir uns mit dem tiefsten Nöten eines anderen Menschen befassen, begreifen wir, wie unverständlich, unbestimmt und flüchtig die Wesen sind, die mit uns den Anblick der Sterne und die Wärme der Sonne teilen.“
Joseph Conrad: „Lord Jim“. S. Fischer Verlag. Neu übersetzt von Manfred Allié (nach der Kritischen Ausgabe, 1996 bei W.W. Norton & Company – New York/London – erschienen). 493 Seiten. 22,99 Euro.
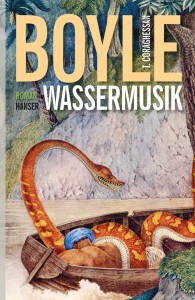 Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks veröffentlicht T. C. Boyle seit 30 Jahren in kurzen Abständen seine Romane und Erzählungen.
Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks veröffentlicht T. C. Boyle seit 30 Jahren in kurzen Abständen seine Romane und Erzählungen.
Bei diesem Schreibrausch des US-Autors ist sein 1982 in einem Kleinverlag erschienenes Debüt „Wassermusik“ fast in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, wie jetzt eine Neuübersetzung belegt.
Boyle reist mit dem Afrika-Forscher Mungo Park ins Herz der Finsternis und beutet dessen Aufzeichnungen poetisch aus. Weil Mungo Park von seiner zweiten Niger-Expedition (1806) nie wieder zurückgekehrt ist, kann Boyle das im Dunkeln der Geschichte liegende Scheitern nach Belieben ausschmücken.
Ein parallel verlaufender Handlungsstrang spielt in England. Im Mittelpunkt: Ned Rise, der stets Glück im Unglück hat, sogar seine eigene Hinrichtung am Strick überlebt und im Leichenschauhaus zu neuem, frechem Leben erwacht. Ned Rise ist eine ins Groteske gewendete Oliver-Twist-Figur, ein Satiriker der sozialen Verwerfungen.
Wie es Boyle es gelingt, den (frei erfundenen) Überlebenskünstler Ned Rise und den (historisch verbürgten) Afrika-Forscher Mungo Park literarisch zusammenzubringen, das ist ganz großes Erzähl-Kino, komisch, abenteuerlich, berührend und unvergesslich. Eine wild wuchernde Geschichte, die zwischen märchenhafter „Tausend-und-einer Nacht“-Fantasie und sozialkritischem Charles-Dickens-Realismus angesiedelt ist. Großartig.
T.C. Boyle: „Wassermusik“. Roman. Neuübersetzung: Aus dem amerikanischen Wnglisch von Dirk van Gunsteren. Carl Hanser Verlag, München 2014, 576 Seiten, 24,90 Euro.
 Nun kommt das 100-jährige Chaos auch als Film: Jonas Jonassons Erstling, der mich als Hörender platt machte. Das muss ich sehen.
Nun kommt das 100-jährige Chaos auch als Film: Jonas Jonassons Erstling, der mich als Hörender platt machte. Das muss ich sehen.
Allan Karlsson soll zum so sehr besonderen Anlass seines 100. Geburtstages ein Fest im Altenheim von Malmköpping gegeben werden, eine Vorstellung, der Allan nur ungern und missvergnügt entgegen sieht. Und so fasst der ungewöhnlich rüstige ältere Herr einen wegweisenden Entschluss. Er öffnet das Fenster seines Altenwohnraumes, zwängt seine Gestalt trotz zugegebenermaßen rostiger Gelenke durch die Öffnung und entweicht in eine ihm fast unbekannt gewordene Freiheit. Wie der Titel schon sagt: „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“.
Und dann beginnt eine Handlung, deren Absurdität nur einer übertreffen kann, der Autor Jonas Jonasson selbst, was er auch mit dem Nachfolgewerk „Die Analphabetin, die rechnen konnte“ tat. Doch noch sind wir bei Allan, der seine bewegungsallergische Gestalt hinaus in die nahe Ferne bewegt und an einer Bushaltestelle die erste Begegnung mit menschlichen Wesen der Gegenwart hat. Mit einem jungen Mann, der Allan bittet, mal kurz auf seinen Trolleykoffer aufzupassen, während er sich im WC erleichtern will.
Gutmütig willigt der alte Mann ein, klettert aber, als der Jüngling nicht schnell genug zurückkehrt, in den pünktlich eintreffenden Bus Richtung Strängnäs und entschwindet, mit Koffer und Inhalt, der aus sehr viel Geld besteht, wie sich später herausstellt.
Nun beginnt sich um Allan, während er sich immer weiter vom behaglichen Altenheim entfernt, ein Freundeskreis zu scharen, der seinesgleichen sucht. Es beginnt mit dem 70-jährigen Forstdieb Julius Jonsson, bei dem der gutherzige Kofferdieb einkehrt und alsbald wieder von dem ihn wütend verfolgenden Jüngling eingeholt wird, den die beiden Greise aber ungewollt nach kurzem Kampf einfrieren, weil sie vergessen, die Kühlung im Gefrierraum abzustellen, in den sie den Ganoven, Mitglied einer Rockerbande, einsperren.
Der sich zufällig erweiternde Freudeskreis gewinnt Julius, den Langzeitstudenten, hinzu, den ehemaligen Imbissbudenbesitzer Benny Ljungberg und die einsam auf ihrem Hof lebende Gunilla Björklund, auch „die Schöne Frau“ genannt, die eine aus einem Zoo in Växjö entflohene Elefantendame namens „Sonja“ ständig mit sich führt. Später gesellen sich noch der Rockerbandenchef und der ermittelnde Polizeibeamte dazu, der eine, weil er seinen Kindheitsfreund in der schrillen Gesellschaft wiedertrifft, der andere, weil er die Nase voll hat vom Leben des Beamten.
Zwischen die krassen Ereignisse rund um den wachsenden Kreis irrer Neuzeitgenossen streut Jonasson die Rückblenden auf das lange Greisenleben, vom begabten Jung-Sprengmeister, über den beiläufigen Geistesblitzer, der das Manhattan-Projekt in Los Alamos rettet und zum besten Kumpel von Harry Truman wird, mit Zwischenstation in China, wo er Maos Frau vor den bösartigen Attacken der Chiang Kai-chek-Gattin bewahrt bis zum Gefängnis in Teheran, wo Allan den staatsbesuchenden Churchill von einem fiesen Attentat bewahrt. Ach ja, und Stalin trifft er auch…
Episch breit und nie breit getreten, keine Sekunde langweilig, bunt und schrill wandert die Geschichte durch die Jahrzehnte, geleitet von einem zunächst beschränkt wirkenden Helden, dessen unbedarfte Art ihn stets die direktesten Wege gehen lässt, und der dabei über Brücken läuft, die kein anderer erkennt. Beiläufig zupfen Jonassons Figuren schier allem, was hohen Rang oder historischen Wert hat und an Institutionen, die mehr um ihrer selbst als wegen ihres gesellschaftlichen Gewichts existent gehalten werden, jede erdenkliche Maske der Seriosität ab.
Peter Weis‘ sonores Organ erzählt über 13 Stunden lang, als sei es sein eigenes Leben…
Jonas Jnasson: „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Gelesen von Peter Weis. 13 Stunden und 25 Minuten. Der Hörverlag.
Kinostart: 20. März 2014 (u. a. Camera und Cinestar (Dortmund) / UCI, Union und Casablanca (Bochum) / Cineworld (Lünen) / Schauburg (Gelsenkirchen) / CinemaxX und Lichtburg (Essen))
 Spätestens die diesjährige Leipziger Buchmesse machte deutlich: Scheitern ist wieder ganz groß im Kommen. Seit mindestens dreißig Jahren wartet eine älter werdende Generation auf die Wiederherstellung des guten Rufs der Erfolglosigkeit, und nun, da sich der Wunsch endlich erfüllt, schwingen sich Jüngere zu den Propheten und Protagonisten des neuen Scheiterns auf.
Spätestens die diesjährige Leipziger Buchmesse machte deutlich: Scheitern ist wieder ganz groß im Kommen. Seit mindestens dreißig Jahren wartet eine älter werdende Generation auf die Wiederherstellung des guten Rufs der Erfolglosigkeit, und nun, da sich der Wunsch endlich erfüllt, schwingen sich Jüngere zu den Propheten und Protagonisten des neuen Scheiterns auf.
Katrin Bauerfeind scheitert vergnüglich, wobei sie das tägliche kleine Scheitern der großen Katastrophe vorzieht. Beim neuen Flughafen Berlin Brandenburg habe man schließlich auch nicht die Rollbahn vergessen, sondern es seien 70.000 Einzelmängel, die sich zum großen Fiasko summierten.
Ariadne von Schirach gebietet im Titel ihres neuesten Buchs den zahlreichen Leserinnen und Lesern gar: „Du sollst nicht funktionieren“. Gut. Wenn sie das sagt, tun wir das in Zukunft nicht mehr und raffen all unseren Mut zusammen, um unvollkommen zu bleiben. In Deutschland scheitern wir gern auf Befehl. Zumindest fühlen wir uns wohler, wenn wir uns auf jemanden berufen können, der immerhin auf einem für philosophische Fragen reservierten Forum zum Scheitern aufruft.
Der Schweizer Lukas Bärfuss beschreibt in seinem Roman „Koala“ den nach diesem auf australischen Eukalyptusbäumen faul abhängenden Tier benannten Halbbruder des Protagonisten, der jede Arbeitsaufnahme verweigert und sich schließlich tötet. Hans-Ulrich Treichel schildert nicht ohne Selbstironie in „Frühe Störung“ eine Lebensvariante aus dem Akademikerprekariat, gepaart mit dem Versagen angesichts der Anforderungen einer sterbenden Mutter. Und der in Berlin lebende Peter Wawerzinek erzählt in „Schluckspecht“ sehr erfolgreich eine Alkoholikerbiographie (wobei zumindest die beiden letztgenannten Autoren nicht mehr zur jüngeren Generation gezählt werden dürfen).
Wollte man jedoch eine einigermaßen repräsentative Auskunft darüber wagen, in wie vielen der zigtausend Neuerscheinungen dieses Frühjahrs lustvoll und virtuos oder auch ungewollt gescheitert wird, an einer solchen Erhebung müsste man notwendigerweise scheitern.
• Katrin Bauerfeind: Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag. Geschichten vom schönen Scheitern. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2014, ISBN 978-3-596-19891-7.
• Ariadne von Schirach: Du sollst nicht funktionieren. Für eine neue Lebenskunst. Tropen Verlag. Berlin 2014, ISBN 978-3608503135
• Lukas Bärfuss: Koala. Roman. Wallstein, Göttingen 2014, ISBN 978-3-8353-0653-0
• Hans-Ulrich Treichel: Frühe Störung. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3518424223
• Peter Wawerzinek: Schluckspecht. Roman. Galiani Berlin, 2014, 978-3869710846
 Diese junge Frau ist ständig auf dem Sprung. Immer ist sie unterwegs durch den Dschungel der Großstadt. Ziellos hetzt sie von einem Szene-Lokal zum nächsten.
Diese junge Frau ist ständig auf dem Sprung. Immer ist sie unterwegs durch den Dschungel der Großstadt. Ziellos hetzt sie von einem Szene-Lokal zum nächsten.
Nirgendwo findet sie Ruhe, Halt, Geborgenheit. Fast scheint es, als würde sie fliehen. Die Frage ist nur: wovor? Was hat sie Furchtbares erlebt, dass sie fast keinem Menschen mehr trauen mag und sich freiwillig in ein soziales Niemandsland begibt? Warum sucht sie, die doch schon als Schauspielerin und Model gearbeitet hat und in der Kulturschickeria Berlins bestens bekannt ist, die Nähe von Pennern und Flaschensammlern? Warum wohnt Isabel neuerdings in einer dieser anonymen Plattenbausiedlungen und verdient sich ein Zubrot damit, dass sie – eingesperrt in einen Keuschheitsgürtel – einem perversen Paar beim Sex zusieht?
„Isabel“, der neue Roman von Feridun Zaimoglu, stellt viele Fragen und gibt nur wenige Antworten. Der türkischstämmige Autor, der seit vielen Jahre in Deutschland lebt und mit „Kanak Sprak“ seinen größten Erfolg feierte, unternimmt eine literarische Exkursion an die Ränder der Gesellschaft, geht dorthin, wo Berlin nicht mehr sexy, sondern nur noch arm ist.
Hier gibt es keine kulturellen Verbindlichkeiten mehr, hier leben die Gestrandeten und Hoffnungslosen. Eben solche Außenseiter wie Isabel. Sie hat, wie ihr Erfinder, türkische Wurzeln. Aber das ist nicht wichtig. Denn Zaimoglu hat keinen Roman über die Ausgrenzung und Benachteiligung von Migranten geschrieben, und eigentlich hat er auch keinen Berlin-Roman verfasst. Die wuselige Großstadt ist nur Kulisse für ein literarische Spurensuche und experimentelle Versuchsanordnung: Was kann man erzählen über das Leben eines Menschen, der sich einkapselt und nicht mehr reden mag?
Und so wie Isabel nicht mehr reden mag über all die Gewalt und die Erniedrigungen, die sie erlebt hat, begibt sich auch der Erzähler auf einen Weg ins Verstummen: Seine Wörter uns seine Sätze sind bis aufs Skelett abgemagert. Die Dialoge bestehen nur noch aus Wortfetzen, die Beobachtungen und Beschreibungen gleichen Leerstellen, die der Leser selbst auffüllen muss.
Aber wollen wir das wirklich? Wollen wir uns ausmalen, auf welche Weise Isabels Freundin Juliette ums Leben kam? Oder uns vorstellen, welche Grausamkeiten wohl Marcus, der junge Soldat, im Kosovo erlebt hat? Marcus ist der einzige Mensch, der Isabels Vertrauen gewinnen kann. Denn hier haben sich zwei verwandte verlorene Seelen getroffen. Dass es für die beiden kein richtiges Happy End geben kann, haben wir uns schon gedacht. Dass die Gewalt aber immer weiter zunimmt und den Roman fast unter sich begräbt, hat uns dann doch ziemlich sprachlos gemacht.
Feridun Zaimoglu: Isabel. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln. 237 S., 18,99 Euro.
Seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten – ach, eigentlich immer schon, seit es Schriftzeichen gibt – wird um den Bestand der Lese- und Schreibkultur gebangt. Zugegeben: Man bangt ja auch gerne mit.
Aber: Es ist auch schon eine Binsenweisheit, dass – allen Bilderfluten zum Trotz – das Internet eine neue Verschriftlichtung mit sich bringt. Früher war die Schwelle zum Schreiben und vor allem zum freimütigen Herzeigen des Geschriebenen bedeutend höher. Doch nun darf jede(r) ‚ran, auch wenn sämtliche Balken der Rechtschreibung und Sinngebung sich biegen. Manche feiern das als Zeichen der Demokratisierung und wollen alles, alles gelten lassen. Jeder Mumpitz speichert und versendet sich, ob gesimst, im Netzwerk, im Chat oder sonstwo. Herrje!
Und die Lesekultur, wenn wir denn großzügig von „Kultur“ reden wollen? Hat sich natürlich längst vom Papier gelöst. Beim Urlaub auf einer südlichen Insel ist es mir jetzt abermals aufgefallen, deutlicher denn je: Die Zahl der elektronischen Lesegeräte übersteigt inzwischen an den Stränden die der herkömmlichen Bücher. Da kalauerte mir durch den Kopf, es gebe entlang der Küstenlinie mehr Kindles als Kinder. Hehe, Hauptgag! Tä-tääää!
Gut, manchmal muss jemand sein ach so schickes Apparätchen schwenken und schwenken, bis das Sonnenlicht nicht mehr blendet. Aber dafür flattert auch nichts im Winde. Außerdem kann diese Jemandin theoretisch fünfzig Romane mit sich führen – praktisch ohne Mehrgepäck; während Unsereiner schleppt und ächzt.
Derlei Vorteile könnten einen fast zum Umstieg bewegen. Doch wenn ich dann diese lässigen Wischbewegungen sehe, die das Umblättern simulieren sollen! Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass man auf diese Weise mit solch heißem Herzen liest wie ehedem. Aus dem schier atemlosen Leser von einst wird ein Achwasweißich. Ein Seitenwichser. Ach, da habe ich mich doch glatt vertippt. Egal. Ist doch eh alles wurscht.
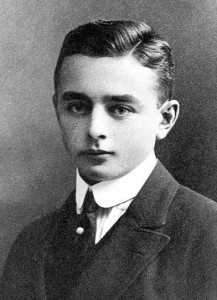
Georg Heym gilt als Begründer der frühen expressionistischen Lyrik. 1911 verfasste er die wichtigen Gedichtsammlungen „Die Stadt“ und „Der Krieg“.
1914 – Das Gedenken an einen der markantesten Punkte der deutschen/europäischen Geschichte, von manchen als Ur-Katastrophe des Kontinents bezeichnet, ist vielfältig. Das Jahr, in dem der 1. Weltkrieg ausbrach, und heuer ein Zentenarium zurückliegt, haben Historiker und andere Geisteswissenschaftler zum Anlass genommen, um in Buchform erneut auf die Ereignisse zu blicken – sei es in Form einer Gesamtschau oder in der Fokussierung auf Einzelaspekte. Zahlreiche Museen, auch und besonders in Nordrhein-Westfalen, wollen das Interesse ebenfalls wecken – mit zahlreichen Dokumenten oder Zeugnissen der Kunst jener Zeit.
Vom Allgemeinen zum Besonderen: Die Bochumer Symphoniker haben einen Reigen namens „Endspiel“ aufgelegt – Konzerte, Musiktheatralisches, Lesungen und ausgewählte Bildbetrachtungen (in Kooperation mit dem Museum Bochum) sollen nicht zuletzt auf die Verflechtung der Künste in der Vorkriegszeit hinweisen. Das Schlüsselwort ist der Expressionismus, der in der Literatur die Einsamkeit des Menschen im Moloch Großstadt anprangert, dann wieder jubilierend vom Aufbruch in bessere Zeiten schwärmt, oder in aller Düsternis die Schrecken des „großen Krieges“ vorausahnt. In der Musik wiederum entsteht eine Gegenbewegung zu Romantik und Impressionismus – Arnold Schönberg und die „2. Wiener Schule“ lösten sich von alten tonalen Strukturen, beschworen den Ausdruck als wirkmächtigstes Merkmal einer Komposition.
Exemplarisch blicken die Bochumer Symphoniker in einer gesonderten, vierteiligen Reihe auf dieses Wechselspiel von Dichtung (Textauswahl: Werner Streletz) und Musik . Der Titel „Menschheitsdämmerung“ verweist auf das Endzeitdenken vieler Autoren jener Jahre, und der erste Abend, „Verfall und Aufbruch“ überschrieben, zeugt von Ambivalenz: hier die Hoffnung auf neue Ufer, dort Resignation bis hin zur Todessehnsucht. Veronika Nickl und Martin Bretschneider vom Bochumer Schauspiel lesen die Lyrik von Georg Trakl, August Stramm, Ernst Wilhelm Lotz oder Georg Heym eindringlich, ohne ins falsche Pathos zu verfallen. Und wenn Lotz’ Gedicht „Aufbruch der Jugend“ in flammenden Worten vom Wegfegen der Alten, von leuchtenden neuen Welten spricht, und Martin Bretschneider dann fast nüchtern feststellt, Lotz sei im Alter von 24 Jahren in den Schützengräben des 1. Weltkriegs umgekommen, dann wird die grausige Tragik jener Zeit beklemmend greifbar.
Gelesen und musiziert – es spielt das heimische Streichquartett „Bermuda4“ – wird im Bochumer Wassersaal. Gut 160 Menschen hören zu. Der Raum, mit seinen halbrunden Bögen wie ein Gewölbe wirkend, weist erstaunliche akustische Qualität auf. Das Quartett – mit Raphael Christ und Katrin Spodzieja (1./2. Violine), Marko Genero (Bratsche) und Wolfgang Sellner (Cello) – klingt noch in den zartesten Strukturen von Anton Weberns Bagatellen op. 9 sehr präsent. Die aphoristische, spieltechnisch komplexe, fragile Musik des Schönberg-Schülers ist in ihrem Wechsel zwischen Aufbäumen und Ersterben sinnfällige Ergänzung zur expressionistischen Lyrik.
Frühe Werke Weberns wiederum – „Langsamer Satz“ (1905) und Rondo (1906) – verweist in ihrem dunklen, elegischen Tonfall sogar noch auf Johannes Brahms. Es ist deshalb nur folgerichtig, dass „Bermuda4“ zum Ausklang dessen 2. Quartett spielt. Mit eindringlicher, teils großer Geste wird die bisweilen fiebrige Musik interpretiert, so ernst und kernig wie strahlend, wenn auch mit wenigen Problemen in der Tongebung.
Die weiteren Termine der Reihe „Menschheitsdämmerung“ sind der 11. und 25. Mai sowie der 22. Juni (Beginn jeweils 19 Uhr).
Kaum jemand hat das Scheitern so gekonnt zu seinem Markenzeichen gemacht wie Samuel Beckett. „Wieder scheitern. Besser scheitern“, heißt es in Worstward Ho (Aufs Schlimmste zu; 1983). Die Anfänge des großen Prosaisten, Lyrikers und Dramatikers, der seine Bühnenfiguren in Mülltonnen steckte oder bis zum Hals in einem Erdhügel vergrub, der in seiner Romantrilogie systematisch den Erzähler abschaffte und vor dessen vernichtendem Denken sich kaum eine literarische Gattung retten konnte, die Anfänge sind inzwischen als autobiographische Zeugnisse in Form von Briefen nachlesbar.
Beckett hatte vor seinem Tod im Jahr 1989 verfügt, dass nur solche Briefe veröffentlicht werden dürfen, die für sein Schaffen von Belang sind. Nach und nach entdeckte die Beckett-Forschung, in welchem Maße sich der Autor – wenn auch teilweise bis zur Unkenntlichkeit verschlüsselt – aus Erlebtem bedient hat. Erben und Herausgeber einigten sich auf die Publikation von 2.500 der ca. 15.000 bekannten Briefe, verteilt auf vier Bände.
Der erste Band, 2009 in England und im vorigen Jahr in einer gelungenen Übertragung von Chris Hirte auf Deutsch erschienen, umfasst den Zeitraum 1929–1940. In diese zwölf Jahre fallen mehrere Veröffentlichungen, die den späteren Literatur-Nobelpreisträger allerdings noch nicht berühmt machten – das sollte sich auch für weitere zwölf Jahre bis zu Warten auf Godot, das im Januar 1953 uraufgeführt wurde, nicht ändern.
Da wäre zunächst Whoroscope – ein Langgedicht, mit dem der Vierundzwanzigjährige seinen ersten Literaturpreis gewonnen hat und das sich all denen nicht vollständig erschließen kann, die zum Beispiel nicht dieselbe Descartes-Biographie wie Beckett gelesen haben.
Sein Essay Proust (1931) verkaufte sich akzeptabel; eine weitere von Beckett vorgeschlagene Monographie zu André Gide aber wollte der Verleger nicht folgen lassen.
Für seinen ersten fertiggestellten Roman, Dream of Fair to Middling Women, fand Beckett keinen Verleger – nicht zu seinem Schaden. Der frühe Romanversuch, den Beckett später als „unreif und unwürdig“ bezeichnen und nicht mehr zur Veröffentlichung freigeben würde, enthält mehrere akademisch verbildete oder in Joyce’scher Manier strapaziöse Passagen. Zugleich verrät Beckett darin ungeschützt biographische Details, die auch seine Jugendlieben in unvorteilhafter Weise erscheinen lassen. Das Werk diente jedoch als Steinbruch für den 1934 veröffentlichten Band mit Erzählungen, More Pricks Than Kicks (in deutscher Übersetzung: Mehr Prügel als Flügel).
Es folgte 1935 unter dem Titel Echo’s Bones and Other Precipitates ein Band mit Gedichten, deren Urfassungen Beckett teilweise als Anlagen mit seinen Briefen versandt hat und die in die vorliegende, gut kommentierte, Ausgabe aufgenommen wurden.
Schließlich Murphy, der Roman, der nach zweiundvierzig Ablehnungen im Jahr 1938 endlich bei im Londoner Verlag Routledge erscheint, was Beckett zu dem Zeitpunkt beinah schon gleichgültig zur Kenntnis nimmt. Murphy gilt zu Recht als geniales Frühwerk, nicht zuletzt aufgrund der dort wiedergegebenen Notation einer Schachpartie, die Becketts Denken vielleicht im Kern zutreffender charakterisiert als viele Worte. Jedoch hatte Beckett darin noch nicht zu seinem minimalistischen Stil gefunden, in den er sich im Lauf seines Lebens zunehmend, besser gesagt: abnehmend, hineinschreiben wird.
In den Briefen rund um die mühselige Verlagssuche tauchen bereits die resignierten, lakonischen, selbstironischen Töne auf, für die man Beckett später verehren wird.
„Du weißt, dass ich überhaupt nicht schreiben kann. Der einfachste Satz ist schon Folter“ – am 25. Januar 1931 an Thomas McGreevy. Weiter am 8. November desselben Jahres: „Schreiben kann ich überhaupt nicht, mir nicht mal die Umrisse eines Satzes vorstellen oder Notizen machen“ (ebenfalls an McGreevy). Schließlich, im August 1932: „Zu schreiben habe ich gar nicht erst versucht. Schon der Gedanke ans Schreiben scheint mir irgendwie lächerlich.“ Oder noch genereller an seine Tante Cissie: „Arbeiten kann ich nicht. Einen Monat schon gebe ich mir nicht mal den Anschein von Arbeit“ (14. August 1937).
Was wüssten wir über Samuel Beckett, wäre da nicht der Freund? „Ich hätte niemals einen so detaillierten und auf Tatsachen gestützten Bericht über Becketts Leben, Gedanken und Ideen schreiben können, hätten mir nicht seine Briefe an McGreevy zur Verfügung gestanden“, berichtet seine erste Biographin, Deirdre Bair.
Der dreizehn Jahre ältere Thomas McGreevy war Becketts Vorgänger als Englisch-Lektor an der École Normale Supérieure in Paris. Als Beckett ihn 1928 auf dieser Stelle ablöste, blieb McGreevy zunächst in der französischen Hauptstadt, machte Beckett u. a. mit James Joyce und seinem Umfeld, später mit dem Maler Jack B. Yeats und dem Verleger Charles Prentice (Teilhaber von Chatto and Windus) bekannt; er ermunterte ihn zu dem Essay über Marcel Proust und entfachte seine Begeisterung für bildende Kunst. In ihrer jeweiligen Haltung zu Irland allerdings gab es zwischen den beiden erhebliche Differenzen; die irisch-katholische Vaterlandsliebe seines älteren Freundes konnte Beckett nicht nachvollziehen.
Einzelne Textstellen aus den mehr als dreihundert erhaltenen Briefen an Thomas McGreevy übernahm Beckett in seine Prosatexte und Stücke. In die Korrespondenz investierte er mitunter mehr Zeit als in sein – im engeren Sinne – literarisches Schreiben. Obgleich auch die Briefe nicht ohne literarische Finessen sind. Der deutsche Titel des ersten Bands der Briefausgabe, „Weitermachen ist mehr, als ich tun kann“, ist ein Zitat aus einem Brief vom 26. März 1937 an seinen ehemaligen Studienkollegen vom Trinity College Dublin, Arland Ussher.
Das Schreiben schien ihm aber damals noch keine Notwendigkeit gewesen zu sein, anders als ab 1942, als er sich mit seiner späteren Frau Suzanne – beide waren für die Résistance tätig – im südfranzösichen Roussillon (Vaucluse) vor den Nazis versteckte.
Noch 1937 teilt er McGreevy mit: „es ist weiß Gott nicht so, dass ich jemals gewünscht hätte, mein Leben mit Schreiben zu verbringen.“ Er bewarb sich um eine Dozentur für Italienisch an der Universität Kapstadt („Mir ist wirklich gleichgültig, wohin ich gehe oder was ich tue“). Zeitweise liebäugelte er auch mit der Vorstellung, Pilot zu werden. Ein Praktikum beim Film scheiterte – Sergei Eisenstein reagierte nicht auf seine Bewerbung. Über Nino Frank, den er auf einer Party bei den Joyces trifft, meint er: „Er kann mich hier mit Filmleuten in Kontakt bringen, falls ich überhaupt jemals noch mit jemandem Kontakt haben will“ (am 11. Februar 1939 an McGreevy).
Ein wichtiges Thema in den Briefen, über das zu sprechen Beckett in späteren Interviews rigoros ablehnte, betrifft das gespannte Verhältnis zu seiner Mutter. Immerhin zahlte sie ihm eine Psychotherapie in London, die nur das Ziel haben konnte, den Sohn von der Mutter zu heilen. Beckett, der sich in London auch einen Vortrag von C. G. Jung anhörte, berichtet dem Freund über die fragwürdigen Erfolge der zahlreichen Sitzungen mit seinem Arzt Wilfred Ruprecht Bion.
Letztlich aber half nur die räumliche Distanz vom Elternhaus in dem gepflegten Dubliner Vorort Foxrock. In Paris hielt er sich von 1928 bis 1930 und dann kontinuierlich ab 1937 auf, in London während der langwierigen Therapie 1934/1935 und oftmals zu verschiedenen Besuchen bei Freunden. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Briefwechsels spiegelt seine frühen Deutschlandreisen wider, zunächst in den Jahren 1928/1929 von Paris aus nach Kassel zu seiner damaligen Geliebten Peggy Sinclair, die zugleich seine Cousine war und deren fehlerhaftes Englisch er in Traum von mehr bis minder schönen Frauen (übernommen auch in den Band mit Erzählungen, Mehr Prügel als Flügel) festhält. Dann die halbjährige Deutschlandreise 1936/1937 mit ausgiebigen Besuchen in Kunstmuseen, was ihm zur Vorbereitung einer Karriere als Kurator (die er nie beginnen sollte) ein willkommener Vorwand war, seiner ihn vereinnahmenden Mutter zu entfliehen. Beckett lernt in Deutschland viele Persönlichkeiten aus dem Kunstbetrieb kennen und erlebt mit, wie sogenannte „entartete“ Kunst in den Kellern verschwindet, Museumsleiter oder Kunsthistoriker von ihren Posten suspendiert, Künstler und Intellektuelle jüdischer Herkunft diskriminiert werden.
In München sah und bewunderte er Karl Valentin – „Komiker allererster Sorte, aber vielleicht gerade am Beginn seines Niedergangs“, wie er am 30. März 1937 an Günter Albrecht schreibt. Durch Albrecht lernte er den späteren Rowohlt-Lektor Axel Kaun kennen, der ihm Gedichtbände von Joachim Ringelnatz zur Übersetzung ins Englische antrug („meiner Ansicht nach nicht der Mühe wert“ – 9. Juli 1937). Der Hamburger Teil der „German Diaries“ wurde 2003 in einer bibliophilen Ausgabe veröffentlicht.
An illustren Namen unter den Briefempfängern oder in den Briefen auftauchenden Personen fehlt es nicht. Da wäre zuallererst das frühe Vorbild James Joyce, der in Beckett seinen talentiertesten Assistenten fand, der aber auch als Erster an Becketts Krankenbett erschien, nachdem dieser bei einer Messerstecherei lebensbedrohlich verletzt worden war.
Mit der Kunstmäzenin Peggy Guggenheim, die er auf James Joyces Geburtstag 1938 kennenlernte, verband Beckett vom selben Abend an eine Liaison. Sehr hilfreich sind im Anhang die Kurzporträts der wesentlichsten Briefempfänger und mehrerer in den Briefen genannter Personen. Durch die Briefausgabe gewinnen wir auch Einblicke in Becketts frühe Lektüre: Dante, Samuel Johnson, Sade, Schopenhauer, Gontscharows „Oblomow“, die Surrealisten Paul Éluard und André Breton, in Deutschland auch (auf Empfehlung eines Freunds) Hans Carossa.
Der letzte Brief in Band 1 datiert vom 10. Juni 1940, einem Montag. Für den Freitag derselben Woche möchte er sich mit dem Malerfreund Bram van Velde zu einer Partie Billard im Café des Sports verabreden – „All das unter der Voraussetzung, dass wir in Paris bleiben.“ Diese Partie musste leider auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Am 12. Juni bestieg Beckett einen der letzten Züge von der Gare de Lyon nach Vichy, wo die Joyces sich aufhielten“, wie wir durch seine Biographin Deirdre Bair erfahren – „Seine Papiere waren nicht in Ordnung, und Geld hatte er auch keines (…). Er wusste, dass er in Vichy nicht bleiben konnte, denn die Stadt füllte sich zusehends mit Regierungsbeamten, die nach der Besetzung von Paris und dem Fall Frankreichs hier eine neue Regierung aufbauen sollten. (…) Am 13. Juni machte Beckett sich zu Fuß gen Süden auf, fand jedoch bald einen Zug, der hoffnungslos verspätet war und nur sehr langsam vorankam. Beckett zwängte sich hinein, hockte sich in eine Ecke und schaffte es auf diese Weise bis nach Toulouse. Ehe der Zug die Stadt erreichte, sprang Beckett ab und entging damit der Internierung von Ausländern in einem Flüchtlingslager.“ (Deirdre Bair: Samuel Beckett, Reinbek bei Hamburg, 1994, S. 393)
Becketts O-Ton zu den Kriegs- und Nachkriegsjahren 1941–1956 liegt seit dem September 2011 als Band 2 der englischen Briefausgabe vor. Die deutsche Übersetzung erwarten wir mit Ungeduld.
Samuel Beckett:
Weitermachen ist mehr, als ich tun kann – Briefe 1929–1940
Herausgegeben von George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn und Lois More Overbeck
Aus dem Englischen und Französischen von Chris Hirte
Mit zahlreichen Abbildungen
Frankfurt a. Main (Suhrkamp), 2013
Gebunden, 856 Seiten, D: 39,95 €
ISBN: 978-3-518-42298-4

Angstvoller Blick: Der Jäger (Sebastian Kuschmann) bedrängt Schneewittchen (Eva Verena Müller). Foto: Hupfeld
Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Männer, die sich oder anderen Eingeweide herausreißen, Gliedmaßen verstümmeln. Dazu heulen die Wölfe. Ein Höllentrip ist das. Unterlegt mit teils psychedelischer oder traumverlorener, teils illustrativer, geräuschträchtiger und die Ohren malträtierender Musik. Willkommen im fiesen Brutalo-Kosmos der Grimm’schen Märchen, das Massaker ist angerichtet. Serviert im Schauspielhaus Dortmund.
Seitdem dort Kay Voges das Intendantenruder in die Hand genommen hat, darf sich das Publikum immer wieder auf allerlei Experimentelles, Skurriles, Grelles und Verstörendes einlassen. Da fügt sich die Regisseurin Claudia Bauer, die nun also Hand anlegt an ein deutsches Heiligtum, an die märchenhafte Romantik im Dunstkreis eines Mythos namens Wald, aufs Schönste ein. In dieser Mixtur aus Splatter-Movie, Spießbürger-Ambiente, sanfter Traumerzählung oder geschriener Suada bleibt kein Auge trocken.
Schneewittchen, Dornröschen, Rotkäppchen, Rapunzel – wer kennt sie nicht, die „Heldinnen“ von Jacob und Wilhelm Grimm, die gewiss allerlei Gemeinheiten, Eifersuchtsszenen, Bedrohungen oder Anschläge aufs Leben erleiden und erdulden müssen, die am Ende aber doch ihren Prinzen finden, glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben … „und wenn sie nicht gestorben sind…“. Wer aber weiß die Gedichte zu benennen, die die amerikanische Autorin Anne Sexton unter dem Titel „Transformation“ geschrieben hat, als Adaption eben jener Märchen? Die Wert legt auf die kriminelle Energie der Figuren, auf drastische Schilderung von Verhältnissen und auf das von Pessimismus durchtränkte Fazit, dass Happy Ends gänzlich unangebracht sind?
Nun, in Dortmund ist’s zu erleben. Vor allem mit Hilfe der Macht der Bilder. Mit überdrehten, überzeichneten Figuren, sich teils gruselig, dann wieder sanft bewegend. So sind Traum und Trauma im romantisch-modernen Textgemenge nah beieinander. Wer aber die Hintergründe nicht kennt – Anne Sextons Psychosen, ihre Versuche, Lyrik als Therapie einzusetzen, letzthin der Selbstmord (nach zwei Suizidversuchen) –, dürfte wohl etwas ratlos das Theater verlassen.
„Hüte Dich“ wird oftmals geraunt. „Mehr Raum“ schreit’s am Beginn von „Hänsel und Gretel“. Ein Blick auf die altbacken eingerichteten, miefigen, hübsch hässlichen Zimmerchen, die Ausstatter Andreas Auerbach als zweigeschossigen Loft auf die Drehbühne gewuchtet hat, reicht, um verständnisvoll zu nicken. An diesen Orten des Grauens vergeht sich der Froschkönig an der Prinzessin, verblutet das Rumpelstilzchen, müssen sich die Stiefschwestern Aschenputtels die Füße abtrennen lassen.
„Republik der Wölfe“ ist diese Abfolge von Schändlichkeiten übertitelt. Jaja, der Wolf ist in die Deutschen Wälder zurückgekehrt. Und dass der Mensch in gewisser Hinsicht des Menschen Wolf sei, propagierte schon Thomas Hobbes. Daran scheint Regisseurin Claudia Bauer anzuknüpfen. Wenn auch manche drastische Szene im zirkulierenden Horrorhaus einen Hauch von Geisterbahnatmosphäre ausstrahlt, zeigt doch die dunkle Seite der Romantik wirkmächtig ihr grausiges Gesicht. Wenn aber ausgerechnet der böse Wolf, nachdem er die Großmutter gemeuchelt hat und in ihre Kleider geschlüpft ist, von Rotkäppchen aufs Schärfste verführt wird, dann scheint die Regie einem Augenzwinkern nicht widerstehen zu wollen.
Doch im Grunde sind die Dinge, die hier verhandelt werden, von ernster Art, das Böse lauert immer und überall, es gibt kein Entrinnen. Sinnbildlich dafür steht das Ringen der Grimm-Brüder um den rechten Verlauf jeder Geschichte. Wie siamesische Zwillinge kleben die beiden aneinander. Wilhelm sagt: „Jacob, Du kannst nicht alle Märchen gut ausgehen lassen“ (ganz im Sinne von Anne Sexton). Der Angesprochene aber will sich lösen, der Wald soll ihn das wirkliche Leben lehren.
Am Ende des gut 100-minütigen Spektakels aber ist der Fokus ganz auf die somnambul wirkende Schauspielerin Eva Verena Müller gerichtet. Die anfangs mit großen, ängstlichen Augen uns anblickt, als Schneewittchen in anmutigen Todesschlaf sinkt, als Dornröschen aufwacht, nicht weiß, ob sie in der Wirklichkeit angekommen ist. „Ich würde so gerne etwas erleben“, sagt sie, begleitet von sanften, melancholischen Klängen.
Das macht die Band, die sich passend zum Stück „The Ministry of Wolves“ nennt, ganz vorzüglich. Paul Wallfisch, Alexander Hacke, Danielle de Picciotto und Mick Harvey sind in großer Virtuosität daran beteiligt, aus der Szenenfolge ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Eines, das indes schmerzlich bewusst macht, dass die alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, schon lange vorbei sind.
Wie inszeniert man Franz Kafkas Roman „Der Prozess“ für die Bühne? Ganz offensichtlich reizt der Stoff die Theaterleute, in den vergangenen Jahren hat es in der Region etliche Versuche gegeben, abgründige, kryptische, pompöse: 2010 in Wuppertal, 2012 in Düsseldorf, 2013 in Essen, und die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit. Keine dieser Inszenierungen aber geriet so minimalistisch wie die von Thorsten Bihegue und Carlos Manuel auf der Studiobühne des Dortmunder Schauspielhauses.

Der Angeklagte und seine Wärter: Josef K. (Björn Gabriel, Mitte), Willem (Andreas Beck, Links) und Franz (Uwe Rohbeck, rechts) (Foto: Birgit Hupfeld/Schauspiel Dortmund)
„Nach dem gleichnamigen Roman von Franz Kafka“ (Untertitel) agieren dort, unmittelbar vor den Füßen der Zuschauer in der ersten Reihe, drei Männer und eine Frau in wechselnden Rollen. Nur der vierte Mann bleibt immer Josef K., gegeben wird er von Björn Gabriel. Und die Frage, die schnell sich über den Köpfen des geneigten Publikums nebelgleich erhebt, ist natürlich: Geht das? Funktioniert dieser geheimnisvolle, psychologisch aufgeladene, beengende und bedrückende Stoff noch, wenn man ihn ähnlich inszeniert wie ein naturalistisches, schmutziges, kleines englisches Theaterstück à la Dennis Kellys „Waisen“ ,das ebenfalls auf dem Spielplan des Dortmunder Schauspiels steht?
Sagen wir es mal so: Das, was hier von der Vorlage an „Kafkaeskem“ übrigbleibt, ist sicherlich nur ein kleiner Teil. Doch in der Einrichtung des verantwortlich zeichnenden Regie-Duos entsteht gleichwohl ein passables, schlüssig ablaufendes Bühnenstück, das in seinem linearen Aufbau stellenweise den Charakter einer Nummernrevue hat. Es erzählt, stark gerafft und vereinfacht ausgedrückt, wie die völlig absurde alptraumhafte Situation des Verhaftetseins aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet schnell eine Qualität des Normalen entwickelt. Für die Wärter ist der Umgang mit Verhafteten etwas Normales, Repression und Großherzigkeit im Kontakt mit Josef K. sind ihre üblichen Umgangsformen; Fräulein Bürstner aus dem Büro weiß – wie vermutlich das gesamte Büro – schon von der Verhaftung des Prokuristen K., der ja weiterhin arbeiten gehen darf, der Onkel will helfen, der Maler vermitteln, der Advokat schließlich, seinerseits mit großer Machtfülle ausgestattet, dem Angeklagten sein Ohr leihen. Und bald schon scheint es hauptsächlich darum zu gehen, wie man aus der Sache herauskommt, ohne daß die Sache, eine Straftat demnach, je erkennbar geworden wäre. Es gibt, erfährt das Publikum, wirklich Freisprüche, scheinbare Freisprechungen und die Verschleppung des Prozesses. Sollte man sich also auf einen „Deal“ einlassen?

Frau Bürstner (Merle Wasmuth) und Josef K. (Björn Gabriel) (Foto: Birgit Hupfeld/Schauspiel Dortmund)
Für die jugendlich-karge Dortmunder Inszenierung nimmt ein, daß sie scheinbar anstrengungslos immer wieder Bezüge zum realen Justizgeschehen unserer Tage schafft, zur vielfach üblich gewordenen Trennung von Tat und Urteil beispielsweise, die eher der Bequemlichkeit und der allseitigen Zufriedenstellung huldigt als dem Streben nach Gerechtigkeit und Sühne. Sehr viel mehr allerdings sollte man nicht erwarten. Wenn Merle Wasmuth uns in verschiedenen Frauenrollen auf die eine oder andere Art sexuelle Verführung und Obsession vorspielt, dann ist das möglicherweise zwar der Versuch, einen Hinweis auf (unterdrückte) sexuelle Anteile in der Verursachung der einen oder anderen Irritation des Josef K. zu geben, mehr aber nicht. Auch hält sich diese Inszenierung nicht damit auf, den Romantitel in seiner zweifachen Bedeutung auszuschmecken, nach der „Prozess“ ja nicht zwingend einen solchen vor Gericht bedeutet, sondern auch als Synonym für eine undurchschaubare innere Entwicklung stehen kann. Sonderbare Entwicklungen sind, man denke nur an den armen Käfermann Samsa, ja geradezu ein Markenzeichen für Franz Kafkas Werk. Aber das wäre dann Psychologie, vielleicht gar Psychoanalyse, wie sie in etwa zeitgleich zur Entstehung des Romans von Siegmund Freud in Wien formuliert wurde. So etwas bleibt hier außen vor.
Den Schauspielern ist es zu danken, daß dieser Theaterabend anregend und streckenweise durchaus auch unterhaltsam gerät. Der massige Andreas Beck und der zierliche Uwe Rohbeck geben schon rein äußerlich ein komisches Aufseherpaar ab, Sebastian Graf weiß den obrigkeitlichen Anteil seiner verschiedenen Rollen überzeugend auszuspielen. Björn Gabriel in der Titelrolle schließlich kommt dem literarischen Vorbild eines Dreißigjährigen sehr nahe. Mit seinem leichtem Unterspielen akzentuiert er geradezu die ungeheuerliche Situation, in der er sich plötzlich befindet.
Dem Personal auf der Bühne galt am Premierenabend der größte Applaus.
Die nächsten Termine 23. Februar und 8. März sind ausverkauft. Weitere Termine werden noch bekanntgegeben. Theaterkasse: 0231 / 50 27 222
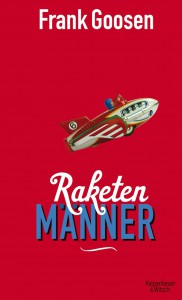 Bei Elton Johns Song „Rocket Man“ heisst es „I’m not the man they think I’m at home“. Frank Goosen selbst sagte in einem Interview*, diese Zeile sei ihm die Inspiration für seinen Buchtitel gewesen. Es sind Geschichten von Männern, die die Rakete starten wollten, aber mit diversen Fehlzündungen hadern.
Bei Elton Johns Song „Rocket Man“ heisst es „I’m not the man they think I’m at home“. Frank Goosen selbst sagte in einem Interview*, diese Zeile sei ihm die Inspiration für seinen Buchtitel gewesen. Es sind Geschichten von Männern, die die Rakete starten wollten, aber mit diversen Fehlzündungen hadern.
Frank Goosen erzählt von geschiedenen Vätern, von Chefs, die in Konferenzen von einem Haus am Meer träumen, von alten Schulfreunden, die in grauer Vergangenheit leidenschaftlich gemeinsam in einer Band schrammelten, von Männern, für die das Leben eine einzige Spätpubertät ist.
Es sind kleine Geschichten, die doch von den großen Lebensthemen handeln: Wehmut, Ernüchterung, der Macht von Vergangenheit und Erinnerung, Träumen, Plänen und was am Ende davon übrig bleibt. So erzählen Goosens Raketenmänner vom Leben und vom Tod sowie dem Frieden, den man damit machen kann – oder eben nicht. Geschichten, jede für sich stehend, aber doch zusammengehörig. Manche Männer treffen wir in einem anderen Umfeld, einer anderen Geschichte wieder. Manch loser Faden fügt sich wieder zusammen, so dass das Buch am Ende keine Sammlung von Kurzgeschichten ist, sondern ein in sich abgerundeter Episodenroman.
Im Buch ist „Raketenmänner“ der Titel einer vergessenen, unbekannten Schallplatte (für die jüngeren Leser: Das sind diese runden, schwarzen Dinger aus Vinyl). Die Raketenmänner tauchen aus dem Dunkel eines alten Plattenladens auf und stehen für das einzig Perfekte, das ein Musiker mit dem bezeichnenden Namen Moses je hervorgebracht hat. Wie ein roter Faden zieht sich diese Platte durch die Geschichten und spielt im Leben mehrerer Männer eine wichtige Rolle.
Goosens Stil in diesen Geschichten ist wie die Musik auf der Platte: „schlicht, ohne Show und Schnörkel. Da trifft einer, ohne zu zielen.“ Mit feinem Sprachwitz und trockenem Humor lässt Goosen zeitweilig auch Melancholie und Nostalgie zu. Rechtzeitig findet er aber immer wieder zurück zu ironischer Distanz, so dass Sentimentalität gar nicht erst aufkommt. „Raketenmänner“ ist ein wesentlich reflektierteres Buch als die beiden letzten des vor allem im Ruhrgebiet äußerst beliebten Autors.
Nach dem kommerziell völlig zu Unrecht nicht so erfolgreichem Roman „So viel Zeit“ konnte man bei Goosen die Befürchtung hegen, er würde sich mit Büchern wie „Radio Heimat“ oder „Sommerfest“ auf eine Art ruhrischen Heimatroman beschränken. Die „Raketenmänner“ nun zerstreuen diese Befürchtung, sie sind sozusagen die Quintessenz des lachenden Pokorny mit So viel Zeit.
Die beliebten Gassenhauer legt Goosen nun klugerweise seinen Protagonisten in den Mund, der Erzähler selbst gönnt sich schöne einfühlsame Bilder wie die „vom Himmel über den abgeschlossenen Geschichten“ oder „vom Irgendwann, dem Land, in dem die schönsten Dinge passieren“. Sätze, für die man manche Geschichten schon vom ersten Absatz an mag, auch wenn man noch gar nicht weiß, worum es geht. Sätze, die so für sich alleine stehen bleiben könnten, eine ganze Geschichte, ein ganzes Leben, in einem Satz erzählt.
Natürlich sind es wie immer Geschichten mit hohem Wiedererkennungswert. Eins der größten Talente des Autors ist seine exzellente Beobachtungsgabe. Der Tonfall eines jeden Charakters ist wunderbar getroffen, man hat sie sofort vor Augen: den schnöseligen Unternehmensberater, den träumerischen Schallplattenverkäufer, die Frau, die man(n) nur noch als Frau Dingenskirchen in Erinnerung hat.
Wie so oft bei Frank Goosen werden viele Geschichten von Musik begleitet. Die lautlosen Geschichten, die keinen Soundtrack haben sind auch die hoffnungslosen. In den anderen Geschichten ist es die Musik, die Leben retten, begleiten und beenden kann. Wie in der letzten Geschichte, die ein würdiger Schlusspunkt geworden ist. Eine Geschichte wie ein Traum von einem Rockkonzert, einem Konzert von „einfachen Leuten“ für „Raketenmänner“ oder umgekehrt. So sind die Raketenmänner ihre eigene Hymne geworden: Auf die Freundschaft, für die Verwirklichung von Träumen und eine verständnisvolle Liebeserklärung an die Männer mit all ihren Bemühungen und all ihrem Scheitern. Kurze Geschichten, geschrieben von einem Mann über Männer, bei weitem aber kein Buch nur für Männer. Schließlich wollen auch wir Frauen gerne wissen, wie Männer ticken. Vor allem die, die so gerne „Raketenmänner“ wären.
Bei aller Freude über ein sehr gelungenes neues Buch von Frank Goosen – eins kann der Autor fast noch besser als schreiben: nämlich lesen. Vorlesen. Den Tresenleser vergangener Tage hat er in sich bewahrt. Meiner eigenen Erfahrung nach werden seine Geschichten erst dann so richtig rund, wenn er sie selber liest und kommentiert. Termine finden sich auf seiner Homepage. Gerüchten zufolge gibt es noch einzelne Tickets.
Frank Goosen: „Raketenmänner“. Verlag Kiepenheuer und Witsch. 233 Seiten, € 18,99
Homepage des Autors: frankgoosen.de
(* Interview in der allgemeinen Frankfurter Sonntagszeitung vom 2. Februar 2014)
In der Regel hat der Weg in der westlichen Leistungsgesellschaft ein Ziel. Man geht zur Arbeit oder zum Supermarkt, man muss Behördengänge erledigen, die alte Mutter besuchen, für den Halbmarathon trainieren, Schuhe kaufen oder wenigstens Brötchen holen. Auch die systematische Besichtigung historischer Innenstädte in artigen Gruppen oder mit Hilfe eines gedruckten Reiseführers ist durchaus üblich.
Der Flaneur (aus dem Französischen: flaner = umherstreifen, schlendern) braucht alle diese Gründe nicht, um stundenlang durch eine Stadt zu bummeln. Er hat keine Eile, er lässt sich treiben. Mal beobachtet er die Schwäne auf dem Stadtteich, mal lauscht er einem Straßenmusiker, mal trinkt er einen Espresso, sieht Passanten hinterher und lässt die Zeit vergehen. Ein Flaneur verfolgt keinerlei praktischen, wirtschaftlichen oder sportlichen Nutzen. Er sammelt Eindrücke.
Inspirationen suchen
Das ist für emsig arbeitende Menschen eher suspekt. Der kleine Müßiggang beim Cappuccino wird zwar mittlerweile akzeptiert, man darf mal Pause machen. Aber nicht zu lange, dann muss man wieder ins Büro. Oder wenigstens ins Sportstudio. Der Flaneur lächelt nur milde, grüßt flüchtig und schlendert weiter, um die nächste Ecke. Das ist seine liebste Beschäftigung. Für einen Faulenzer darf man diesen Charakter dennoch nicht halten, denn er registriert alles.
Viele Dichter und Journalisten verschafften sich flanierend ihre Inspirationen. Der Beschwörer des Unheimlichen zum Beispiel, Edgar Allan Poe, ließ den Ich-Erzähler seiner Novelle „Der Mann in der Menge“ (1838) nach langer Krankheit „an dem Bogenfenster des vielbesuchten Café D. in London“ Platz nehmen und das städtische Leben beobachten: „Das Gefühl der wiederkehrenden Kräfte hatte mich in jene glückliche Stimmung gebracht, die das Gegenteil von Langeweile ist, alle Sinne schärft, aufnahmefähiger macht… Alles, selbst Unbedeutendes, nötigte mir eine ruhige, forschende Teilnahme ab.“ Durch die dunstbeschlagenen Scheiben späht der Mann auf die Straße hinaus, Poe lässt ihn unermüdlich die Vorübergehenden beschreiben: die Herrschaften und Hausierer, die Bettler und Spieler, die Kuchenverkäufer und Trunkenbolde bis hin zu einem kleinen alten Mann, dessen satanisches Gesicht ihn derartig fasziniert, dass er ihm folgt – durch den Nebel der Nacht.
Kunst der Wahrnehmung
Flanieren, lernt man aus diesem Stück Literatur, hat nichts mit Dösen zu tun. Es verbessert vielmehr die Wahrnehmungsfähigkeit. „Flaneure sind Künstler, auch wenn sie nicht schreiben“, behauptet der holländische Schriftsteller Cees Nooteboom in einem Essay für die „Zeit“: „Sie sind zuständig für die Instandhaltung der Erinnerung, sie sind die Registrierer des Verschwindens, sie sehen als erste das Unheil, ihnen entgeht nicht die kleinste Kleinigkeit.“ Kein Riss im Parkhaus-Beton, keine Bausünde, keine Verwahrlosung. Und kein Vogelzwitschern im Gebüsch.
Hans Dieter Schaal, der jenseits der Szene arbeitende Architekt, Bühnenbildner, Dichter und Denker, fühlte sich von den Städten, die er besuchte, so vielfältig angeregt, dass er im Jahr 2009 seine „Stadttagebücher“ veröffentlichte. „Ich bin Erlebender und Beobachter“, schrieb Schaal im Vorwort: „Ich schaue mir die Gebäude, Straßen, Plätze, Märkte Fußgängerzonen, Malls und die Menschen an, lasse die Oberflächen auf mich wirken, spüre den Atmosphären nach. Manchmal überfällt mich die Angst, dann wieder fühle ich mich beglückt und bereichert.“ Knapp 700 eng bedruckte Seiten füllte Schaal mit Texten und selbst fotografierten Bildern.
Langsam gehen
Der Flaneur kann also auch besonders fleißig sein. Muss aber nicht. Er ist im Prinzip ein Zeitverschwender, gibt Nooteboom zu. „Wenn ich an all die Stunden – und allmählich Jahre – denke, die ich durch die Straßen der Welt geschlendert bin, dann hätte ich in dieser Zeit die gesammelten Werke von Hegel und Kant mit der Hand abschreiben können“, scherzt er. Stattdessen habe er „ein Buch gelesen, das nie zu Ende geht, ein Buch, dessen Kapitel und Buchstaben aus Gebäuden, Standbildern, Straßen, Autobussen und Menschen bestehen“.
Als „Lektüre der Stadt“ bezeichnete schon der Autor und Rowohlt-Lektor Franz Hessel (1880-1941) das Flanieren. In seinem Buch „Spazieren in Berlin“ feierte er 1929 das zweckfreie Schlendern: „Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspült von der Eile der anderen, es ist ein Bad in der Brandung.“ Allerdings registrierte Hessel in der geschäftigen Metropole auch misstrauische Blicke: „Ich glaube, man hält mich für einen Taschendieb.“ In Paris, wo Hessel vor dem Ersten Weltkrieg einige glückliche Jahre verbrachte, war das anders: Das Flanieren als Lebensart wurde dort im späten 19. Jahrhundert erfunden und von Autoren wie Marcel Proust („Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“) gefeiert. Wie viele Bilder der Impressionisten zeigen, liebte man das zweckfreie Bummeln besonders, seit die französische Hauptstadt kein Labyrinth stinkender Gassen mehr war. Der Präfekt Georges-Eugène Baron Haussmann hatte großzügige Boulevards und lauschige Passagen angelegt – das ideale Terrain für den Flaneur, den Charles Baudelaire, Poet der „Blumen des Bösen“, als „Künstler, Mann von Welt, Mann der Menge und Kind“ beschrieb.
Melancholischer Voyeur
Nach Ansicht des deutschen Philosophen und Proust-Übersetzers Walter Benjamin (1892-1940) ist der Flaneur ein Süchtiger, ein melancholischer Voyeur, ein Detektiv und ein Verdächtiger zugleich. Benjamin widmete dem Phänomen sein unvollendetes „Passagen-Werk“, dessen Durcharbeitung allerdings nur strebsamen Geisteswissenschaftlern zu empfehlen ist. Alle anderen sollten einen leichten Mantel anziehen und einfach nach draußen gehen, in die Stadt, zum Flanieren.
Zitat:
„Hierzulande muss man müssen, sonst darf man nicht. Hier geht man nicht wo, sondern wohin. Es ist nicht leicht für unsereinen.“
(Franz Hessel, Flaneur)
Und wo bleibt die Flaneuse?
Frauen haben offensichtlich immer was zu tun. Jedenfalls kennt die Literatur keine Flaneuse. So, wie sich die Männer bei der Arbeit entschlossen bis stur auf ein Ziel konzentrieren, sind sie auch in Sachen Müßiggang durch nichts abzulenken. Immerhin gibt es bei Marcel Proust den Begriff der „Passante“ (französisch: Spaziergängerin). Dabei handelt es sich um vorbeiziehende, flüchtige Figuren, die alle Blicke und Begehrlichkeiten flanierender Herren ignorieren. In der Gegenwart bahnt sich zum Glück eine Änderung an. In dem Flaneur-Büchlein von Stefanie Proske (siehe Buchtipps) wird zwischen vielen Männern auch die Berliner Schriftstellerin Christa Moog zitiert: „Ich spazierte zum Grab von Kleist.“
Buchtipps:
„Das Passagen-Werk“
„Man darf, ohne Einschränkung, von einem epochalen Werk sprechen“, befand die Züricher Zeitung. Alle klugen Menschen nicken verständig, wenn von Walter Benjamins „Passagen-Werk“ die Rede ist. Jeder, der über das Flanieren philosophiert, wird es zitieren. Dabei handelt es sich um eine fragmentarische, aber überaus umfangreiche Sammlung von Texten, die durchzuarbeiten nicht gerade ein Vergnügen ist. 13 Jahre lang, bis zu seinem Selbstmord im Exil 1940, arbeitete der 1892 in Berlin geborene Philosoph an seinem Hauptwerk, einem Buch über seine Lieblingsstadt Paris – und wurde niemals fertig. Der Titel leitet sich ab von einer reichlich trockenen Abhandlung über die Geschichte der im 19. Jahrhundert erbauten Passagen, jene überdachten Gassen für den flanierenden Genießer. Die zweibändige Textsammlung ist nur geeignet für Menschen mit entschiedenem Bildungswillen. (Walter Benjamin: Passagen-Werk. Edition Suhrkamp, 1354 Seiten, 29,90 Euro)
„Flaneure – Begegnungen“
Das rosarote, hübsch gestaltete Büchlein der Lektorin und Politologin Stefanie Proske ist so leicht, dass es der Flaneur ohne weiteres in die Tasche stecken kann. Und die Lektüre ist ein müheloses Vergnügen für ein Stündchen im Café, denn Proske hat einige kurze Beispiele aus der Flaneur-Literatur zusammengestellt. Das geht vom alten Pariser Charles Baudelaire, der „inmitten dieses in Kittel und Kattun gekleideten Volkes“ eine „große, hoheitsvolle Frau“ entdeckte, bis zum Wiener Karl Kraus: „Dagegen zog mich von jeher das Leben der Straße an…“ Ideale Lektüre für ein müßiges Stündchen im Straßencafé. (Stefanie Proske: Flaneure – Begegnungen auf dem Trottoir. Edition Büchergilde, 198 Seiten, 14,90 Euro)
„Stadttagebücher“
Als Bühnenbildner reiste der oberschwäbische Architekt, Zeichner und Autor Hans Dieter Schaal in viele Städte von Venedig bis Kuala Lumpur. Das Flanieren wird bei ihm auch immer zum Analysieren. Was er entdeckte und bedachte, sammelte Schaal in umfangreichen „Stadttagebüchern“, die mal historische Abhandlung, mal persönliche Anekdote sind. Man kann und muss das schwere, mit eigenen Fotos illustrierte Buch nicht komplett lesen – aber man kann dem Flaneur Schaal in die eine oder andere Stadt folgen. (Hans Dieter Schaal: Stadttagebücher. Edition Axel Menges, 647 Seiten, 79 Euro).
„Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler“ – das Zitat aus Shakespeares „Wie es euch gefällt“ beschreibt mit einem Satz das Grundkonzept von Martin Laberenz Inszenierung von Fjodor Dostojewskijs Roman „Der Spieler“, die jetzt im Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere feierte. Leider bleibt dies so ziemlich die einzige (tiefsinnigere) Idee, die in der dreistündigen Dramatisierung des Stoffes aufscheint. Und besonders neu ist sie auch nicht.
In einer übergroßen Roulette-Schüssel (oder ist es doch bloß eine Wäschetrommel, wie die Akteure selbst sie nennen?) bewegen sich die Figuren wie in einem Hamsterrad. Schnelles, fieberhaftes Sprechen zeigt die Nervosität der Spielsüchtigen an, die Spannung, unter der sie stehen und die Rastlosigkeit, mit der sie durch ihre Tage rasen, getrieben von der krankhaften Gier nach Geld, Geld, Geld. Allen voran Edgar Eckert als Alexej, der von zweierlei Sucht befallen ist: der nach dem Roulette und der nach Polina (Anna Blomeier), die aus finanziellen Erwägungen sich aber lieber dem Marquis des Grieux (Florian Jahr) zuwendet.
In einer Art Wortkaskaden produzierenden Improvisation eignen sich die Schauspieler nun Dostojewskijs Text an, indem sie uns, dem Publikum oder den „Gästen“, wie sie uns nennen, die Geschichte des „Spielers“ erzählen und markieren. Sie sind gleichsam Akteure in einem Drama, dessen Ausgang sie selbst noch nicht kennen, durch Zufall geworfen auf diese Bühne und vor Situationen gestellt, in denen sie plötzlich entscheiden müssen, ohne zu wissen, was das für Konsequenzen hat.
Eine Schlüsselszene dabei ist der Koffer voller Geld, der plötzlich auf der Bühne auftaucht und Alexej und seinen Freund, den Engländer Mister Astley (Sebastian Grünewald) in Panik versetzt: „Ist da eine Bombe drin? Sollen wir den wirklich aufmachen?“ Die Parallelen zu modernen Phänomen auf Flughäfen oder Bahnhöfen sind witzig ausgespielt und bergen eine gewisse Komik. Ebenso lässt das Konzept ironische Seitenhiebe auf die Situation des Düsseldorfer Schauspielhauses zu: Von plötzlich verschwundenen 5,4 Millionen Euro ist da die Rede, von einem „leergespielten Haus“ und davon, dass „wir eine Leitung brauchen“ – „Aber es findet sich ja keiner.“ Die Anspielungen auf das jüngst zutage getretene Finanzloch und die Tatsache, dass immer noch kein neuer Intendant unter Vertrag genommen wurde, nimmt das Düsseldorfer Publikum amüsiert auf. Das ist geschickt gemacht und holt die Realität rein. Nur leider gehen die originellen Ansätze zu sehr im ausufernden Ganzen unter – vielleicht würde ein wenig Straffung helfen?
Ein Lichtblick ist der Auftritt von Karin Pfammatter als Erbtante Antonida Wassiljewna, denn der Besuch der alten Dame bringt die Dramaturgie voran: Wie die mondän-zickige Millionärin vom Virus des Spiels infiziert wird, wie diese Sucht sie in Raserei und Verderben treibt, das zeigt Pfammatter mit großer Intensität und hohem körperlichen Einsatz. Buchstäblich das letzte Hemd reisst sie sich vom Leibe und liefert sich nackt und bloß den voyeuristischen Blicken der „Gäste“ aus. Zugleich gelingen die Szenen am Roulettetisch und damit im Herzen Roulettenburgs, wie Dostojewskij den Ort der Handlung genannt hat, in einer schwebenden, rauchigen und zugleich fieberhaften Atmosphäre. Manchmal können die Spieler nicht hinsehen, sobald die Kugel ihren Lauf beginnt, dann wieder starren sie ins Leere, die unterdrückte Spannung wird im Raum greifbar. Das ist gut beobachtet, so lebt ein Roman im Hier und Jetzt weiter.
Leider flacht der Spannungsbogen danach wieder ab: Die Erbtante, in die die verarmte Familie ihre ganzen Hoffnungen gesetzt hatte, verspielt alles und zieht nach Moskau ab. Die Hinterbliebenen such ihr Glück in Paris oder sonstwo, doch das vermag nicht mehr recht zu fesseln. Oder anders gesagt: „Rien ne va plus“.
Infos und Karten:
www.duesseldorfer-schauspielhaus.de
Sind es zwei, drei oder vielleicht sogar vier Geschichten, die John Cheever in seinem knapp 120 Seiten umfassenden Roman „Ach dieses Paradies“ miteinander verknüpft? Diese Frage stellt man sich als Leser unweigerlich, will man doch irgendwie die Handlungsstränge verstehen und ordnen.
Aber vollkommen unabhängig davon, auf welche Zahl man sich verständigt: Das Buch, das 1982 (im Todesjahr des Autors) erstmals im amerikanischen Original erschien, besticht durch eine einmalige Erzählkunst. Ihr ist es letztlich zu verdanken, dass die einzelnen Geschehnisse ein Gesamtbild ergeben, mit dem der Autor wohl auch eine Botschaft vermitteln will.
Dabei beginnt der Roman eher lapidar, stellt Cheever doch einen älteren Mann vor, der leidenschaftlich gern Schlittschuh läuft. Doch als der Senior eines Tages feststellen muss, dass der Lieblingsort für seinen Lieblingssport, ein idyllisch gelegener Teich, zu einer Mülldeponie verkommen ist, schaltet er sich in die politische Debatte ein. Er holt einen Umweltexperten herbei, der die Gefahren des Vorhabens für Mensch und Umwelt drastisch vor Augen führt, kämpft selbst an vorderster Front, um die Halde wieder verschwinden zu lassen.
Doch dieser Mann namens Lemuel Sears wird nicht nur in seiner Rolle als Umweltaktivist, wie man ihn heute wohl nennen würde, beschrieben, Cheever breitet auch das durchaus verstörende Liebesleben vor dem Leser aus. Dabei überrascht weniger, dass sich der Witwer zu einer jüngeren Frau hingezogen fühlt, die auch gut ohne ihn leben könnte, wie sie offenherzig zu verstehen gibt. Vielmehr ist es die Episode mit einem Fahrstuhlführer, mit dem sich der Naturfreund mir nichts, dir nichts auf ein homosexuelles Abenteuer einlässt.
Sein eigenes Handeln verwirrt Sears derart, dass er einen Psychiater aufsucht, der ihm auf der Suche nach den Beweggründen aber nur wenig weiterhelfen kann. Sears bleibt mit mehr Fragen als Antworten zurück, was sich zunächst auch auf sein Engagement gegen die Deponie übertragen lässt. Das Vorgehen der Behörden findet er befremdlich und unverständlich. Je mehr er sich jedoch in die Entscheidungsprozesse vertieft, umso deutlicher treten die Machenschaften und Intrigen zu Tage, die den Umweltfrevel überhaupt erst entstehen ließen.
Die ohnehin schon komplexe Erzählung erfährt aber noch mehr überraschende Wendungen: ein Barbier, der aus vermeintlicher Geldnot seinen Hund erschießt, die Ehefrau , die mit der Drohung, Lebensmittel zu vergiften, gegen die zu befürchtende Verseuchung des Teiches zu Feld zieht und schließlich das Baby, das auf einem Parkplatz zurückgelassen wird…
Was mag den Schriftsteller wohl motiviert haben, solche vollkommen unterschiedlichen Erzählstränge miteinander zu verknüpfen? Der Titel des Buches bietet dazu durchaus eine Spur an: Das Paradies, das Sears beispielsweise gefunden zu haben glaubt, ist durch die Müllhalde ebenso verschwunden wie die glückliche Zeit, die der Barbier in wirtschaftlich besseren Phasen genießen konnte.
John Cheever: „Ach, dieses Paradies“. Roman. DuMont Verlag. Aus dem amerikanischen Englisch von Thomas Gunkel. Mit einem Nachwort von Peter Handke. 128 Seiten, 17,99 Euro.
Irgendwann muss sich jedes Genre auch mal nobilitieren. Und so reden wir nicht mehr durchweg vom Comic, sondern raunen seit einigen Jahren gern von „Graphic Novel“, als quasi von bildnerisch gestalteten Romanen. Auf dem Felde mischt auch der ehrwürdige Suhrkamp-Verlag mit.
„Kiesgrubennacht“ heißt die umfängliche Schöpfung des Zeichners und Texters Volker Reiche. Tatsächlich gehört Reiche (der 2002 bis 2010 für die FAZ den Comicstrip „Strizz“ schuf) zu jenen, die diesen hehren Begriff adäquat füllen können. Mit diesem sehens- und lesenswerten Band beweist er es.
Reiche schildert Szenen seiner eigenen Kindheit, die Geschichte setzt im Nachkriegssommer 1948 ein, als der kleine Volker vier Jahre alt ist und in einem knallgelben „Luftanzug“ herumtollt, der zum Fanal für die verheißungsvollen Seiten des Kindseins wird.
Spiele mit Stahlhelm und Gasmaske
Diese Lebensphase, so erfahren wir, verlief damals herrlich bis grausam unbehütet, sie bestand aus vielen kleinen, oft nicht ganz ungefährlichen Abenteuern, den rauhen Charme der Kargheit inbegriffen. Zwischen den Ruinen wurde nicht selten der Krieg nachgespielt – vielfach noch mit Original-Objekten wie im Schutt gefundenen Stahlhelmen oder Gasmasken.
Und die im Titel genannte Kiesgrube? Sie verweist auf die Orte zahlloser Hinrichtungen, von denen – wenn überhaupt – nur schaudernd geflüstert wird. Die Erwachsenen aber schweigen sich aus oder reden grauenhaft naives Zeug.
Mehr als nur nebenbei zeigt sich, wie schon damals Bilderbücher und erste Comics dem kleinen Helden die Tore zu einer anderen Wahrnehmung geöffnet haben. Sonst wäre bei wachen Sinnen so manches kaum auszuhalten gewesen. Als der Junge größer wird, frisst er begierig alle Lektüre in sich hinein – heute Donald Duck und Karl May, morgen Eugen Kogons „Der SS-Staat“.
Streit mit dem Kater Paul
Das damalige Geschehen steht bei Reiche ohnehin nicht plan für sich, sondern ist durchzogen von späterer Reflexion. Da sehen wir zwischendurch immer mal wieder den Zeichner von heute, der im steten Streit mit seinen alteingeführten Figuren (Kater „Herr Paul“, Hunde Müller und Tassilo) zu ergründen sucht, wie man die Szenen einer solch frühen Lebensphase angemessen darstellt, wie verlässlich die Erinnerung überhaupt ist und wie man Gewalt bildlich fassen kann, ohne dass man ihr selbst aufsitzt oder gar verfällt. Derlei Selbstbefragungen überwuchern stellenweise gar den eigentlichen Stoff. Doch keine Angst, meistenteils wird hier mitten aus dem Leben erzählt.
Noch einmal zurück in die so fern gerückte Vergangenheit: Die Flüchtlingsfamilie wohnt mit fünf Kindern denkbar schlicht, die Kleinen müssen sich zu mehreren die Betten teilen. Wahrhaftig ruft Reiche hier mit prägnanten Bildern, ja manchmal mit veritablen Tableaus eine versunkene Welt auf. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit… Um mal ins oberste Romanregal zu greifen.
Der Vater als Herrenmensch
Es fehlt auch nicht der dramatische Handlungsstrang, dem man streckenweise atemlos folgt, weil die Bilder so überaus wirksam gesetzt sind wie Hiebe: Der Familienvater wähnt sich nicht nur als unumschränkter Herr im Hause. Dieser einstige Kriegsberichterstatter und völkische Verseschmied, der zunächst ärmlich als Foto-Vertreter neu anfangen musste, hat gewisse Denkmuster und Verhaltensweisen aus der NS-Zeit noch nicht überwunden. Doch (wie so viele damals) mag er an früher nicht erinnert werden. Bei allfälligen Wutausbrüchen schlägt der Kraftprotz seine Frau grün du blau – im Beisein der versammelten Kinderschar. Als die Familie zerbricht und die Frau mit fünf Kindern allein bleibt, ist der Herrenmensch schon wieder Amtsrichter. Ein deutsches Leben.
1973, als Volker längst erwachsen ist, gibt es noch einen bizarren Nachhall mit dem gespenstisch vital gebliebenen Vater. Eine Lehre aus dieser schmerzlichen Farce: Über solch lähmendes Entsetzen kommt man nur hinweg, wenn man es eines Tages ganz entschieden hinter sich bringt und sich nach vorn ins werdende, also schöpferische Leben wirft.
Volker Reiche: „Kiesgrubennacht“. Graphic Novel. Suhrkamp Verlag, 232 Seiten, 21,99 Euro.
Seit die Britin Lula Landry zum schillernden Top-Model avanciert ist und mit ihrer geheimnisvollen Ausstrahlung die internationale Modewelt verzückt, lernt sie auch die Schattenseiten einer Berühmtheit kennen, die, je nach Lust und Laune, von den Medien gefördert oder vernichtet wird.
Jeder ihrer Schritte wird vom Boulevard beäugt, ihr Luxus-Appartement von Paparazzi umzingelt. Selbst ihr Telefon wird abgehört. Um die Medienmeute abzuschütteln, trifft Lula private Verabredungen und Vereinbarungen nur noch vom Handy einer Freundin aus. Doch es gibt immer jemanden, der eine heikle Information aufschnappt und an die Presse verkauft. Oder jemanden, der, voller Neid und Missgunst, sein eigenes erpresserisches Süppchen kocht.
Als Lula eines nachts vom Balkon ihrer Wohnung in den Tod stürzt, deuten alle Indizien darauf hin, dass das notorisch misstrauische und seit Jahren in psychiatrischer Behandlung befindliche Model ihrem turbulenten Leben selbst ein Ende gesetzt hat. Nur ihr Bruder, ein reicher Anwalt, mag den Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen nicht glauben. Als die mediale Hysterie abgeflaut und Lulas Fall schon zu den Akten gelegt ist, engagiert er den Privatdetektiv Cormoran Strike. Dass der ehemalige Soldat, der in Afghanistan körperliche und seelische Wunden davon getragen hat, bei seiner Wahrheitssuche in einen Sumpf aus Intrigen gerät und die Welt der Schönen und Reichen als ein von Machtspielen und Medieninteressen vermintes Schlachtfeld der Eitelkeiten erlebt, verwundert kaum. Denn von der Macht der Medien und dem hoffnungslosen Versuch, sich selbst – trotz plötzlicher Berühmtheit – treu bleiben zu können, kann Joanne K. Rowling ein Lied singen.
Seit sie mit ihrer Saga um den Zauberlehrling Harry Potter in die Liga der Super-Reichen aufgestiegen ist, wird das Leben der ehemaligen Sozialhilfe-Empfängerin in der Öffentlichkeit breit getreten, wird jede private Regung, politische Äußerung und literarische Zeile mit einer Mischung aus Bewunderung, Neugier und Häme unter die Lupe genommen. Die Sehnsucht nach Anonymität muss groß gewesen sein. Vor allem, nachdem „Ein plötzlicher Todesfall“, ihr erster Roman der Nach-Potter-Ära, von der Kritik als klischeehaftes Sozial-Drama abgetan wurde.
Um ihren literarischen Wert zu testen, hat sie ihren neuen Roman, „Der Ruf des Kuckucks“, unter dem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlicht. Dass das Versteckspiel am unaufhörlichen Geplapper der modernen Kommunikationsmedien scheitern würde, hätte sie sich eigentlich denken können. Nachdem die Nachricht über die wahre Autorschaft sich via Twitter durch die globalen Netze gefressen hatte, schoss der Roman von Robert Galbraith, der vorher zwar von der englischen Kritik gut aufgenommen, von den Käufern aber eher missachtet wurde, binnen Minuten an die Spitze der Verkaufs-Charts bei Amazon. Zu dem Zeitpunkt hatte sich der Verlag Blanvalet, der keine Ahnung hatte, welche Lizenz zum Gelddrucken man da billig erworben hatte und der dann mit einer Auflage von 300 000 an den Start ging, die deutschen Rechte bereits gesichert.
Dabei ist „Der Ruf des Kuckucks“ nicht mehr, aber auch nicht weniger, als ein klug komponierter, spannend geschriebener und stilistisch sauber gearbeiteter Krimi. Die Autorin weiß, wie man die Leser bei der Stange hält und veranstaltet eine kriminalistische Schnitzeljagd. Privatdetektiv Cormoran Strike braucht lange, um zu begreifen, dass das, was unaufmerksame Zeugen, verlogene Freunde und machtgeile Medienprofis über das Leben von Lula Landry zu wissen meinen, und dass das, was sie glauben gehört und gesehen zu haben, nur selten der Wirklichkeit entspricht. Strike, unehelicher Sohn eines ehemaligen Rockstars, muss ein gigantisches Puzzle aus Halbwahrheiten, Lügen und Manipulationen neu und richtig zusammensetzen.
Strikes kriminalistisches Denken und seine Leidensfähigkeit sind geschärft, seit er in Afghanistan bei einer Militär-Einheit war, die Verfehlungen und Verbrechen der britischen Armee aufdeckt. Bei diesem gefährlichen Dienst hat Strike den Unterschenkel eines Beines verloren. Aber das kann er im Alltag genauso gut kaschieren wie die Tatsache, dass er emotional angeschlagen ist, nachdem die Beziehung zu seiner langjährigen Freundin in die Brüche gegangen ist und er auf einer Campingliege in seinem Büro seine einsamen Nächte verbringt. Zu einem derangierten Detektiv passt, da kennt das Klischee kein Erbarmen, eine umsichtige und loyale Sekretärin: Die sympathische Robin gehört zum Stamm selbstloser Frauen, die ihrem muffligen Chef den Rücken frei halten und für ein kleines Kompliment bereit sind, Überstunden und Gefahren auf sich zu nehmen.
Irgendwann sind alle Mode-Designer und Film-Mogule, alle falschen Freunde und fiesen Feinde der schönen Toten durch die Mangel gedreht, ist das kriminelle Knäuel entwirrt und der psychopathische Mörder dingfest gemacht. Bleibt die Hoffnung, dass Robert Galbraith alias J. K. Rowling den nächsten Fall etwas gradliniger angeht. Denn eine Fortsetzung wird es bestimmt geben: Strike hat schließlich noch eine Rechnung mit seinem Vater offen, und er muss herausbekommen, ob beim Drogentod seiner Mutter nicht vielleicht doch eine Mörderhand im Spiel war.
Robert Galbraith (J.K.Rowling): „Der Ruf des Kuckucks“. Roman. Deutsch von Wulf Bergner, Christoph Köhler, Kristof Kurz. Blanvalet Verlag, München 2013, 638 S., 22,90 Euro.
Schon lange hat Kurt Wallander zwei, nein eigentlich drei Wünsche: ein Haus auf dem Lande, einen Hund und, er wagt es kaum zu formulieren, eine Frau, die ihn, den oft griesgrämigen Polizisten aus Ystad, liebt und ihm behilflich ist, die Tücken des Alters zu ertragen.
Seine erste Ehefrau hat ihn schon lange verlassen. Mit seiner Tochter wechselt er, obwohl sie noch immer bei ihm wohnt, kaum zwei Worte am Tag. Jetzt, wo die Herbststürme über die hügelige Landschaft von Schonen peitschen und Wallander in seinen knackenden Knochen spürt, dass der Winter seines Lebens nicht mehr fern ist, will er dringend noch einmal seinem tristen Dasein einen letzten neuen Dreh geben.
Aber als der Kommissar hinausfährt und ein zum Verkauf stehendes Haus besichtigt, stolpert er im Garten über eine skelettierte Hand, die aus dem Boden ragt. Die sofort anrückenden Kollegen finden, als sie den Garten umgraben, die Überreste von zwei Leichen, die seit vielen Jahren dort vergraben waren. Statt Ruhe in ländlicher Idylle erwartet Wallander also doch nur wieder harte Arbeit.
Ein neuer Fall also. Hatte nicht Henning Mankell vor einigen Jahren behauptet, „Der Feind im Schatten“ sei definitiv der letzte Roman über den schwedischen Polizisten Kurt Wallander? Und waren dabei nicht, während Wallander sich im Gestrüpp einer politischen Affäre fast verlor, am Horizont die ersten Anzeichen einer Demenz erkennbar und war nicht das Abtauchen in das endgültige Vergessen nur noch eine Frage weniger Monate oder Jahre?
Für Wallander gibt es keine Rettung, daran wird sich wohl nichts ändern. Denn der Roman „Mord im Herbst“ ist chronologisch vor dem letzten Wallander-Krimi angesiedelt, spielt im Jahre 2002 und wurde bereits 2004 veröffentlicht. Allerdings bislang nur in den Niederlanden. Henning Mankell hatte den Plot eigens für eine Aktion geschrieben, bei der jeder holländische Leser, der in einem bestimmten Monat einen Kriminalroman kauft, noch ein weiteres Buch gratis dazu bekommt.
Deutsche Fernsehzuschauer werden trotzdem das Gefühl haben, die Geschichte irgendwie zu kennen: Denn der – im Gegensatz zu allen anderen Wallander-Krimis – eher schmale Roman wurde heftig geplündert und diente später der BBC als Grundlage für ein Drehbuch zu einem Film mit Kenneth Branagh in der Rolle des Kurt Wallander. Aber Vorsicht: Die TV-Version von „Ein Mord im Herbst“ hat sich nur ein paar Ideen herausgeklaubt, bei der Suche nach der Wahrheit, der Identität der Opfer und des Mörders geht der Roman ganz andere Wege. Diese Wege sind verschlungen und reichen weit in die Vergangenheit zurück. In die Zeit, als der Zweite Weltkrieg sich dem Ende zuneigte und auch in Schweden, wo viele Flüchtlinge strandeten, die nirgends registriert wurden und die gelegentlich auch auf Nimmerwiedersehen spurlos verschwanden, das reinste Chaos herrschte.
Der Fall selbst ist nicht besonders spektakulär und im Grunde durch hartnäckige Routinearbeit und staubige Archiv-Recherchen zu lösen. Die Würze und Spannung des Romans besteht diesmal eher in seiner gedanklichen Klarheit und sprachlichen Verknappung. Während Mankell sich sonst gelegentlich selbstverliebt in Details verliert und die Wallander-Romane mit falschen Fährten und zwischenmenschlichen Problemen gehörig aufplustert, konzentriert er sich hier ganz auf die spröde Gedankenwelt des muffeligen Kommissars.
Deutlich spürbar ist, dass Wallander vieler Alltäglichkeiten überdrüssig ist und bald keine Lust mehr haben wird, den Rest seines verkorksten Lebens mit Mordermittlungen zu verbringen. Am Ende des melancholischen Buches ist der Mörder zwar bekannt. Aber der Winter ist vollends nach Schonen gekommen. Ein Haus, einen Hund und eine Frau hat Wallander immer noch nicht.
Henning Mankell: „Mord im Herbst“. Ein Fall für Kurt Wallander. Mit einem Nachwort des Autors. Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2013, 143 Seiten, 15,90 Euro.
Dieses Buch ist ein Gegenentwurf zur Kurzbotschaft des Digitalzeitalters. Es fordert, was wir gewöhnlich vernachlässigen: Aufmerksamkeit und Geduld. Auf 752 eng bedruckten Seiten erzählt der in Rottweil geborene und in Berlin lehrende Philosoph, Germanist und Autor Rüdiger Safranski (65) von Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), dem Gottvater unserer Literatur, und einem, wie Safranski sagt, „Ereignis in der Geschichte des deutschen Geistes“.
 Endloses wurde bereits über den Dichter geforscht und geschrieben, immer noch lädt er den Alltag der Nation mit Bedeutung auf. Kein Abreißkalender kommt ohne Goethe-Spruch aus, und irgendein Fetzchen seines Werks ist wohl in jedem Kopf hängengeblieben: „Über allen Gipfeln / Ist Ruh, / In allen Wipfeln / Spürest Du / Kaum einen Hauch; / Die Vögelein schweigen im Walde. / Warte nur, balde / Ruhest Du auch.“ Auch Safranski zitiert das berühmte kleine Gedicht, das der von Amouren und Zweifeln wieder einmal aufgewühlte junge Wanderer Goethe im September 1780 an die Wand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn in der Ilmenau schrieb – und das er am Tag vor seinem 82. Geburtstag 1831 wiederentdeckt, tief gerührt. „Tränen flossen über seine Wangen“, verrät der ortskundige Verwaltungsbeamte Johann Christian Mahr, der dem rüstigen Prominenten als Pfadfinder diente.
Endloses wurde bereits über den Dichter geforscht und geschrieben, immer noch lädt er den Alltag der Nation mit Bedeutung auf. Kein Abreißkalender kommt ohne Goethe-Spruch aus, und irgendein Fetzchen seines Werks ist wohl in jedem Kopf hängengeblieben: „Über allen Gipfeln / Ist Ruh, / In allen Wipfeln / Spürest Du / Kaum einen Hauch; / Die Vögelein schweigen im Walde. / Warte nur, balde / Ruhest Du auch.“ Auch Safranski zitiert das berühmte kleine Gedicht, das der von Amouren und Zweifeln wieder einmal aufgewühlte junge Wanderer Goethe im September 1780 an die Wand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn in der Ilmenau schrieb – und das er am Tag vor seinem 82. Geburtstag 1831 wiederentdeckt, tief gerührt. „Tränen flossen über seine Wangen“, verrät der ortskundige Verwaltungsbeamte Johann Christian Mahr, der dem rüstigen Prominenten als Pfadfinder diente.
Safranski berichtet nur, was er aus ersten Quellen belegen kann. Er verzichtet auf romanhafte Ausschmückungen. Dass er flüssig und allgemeinverständlich formuliert, heißt nicht, dass er fabuliert. Als unbeirrbarer Wissenschaftler bleibt er stets auf der Spur des Nachweisbaren, sämtliche Zitate werden im Anhang sorgsam zugeordnet. Wer schwärmen will von der Lovestory zwischen dem Lockenköpfchen Lotte Buff und dem verkrachten Jura-Studenten Goethe, der sollte sich lieber Philipp Stölzls rasanten Spielfilm „Goethe!“ angucken. Und in die unerfüllte, etwas peinliche Leidenschaft des alten Dichters für die 17-jährige Ulrike vertieft man sich besser mit Martin Walsers nachfühlender Erzählung „Ein liebender Mann“.
Bei Safranski landet die Empfindung immer wieder auf dem trockenen Feld der unumstößlichen Fakten, die er allerdings mit einmaliger Souveränität zu einem Ganzen fügt. Was er dem fleißigen Leser dabei vorführen will, ist nicht nur Goethes Rang als Denker und Literat, sondern auch die Fähigkeit, ein gelungenes Leben zu führen – in einer sich dramatisch verändernden Zeit zwischen dem Rokoko bis zum Einbruch der Moderne.
In 34 Kapiteln folgt Safranski seinem Idol – von der Frankfurter Kindheit als „Hätschelhans“ einer temperamentvollen Mama über das vom Vater misstrauisch gelenkte Jura-Studium bis zu den großen literarischen Erfolgen, die Goethe allerdings nie von anderen Beschäftigungen abhielten. Mit schwankender Vehemenz war er auch Politiker und Geheimrat, Zeichner und Theaterleiter, Bergbau- und Militärexperte, Naturwissenschaftler, Farbenforscher – und Abenteurer. „Meine Schriftstellerei subordiniert sich dem Leben“, stellte er selbst nüchtern fest. Und Safranski schildert nicht nur den jungen Goethe als einen Menschen, „der nach Lust und Laune vieles anfing, manches Unfertige liegen ließ“. Obgleich er ständig seine Kladden mit Eingebungen füllte, hätte Goethe, der Heißsporn, vermutlich nicht den Nerv gehabt, ein solch gewissenhaftes, dienendes Werk wie Safranskis Biografie zu erarbeiten.
Tatsächlich hat er ein ganzes Leben gebraucht, um aus dem alten Kasperletheater vom Gelehrten, der sich mit dem Teufel verbündet, seinen zweiteiligen „Faust“ zu machen, das bekannteste deutsche Drama schlechthin. Philosophie und Fantasy, Liebeswahn und Todesfurcht, Lyrik und Action, das Banale und das Erhabene werden mit diesem Gedankenspiel in einmaliger Dichte abgehandelt. Dabei betont Safranski, dass der Freigeist Goethe so wenig an den Teufel glaubte wie an einen „überweltlichen Gott“. Mephisto, „der Geist, der stets verneint“, bewahre lediglich den Menschen vor Erschlaffung. „Das Prinzip Mephisto gehört also zum Menschen“, stellt Safranski fest. Goethes Gott war die Natur in ihrer schöpferischen Kraft. „Tätigkeit ist deshalb der wahre Gottesdienst“, schreibt Safranski. Goethe formulierte dazu in der Tragödie zweitem Teil einen seiner unsterblichen Sätze: „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen“, flöten die Engel und retten den alten Sünder vor dem Höllenschlund.
Immer weitermachen, arbeiten, schöne Frauen lieben, Freundschaften schließen und Teltower Rübchen essen – das war vielleicht auch Goethes Art, dem Schicksal zu trotzen. Wie die meisten seiner Zeitgenossen hatte er bedrohliche Krankheiten und ungeheure Verluste zu verkraften. Von fünf Geschwistern überlebte nur die Schwester Cornelia. Vier seiner eigenen fünf Kinder wurden nur wenige Tage alt, und Christiane, seine sinnenfrohe, tolerante und nicht ganz standesgemäße Ehefrau, starb früh nach langer Krankheit. Trotz gewisser Rivalitäten hatte Goethe auch der Tod seines Freundes und Kollegen Friedrich Schiller 1805 tief getroffen. Aber er wandte sich immer wieder neuen Menschen, neuen Eindrücken zu. „Er liebte das Lebendige“, schreibt Safranski. Alles wurde dem Dichter zur Inspiration. „Ein Augenblick, in eine Form gebracht“, so Safranski, „ist gerettet.“
Was Goethe hemmungslos tat – Dichtung und Wahrheit vermischen – ist für Safranski tabu. Doch so streng er das Biografische auf Beweisbares reduziert, so frei entfaltet sich der Professor in seinen Interpretationen ausgewählter Goethescher Werke. Da hätte man die eine oder andere vorlesungsartige Passage getrost straffen können. Aber zum Glück macht die klare, mit Stichworten versehene Gliederung des Buchs auch ein gezieltes Lesen nach Interessenslage möglich. Eine Chronik am Ende schafft Ordnung. Wer immer strebend sich bemüht, wird viel von diesem Buch haben.
Rüdiger Safranski: „Goethe – Kunstwerk des Lebens“. Biografie. Hanser Verlag. 752 Seiten, 27,90 Euro.
Was ist das für ein Leben in der Upperclass der Vereinigten Staaten in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, auch Roaring Twenties genannt? Der Oberschicht fehlte es an nichts, materiell gesehen. Gute Jobs, gutes Geld, bester Lebensstandard.
Je mehr man aber als Leser von Pauline Manford erfährt, die in Edith Whartons Roman „Dämmerschlaf“ die Schlüsselrolle einnimmt, desto klarer wird der Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Alltag ist im Aktionismus erstarrt, ein Termin jagt den nächsten. Ob das Engagement hier und Einsatz dort überhaupt zueinander passen: Wer will das schon wissen?
Da fällt es dann auch nicht ins Gewicht, wenn Pauline ihre Rede verwechselt. Was eigentlich diejenigen vernehmen sollten, die für Geburtenkontrolle ins Feld ziehen, hörten die Befürworterinnen der uneingeschränkten Mutterschaft. Selbst, wenn es irgendwem aufgefallen sein sollte, wird er sich schnell in den Zustand geflüchtet haben, der mit Buchtitel bereits benannt ist.
Man kann vortrefflich darüber streiten, ob dieser Roman überhaupt eine Handlung hat. Man trifft sich hier, feiert dort, plant dieses Fest und jenen Charity-Termin, plaudert und parliert, wie es gerade chic ist. Wenn überhaupt von einem Handlungsstrang gesprochen werden kann, dann lässt sich nur ausmachen, dass Pauline die Krise ihres Sohnes Jim mit seiner Ehefrau Lita managen möchte. Die Schwiegertochter möchte zum Film, fühlt sich gelangweilt und will ihr altes Leben hinter sich lassen. Doch Scheidung? Das darf in damaliger Zeit nicht sein. Dabei lebt Pauline selbst auch in zweiter Ehe, hat es aber irgendwie geschafft, dass ihre Kreise sie nicht ausgegrenzt haben. So aktiv und vielseitig sie ist, dürfte es aber auch schwer fallen, sie an den Rand drängen zu wollen.
So scheint der Roman dahin zu plätschern, wobei allerdings die feine Ironie sich in der Vielzahl an kleinen Szenen zeigt. Wenn sich Pauline und ihr Mann Dexter am Tag nach einer Hausparty mühen, der gähnend langweiligen Feier doch noch ihre schönen Seiten abzugewinnen, tritt die Brüchigkeit des Systems deutlich hervor.
Womit vor allem die Frauen den lieben langen Tag verbringen (oder verschwenden), das ist schon bemerkenswert. Gesichtsmassagen in verschiedenen Varianten oder Besuche bei selbsternannten Wunderheilern sind nur zwei Beispiele dafür, dass Lebenssinn ganz unterschiedlich interpretiert werden kann. Ob ein solcher Sinn überhaupt existiert, diese Fragen lässt Paulines Familie nicht zu, allerdings mit einer Ausnahme. Tochter Nona ist so eine Art Gegenentwurf, hinterfragt sie doch gern auch mal das Treiben rund um sie herum.
Die Autorin, die von 1862 bis 1937 lebte, entstammte selbst einer wohlhabenden Familie, deren Ursprünge sich bis in die Kolonialzeit zurückverfolgen lassen, und verspürte schon in jungen Jahren eine große Distanz zu ihren Angehörigen. Die Diskrepanz zur Gesellschaft wurde ihr deutlich, als sie sich während des Ersten Weltkriegs für Flüchtlinge und Vertriebene einsetzte. Dass die US-Gesellschaft überhaupt keine Notiz nahm vom Leid dieser Menschen, war für Edith Wharton ein echtes Ärgernis. Vor einem solchen Hintergrund wird die Intention für dieses Buch umso deutlicher: Die Autorin beschreibt eine Gesellschaft, in der die Menschen letztlich nur noch um sich selbst kreisen, wenngleich sie nach Außen den Eindruck erwecken, als würden sie pausenlos für ihre Mitmenschen unterwegs sein. Aldous Huxley hat einmal behauptet, in Whartons Roman sei seine „Schöne Neue Welt“ schon längst existent.
Das Buch von Edith Wharton erschien 1927 mit dem Originaltitel „Twilight Sleep“. In Deutschland kam es unter „Die oberen Zehntausend“ heraus. In der jetzigen Ausgabe wurde der ursprüngliche Titel ins Deutsche übersetzt, wobei der Begriff Dämmerschlaf zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein medizinisches Verfahren meinte, das Geburtsschmerzen unterdrücken sollte. Da Wharton mit ihrem Buch auch unterschwellig die Sexualmoral der damaligen Zeit im Visier hatte, ist es nicht auszuschließen, dass sie bei der Wahl des Buchtitels auch an die Medizinmethode gedacht hat.
„Dämmerschlaf“ war übrigens nicht das erfolgreichste Buch der Autorin. Das schrieb sie mit „Zeit der Unschuld“, 1920 erschienen.
Edith Wharton: „Dämmerschlaf“. Roman. Manesse Verlag. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Andrea Ott. 320 Seiten, 24,95 Euro.
Will Waters, Veteran aus dem amerikanischem Bürgerkrieg, ist ein Eigenbrötler und hat kein Gespür für die Bedürfnisse und Sorgen seiner Familie. Dass er seine schwindsüchtige Frau Marantha ausgerechnet auf eine der öden Kanalinseln vor der Küste Kaliforniens bringt, ist ihr Todesurteil.
Will möchte auf San Miguel Schafe züchten, mit der Natur eins werden und seinem Leben einen neuen Sinn geben. Während er zupackt und alle Widrigkeiten ignoriert, setzen das garstige Klima und die monotone Einsamkeit Maranthas Gesundheit zu. Aufs Festland kehrt sie nur noch einmal zurück, um dort zu sterben. Jetzt ist es an ihrer Tochter Edith, sich gegen den tyrannischen Vater zu behaupten und der verhassten Insel endgültig zu entfliehen.
Schon in seinem vorigen Roman („Wenn das Schlachten vorbei ist“) hatte T. C. Boyle mit seinem Schreib-Dampfer vor einer der Kanalinseln fest gemacht. Auf Anacapa hatte er Tierschützer und Ökologen bei einem tödlich verlaufenden Streit beobachtet: während die einen ausnahmslos jedes Wesen schützen wollen, sind die anderen bereit, die Rattenplage auf Anacapa mit Gift beseitigen, um alle anderen bedrohten Tierarten zu retten.
In „San Miguel“ ist T. C. Boyle noch ein bisschen weiter aufs Meer hinaus getuckert und macht die am weitesten von seinem kalifornischen Wohnort bei Santa Barbara entfernt liegende Insel zum Schauplatz einer über mehrere Generationen und viele Jahrzehnte sich dehnenden Handlung. Im Zentrum stehen die Frauen, sie sind stark und schön und eigenwillig. Und sie leiden unter ihren Männern. Das trifft auf die kränkelnde Marantha genauso zu wie auf ihre lebenshungrige Tochter Edith.
Auch später, als nach Jahrzehnten wieder ein Paar auf die Insel zieht, muss sich die Frau gegen ihren Mann behaupten. Sie heißt Elise, war einst Bibliothekarin in New York, bevor sie mit Herbie, ihrem Mann, auf San Miguel gestrandet ist. Auch Herbie ist einer dieser Männer, die in einem Krieg gekämpft, ihre seelischen Verwundungen nie überwunden haben, aber nach außen eine harmonische Fassade aufrecht erhalten. Dass sich hinter der Idylle, die das Ehepaar der von den vermeintlichen Pionieren auf San Miguel verzückten Presse vorspielen, Abgründe lauern, wundert kaum.
Basierend auf historischen Tagebüchern und überlieferten Dokumenten erzählt T. C. Boyle in einem weit gespannten Bogen eine amerikanische Saga. Sie handelt vom Kampf gegen die Unbilden der Natur und davon, dass starke Frauen die Träume schwacher Männer ausbaden müssen. Mit bitterer Ironie erzählt der Autor, wie Lebensentwürfe und -verläufe nur selten zueinander passen. Er beobachtet mit kühlem Blick seine Romanfiguren und erkundet, ob und wie sie sich in der Natur behaupten können. Denn der eigentliche Protagonist ist die Insel selbst, ihre Schönheit und Kargheit, die es zu bewahren gilt – und doch immer wieder gefährdet ist.
T. C. Boyle, der am 2. Dezember seinen 65. Geburtstag feierte, ist der Mahner und Apokalyptiker unter den amerikanischen Gegenwartsautoren. Ob in „Willkommen in Wellville“ oder „Americá“, „Ein Freund der Erde“, „Wenn das Schlachten vorbei ist“ oder jetzt in „San Miguel“: immer wieder zeigt er, wohin es führt, wenn der Mensch keine Rücksicht auf die Schöpfung nimmt, egoistisch sich selbst verwirklichen und sich die Natur untertan machen will. Überall nur Chaos und Zerstörung und an den eigenen Lügen zugrunde gehende Menschen. Dass T. C. Boyle mit einer gelassenen Heiterkeit in den Abgrund schaut und niemals ins Predigen kommt, gehört zu seinen ganz großen Stärken.
T. C. Boyle: San Miguel. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Carl Hanser Verlag, München 2013, 447 S., 22,90 Euro.
Eine gekürzte Lesung des Romans von Jan Josef Liefers it erschienen im Hörverlag München (8 CDs, 24,99 Euro).
„Bienvenue, willkommen, welcome“ ruft der Conférencier. Aber er begrüßt nicht die Zuschauer im Kabarett, sondern im „großen Theater von Oklahoma“. Und das steht in Amerika, genauer gesagt in Kafkas „Amerika“, dem unvollendeten Roman, den jetzt das Schauspiel Köln auf die Bühne brachte.
Das Werk wurde postum 1927 veröffentlicht. Kafka schrieb zwischen 1911 und 1914 an dem „road movie“ über Karl Roßmann, der in die USA auswandert, aber nicht sein Glück macht, sondern von Menschen, Umständen und dem Schicksal herumgeschubst wird und schließlich – heute würde man sagen – Praktikant im Theater von Oklahoma wird, das „jeden gebrauchen kann“.
Das Bezaubernde an Moritz Sostmanns Inszenierung ist nun, dass sein Karl von einer Puppe dargestellt wird: Fragil, mit traurigem Gesichtsausdruck, Intellektuellenbrille und Matrosenanzug tragen die Schauspieler dem kleinen Karl auf der Bühne umher, leihen ihm ihre Stimmen und steuern seine Bewegungen. So wird die Macht der anderen über den armen Auswanderer sofort augenfällig, er ist ihr Spielzeug, ihr Werk. Seine Zartheit weckt Beschützerinstinkte, aber verführt auch dazu, ihm übel mitzuspielen, weil er so wehrlos wirkt.
Puppen- und Menschenspiel greifen dabei ineinander über, verschränken sich und geraten zu einer Einheit, die eine äußerst poetische Atmosphäre hervorruft. Man spürt, dass das Ensemble ein harmonisches Team ist: Johannes Benecke, Bruno Cathomas, Philipp Plessmann und Magda Lena Schlott tragen und treiben Karl durch die Handlung, verwandeln sich fortwährend in verschiedene Figuren, die ihm begegnen und die „neue Welt“ erzählen, in die es den Europäer verschlagen hat.
Die Beschleunigung und Technisierung des modernen Lebens wird durch Videoprojektionen (Hannes Hesse) sinnfällig, in den sozialen Beziehungen herrscht ein vom Kapitalismus geprägtes Nützlichkeitsdenken, eine freundliche und zugleich oberflächliche Brutalität. Sostmann betont diesen Zug durch einen überbordenden Humor, der jedem Schauspieler Gelegenheit gibt, die Rampensau rauszulassen, was teilweise in slapstickartigen Szenen mündet. Dabei ist dieses Lachen auch ein Lachen über Karl: Eines, das seine moralischen Prinzipien hinwegwischt und verhöhnt, eines, das deutlich macht, dass Karls Tempo und die Uhren der neuen Zeit ganz und gar nicht synchron laufen.
So kippt das Gelächter um in Traurigkeit und Melancholie, in ein Entsetzen über Menschen, die andere wie Puppen (Hagen Tilp) herumschubsen. Herr K. ist leider eine davon.
Infos, Karten und Termine:
http://www.schauspielkoeln.de/spielplan/premieren/amerika/
Ian McEwan ist jemand, der noch die wildesten oder auch trockensten Vorgänge im süffig fließenden Plauderton darzustellen vermag, ein Erzähler von hohen Graden der Unterhaltsamkeit. Die gehörige Substanz wird dabei quasi nebenher und subkutan verabreicht.
Diesmal heißt seine Hauptfigur Serena Frome. Die junge Frau stammt aus einem stocknüchternen, stocksteifen anglikanischen Bischfoshaus in der englischen Provinz. Selbst die gesellschaftlichen Bewegungen der 60er Jahre kommen dort nur äußerst gedämpft an. Aus eher unerfindlichen Beweggründen studiert Serena Mathematik, liest aber nebenher wahllos alle möglichen und unmöglichen Romane.
Durch eine ziemlich bizarre Abfolge diverser Liebschaften rutscht sie unversehens in den britischen Geheimdienst MI 5 hinein, als bessere Hilfskraft und „Tippse“. Frauen können dort schon mal gar nichts werden, es herrscht eine undurchdringliche, noch kolonialistisch getönte Herren-Hierarchie. Doch zwischen Pflichtbewusstsein und Verdruss trottet Serena jeden Tag brav ins Büro. Wenn das kein Anti-James-Bond ist! Denkt man aber ans heutige Treiben der Geheimdienste im virtuellen Raum, so ist es fast schon wieder ein bisschen nostalgisch.
Englische Krisen der 70er Jahre
McEwan zeichnet ringsum die gesellschaftlichen Spannungsfelder der 70er Jahre auf sehr lebendige Weise nach – vom traditionellem Cambridge-Milieu bis zum „Swinging London“. Alles noch sehr britisch. Doch gleichzeitig sind derlei Kategorien auch in Auflösung begriffen. Geradezu schlingernd steuert der Roman auf die Jahre 1973/74 zu, die das Königreich mit Energiekrise, Massenstreiks und zeitweise 20prozentiger Inflation in schwere See führten.
Beim Geheimdienst MI 5 bilden sich unterdessen neue Schwerpunkte heraus. Zwar operiert man selbstverständlich noch mit antikommunistischer Stoßrichtung im „Kalten Krieg“, doch wendet man sich auch schon verstärkt gegen den Terror der irischen IRA.
Kulturförderung undercover
Der eigentliche Clou ist aber die Aktion mit dem Codenamen „Honig“: Man legt ein Kulturförderprogramm auf, mit dem insgeheim etwa konservative Schriftsteller finanziell unterstützt werden sollen. Für diesen Nebenschauplatz im Kampf der Ideen hat man auch die Romanleserin Serena auserkoren, die den Autor Tom Haley betreuen soll. Von dem bekommen wir zwischendurch gleich mehrere Kurzgeschichten zu lesen, als hätte McEwan noch reichlich Überschuss in seinem Füllhorn der Einfälle gehabt. Freilich segeln diese Storys auch am Rande der Kolportage daher (was sie im Kontext des Romans umso glaubhafter erscheinen lässt).
Natürlich verliebt sich Serena in Haley. Da gleichzeitig ihr „Ex“ namens Max den Einsatz steuert, kommt Eifersuchts-Würze ins wirre Spiel. Wird Serena etwa verfolgt, wenn sie Haley im Badeort Brighton trifft? Und wer verrät dem „Guardian“ schließlich die Hintergründe des Autorenpreises, den Haley erhalten hat? Ein Schriftsteller mit Kontakt zum Geheimdienst dürfte beim Lesepublikum für alle Zeiten erledigt sein. Ein harter Schlagschatten fällt auch aufs womöglich korrupte Verlagwesen, um nicht zu sagen auf den gesamten Kulturbetrieb.
Doch damit nicht genug. Ian McEwan schuldet dem erfahrenen Leser, der es gern verschachtelt mag, ja noch die kunstreich gewobene Meta-Ebene. Also führt er uns virtuos vor, wie alles vorher Erzählte im anderen Sinne zur ungeahnten Fiktion gerät. Es ist gleichsam die (nicht unbedingt notwendige) Kür zur bravourös erfüllten Pflicht. Vielleicht hat McEwan dabei in erster Linie an literarische Preisrichter gedacht.
Ian McEwan: „Honig“. Roman. Aus dem Englischen von Werner Schmitz. Diogenes Verlag, Zürich. 463 Seiten. 22,90 €.
Beim Konzert in der Philharmonie Essen sitze ich diesmal ganz vorne, ziemlich genau in der Mitte der allerersten Reihe. Bei Bachs „Goldberg-Variationen“ mit dem Solisten Tzimon Barto tut diese Nähe gut.
Tzimon Bartos Klavierspiel ist Spiel und Arbeit zugleich. Es wirkt gelöst und doch auch angespannt; sein Spielen ist bei aller, mitunter tänzerischen Gelöstheit doch zugleich von erkennbarer Mühe, von einer außergewöhnlich konzentrierten Anstrengung geprägt.
Vergleiche mit anderen Aufnahmen der Bachschen Goldberg-Variationen, also Aufnahmen auf CDs mit Gould, Gavrilov, Koroliov, Tureck, Zhu Xiao-Mei, Stadtfeld, Schiff, stellen sich unversehens ein. Ich erinnere mich zumindest kurz an sie, lasse jedoch diesem noch nie gehörten Interpretationsangebot Tzimon Bartos den gebührenden Vorrang.
Das Scheue und das Zarte
Das Leise der Aria am Anfang kommt sehr leise, ihr Langsames geradezu betont langsam zur Geltung. Umso stärker dann der Kontrast der 1. Variation dazu! Überhaupt steht das Verhaltene, das Scheue, das Zarte im Wechsel mit dem Energischen, dem Kraftvollen, auch dem Tänzerischen.
Es ist der Auftakt zu einer Reihe von insgesamt vier Konzerten. In den nächsten drei Konzerten werden Mitsuko Uchida (22.1.2014), Lise de la Salle (16.2.) und Christian Zacharias (16.3.), die von ihnen ausgewählten Werke von Beethoven, Chopin und Schubert nicht bloß spielen, sondern auch mit Hilfe erläuternder Worte vorstellen.
Da ich die Goldberg-Variationen (BWV 988) einigermaßen zu kennen glaube, habe ich mir ein Programmheft diesmal gar nicht gekauft. Ich bin also überrascht, dass nach der längeren Pause, mit der ich nicht unbedingt gerechnet hatte, Tzimon Barto seinen Sprechpart eigen-sinnig anders gestaltet, ehe dann (erneut überraschend) noch ein anderes Bachsches Werk (BWV 590) den pianistischen Abschluss bildet.
Worte aus dem Mittelhochdeutschen
Erstaunlich artikuliert, mit sehr guter, fast akzentfreier Aussprache trägt er Texte von Hans Sachs, Walther von der Vogelweide, Heinrich von Morungen und Angelus Silesius vor. Eine strenge Chronologie zählt dabei nicht. Den historisch mittleren Text des Hans Sachs über den einbeinigen Kranich zieht er vor, bringt dadurch effektvoll die Lacher auf seine Seite und öffnet so die Verständniswilligkeit des Publikums für die nachfolgenden Texte. Zu den neuhochdeutschen Übersetzungen der mittelalterlichen Gedichte bietet er jeweils auch den mittelhochdeutschen Text.
Ob dabei wohl von jeder und jedem bemerkt worden ist, dass Tzimon Barto hierdurch eine zwar leise, gleichwohl fundamentale Veränderung kenntlich macht? Von der neuhochdeutschen Übersetzung der mittelalterlichen Liebeslyrik her zum mittelhochdeutschen Original hin erfolgt jeweils ein Wechsel der Geschlechter: Aus mittelhochdeutsch „sie“ wird neuhochdeutsch „er“. Auch hier im Wort und seiner Wahl wird also variiert: Liebe ist Liebe, sei sie nun heterosexuell oder homosexuell, lautet die verhaltene, durchaus verschwiegene Botschaft der Textabfolge. Doch wer versteht schon mittelhochdeutsch aufs Wort?
In Fragen der einfallsreichen, plausibel sein wollenden, identifizierenden Festlegung im Alltag, hier der eines Kochs und der seines Herrn (vgl. Hans Sachs: „Der Koch mit dem Kranich“), in Fragen der traditionell dingfest zu machenden Festlegung auf die geschlechtliche Zuordnung der Liebenden (vgl. Walther von der Vogelweide; Heinrich von Morungen), wie auch in Fragen der festen Zuordnung im Verhältnis von Gott und Mensch, von Mensch und Gott (Angelus Silesius) herrscht Offenheit und Fluss, jedoch keinerlei plumpe Starrheit.
Verwandlung und Wiederkehr
Wenn Barto diese Texte bis in die Nuancen hinein überzeugend vorträgt, verweigert er ganz entschieden die zusätzliche verbale, die direkte Interpretation der Goldberg-Variationen über die vorgängige pianistische Interpretation hinaus. Eine indirekte Erläuterung bietet er dennoch: Schaut her, sagt er in bildlicher Form, in dichterischem Gewand: Variationen und berechtigte unterschiedliche Auffassungen neben- und nacheinander haben wir im menschlichen Leben immer. Und die Kunst, ob nun als Musik oder als Dichtung, macht dies sichtbar.
Auch an den alten Heraklit mit seinem bekannten Satz, dass wir in denselben Fluss zu steigen nur einmal in der Lage seien, musste ich denken, als ich die Goldberg-Variationen in Tzimon Bartos Fassung hörte. Ist die Aria des Anfangs, wenn sie am Ende wiederkehrt, nach dem Durchgang durch all die Variationen zwischendurch, noch dieselbe? – Natürlich nicht. Auch dann nicht, wenn der Vortrag des Anfangs und der des Endes – direkt miteinander verglichen – sich nicht oder doch nur kaum verändert hätten.
Es gibt nicht die „richtige“ Interpretation
Und weiter gefragt und gedacht: Variiert nicht das Klavierspiel ein und desselben Pianisten von Mal zu Mal? – Auch hier wird es keine ganz identische, ganz identisch wiederholbare Wiedergabe geben können. Und dann die vielen höchst verschiedenartigen Interpretationen der Goldberg-Variationen, die schon in der Welt sind. Es gibt nicht die eine „richtige“ und maßstabartig „verbindliche“ darunter, allenfalls solche, die einem in unterschiedlichem Grade zu verschiedenen Zeiten jeweils eher einleuchten und gefallen.
Mir scheint es kein Zufall zu sein, dass Barto programmmäßig nicht beansprucht hat, geradezu Bach zu spielen, sondern im ersten Teil seines Musik-und-Wort-Konzertes die Busonische pianistische Version der Goldberg-Variationen gespielt hat und im zweiten Teil für sein Klavierspiel die Transkription der Bachschen Pastorale durch den Pianisten Dinu Lipatti ausgewählt hat.
Auch dies, dass er für das Spiel seines (ihm durch seine um Jahrzehnte älteren Pianistenkollegen Busoni und Lipatti indirekt vermittelten) Bach wie selbstverständlich einen modernen Steinway-Flügel nutzt, scheint zu folgender, indirekt erschließbarer Aussage zu passen: Den ganz originalen Bach kann ich euch ohnehin nicht bieten, keiner kann oder könnte dies wirklich, also biete ich euch gleich eine zwar streng am imaginären originalen Werk orientierte, dennoch aber ganz bestimmte Version an.
Es ist bitterkalt. Schnee und Eis haben die Mitte Europas fest im Griff. Eigentlich möchte man sich es sich nur noch mit einem heißen Getränk und einem guten Buch in der gut geheizten Wohnung gemütlich machen. Doch dann müssen der Berliner Kommissar Thomas Bernhardt und seine Wiener Kollegin Anna Habel doch vor die Tür und hinaus ins Frostige.
In den Hauptstädten Deutschlands und Österreichs geschehen Morde, die offensichtlich enger zusammenhängen, als es auf den ersten Blick scheint. In Berlin wird eine junge Schauspielerin grausam zerstückelt, die noch vor gar nicht langer Zeit in Wien große Bühnentriumphe feierte. Und war sie nicht mit jener Frau näher befreundet, deren kopflose Leiche man in Wien auf den Gleisen eines Rangierbahnhofs findet?
„Nach dem Applaus“ heißt der neue, nunmehr dritte „Fall für Berlin und Wien“, den das Autoren-Duo Bielefeld & Hartlieb mit liebevoll-zynischer Lust geschrieben hat. Nachdem der Berliner Literaturkritiker Claus-Ulrich Bielefeld und die Wiener Buchhändlerin Petra Hartlieb ihr unterhaltsames Spiel mit den blutigen Machenschaften unter Schriftstellern und Verlegern („Auf der Strecke“) und mit den politischen Irrungen und Wirkungen unter ehemaligen RAF-Terroristen („Bis zur Neige“) geführt haben, wagen sie diesmal einen Ausflug ins Theatermilieu. Das ist schon deshalb nicht ohne Hintersinn und Humor, weil Berlin und Wien seit jeher um die Theaterkrone im deutschsprachigen Raum kämpfen.
Natürlich war die in Berlin ermordete Schauspielerin eine Lieblings-Diva von Claus Peymann, dem ehemaligen Chef des Wiener Burgtheaters, der seit einigen Jahren das Berliner Ensemble leitet und immer wieder vollmundig verkündet, sein Theater solle Reißzahn im Hinterteil der Herrschenden sein. Peymann wird im Krimi zwar nicht direkt beim Namen genannt, aber auch so ist jedem Leser klar, wer da seine aufbrausenden Bühnenweisheiten und arroganten Kunstsentenzen von sich gibt.
Dass der Theaterdirektor ausgerechnet von einem Kommissar namens Thomas Bernhardt (mit „dt“) verhört wird, raubt dem ehemaligen Weggefährten des (fast) gleichnamigen österreichischen Schriftstellers (mit „d“) beinahe den Verstand. Auch als Kommissar Bernhardt in eine Schauspielprobe platzt, bei der „Peymann“ sich an einer Bühnenversion von Georg Büchners „Lenz“-Erzählung abarbeitet und sich – ausgerechnet! – vom prolligen Volksbühnen-Kollegen Frank Castorf ein paar Ratschläge erbittet, ist der Humorfaktor groß.
Aber bei allen komischen Seitenhieben auf die Theaterszene kommt das bizarre mörderische Treiben nicht zu kurz. Ein zum Eisklotz gefroren toter Schriftsteller im See, ein in luftiger Höhe an die Flügel eines Windrades gebundener Schauspieler, ein Kunst-Mäzen, der gern Gutes tut, aber selbst nicht ohne Makel ist: Es wird Zeit, dass Bernhardt und Habel, die nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander können, gemeinsam am komplizierte Fall bosseln.
Ob die beiden bei ihren Recherchen in Szene-Cafés oder Theater-Kantinen Station machen, immer spürt man, dass jedes Detail stimmt und jede Anspielung bis aufs I-Tüpfelchen durchdacht ist. Zwar versichern Bielfeld&Hartlieb, dass alle Personen und Ereignisse frei erfunden sind. Trotzdem ist es ein kriminalistischer Spaß, die Fantasie mit der Realität abzugleichen.
Bielefeld & Hartlieb: „Nach dem Applaus“. Kriminalroman. Diogenes Verlag, Zürich. 390 Seiten, 14,90 Euro.
Der Schriftsteller Philip hat Frau und Tochter durch tragische Umstände verloren. Früher hat er in Paris und New York komfortabel gelebt, jetzt aber hat er sich zurückgezogen.
Durch Schmerz und Trauer ist er gleichsam ein Außenstehender geworden, doch betrachtet er die Dinge des Lebens aus freundlicher Distanz, mit mildem Sinn.
Eines Abends trifft er im New Yorker Ballett-Publikum seine mondäne Jugendfreundin Lucy, eine geborene De Bourgh und somit dem Ostküsten-(Geld)-„Adel“ zugehörig, der quasi schon mit der „Mayflower“ in die Neue Welt gekommen ist und daraus einige Privilegien herleitet. Sie lädt Philip ein und will reden, reden, reden. So beginnt Louis Begleys Roman „Erinnerungen an eine Ehe“, dessen illusionslos-lakonische Vorgabe so lautet: „Lucy war alt; ich war alt.“ Sie beide kennen inzwischen längst mehr Tote als Lebende.
Einst hat Philip auch Lucys inzwischen verstorbenen Mann Thomas Snow gekannt, Sohn eines Automechanikers, nach Lucys Verständnis also ein „Emporkömmling“, der steile Wirtschaftskarriere machte, jedoch gesellschaftlich nie so richtig ganz oben ankam. Unter diesem Zeichen hat auch die Ehe von Lucy und Thomas gestanden – eine Verbindung, die wohl niemals hätte geschlossen werden dürfen. Sollte sie am Ende nur sein Entrée in die höheren Schichten und überdies seine Hure gewesen sein? Und wie sehr hat der Sohn Jamie unter seinen Eltern gelitten?
Interessiert einen das? Möchte man genauer wissen, warum jene (einst so lebenslustige) Lucy nun dermaßen verbittert ist, inwiefern sie vielleicht ihr Leben verpfuscht hat? Bis etwa zur Hälfte des etwas zähflüssigen Buches hätte ich diese Fragen eher verneint.
Philip lässt sich jedenfalls nach und nach in Lucys Ehe- und Lebensgeschichte hineinziehen, als könnte das Stoff für einen Roman ergeben. Sicher ist er sich freilich nicht. Er trifft und befragt einige Menschen, die jeweils ein paar Mosaiksteine zu einem möglichen Gesamtbild beitragen sollen – doch da rundet sich nichts. Dieses beinahe zu Ende gelebte Leben der Lucy Snow bleibt letztlich ungreifbar, auch wenn noch so viele „Zeugen“ einvernommen werden. All die Gespräche kreisen – in manch’ widersprüchlichen Facetten – immerzu um ein nebulöses Zentrum.
Wir erfahren von diversen Affären, von psychiatrischen Behandlungen und Alkoholismus. Alles natürlich vor höchst gediegenem, kultiviertem Hintergrund. Was das weltläufig-metropolitane Leben in „besseren“ Kreisen halt so hergibt. Doch wie’s da drinnen aussieht…
Jetzt ist Lucy so allein wie Philip – nein, im Grunde ist sie ganz anders allein, nämlich verzweifelt einsam. Betrüblicher Befund: „Die frühere Lucy – das lustige, originelle, draufgängerische Wesen (…) ist einfach verschwunden.“ Philip hingegen hat seine schlimmste Trauerzeit offenbar hinter sich gelassen und wirkt trotz aller Zurückgezogenheit geradezu heiter und aufgeschlossen. Zweierlei Herbst des Lebens…
Louis Begley gestattet sich allerlei Umschweife, er erzählt mitunter umständlich. Lange wirkt es so, als wollte sein Roman gar nicht recht „in Gang“ kommen, als seien dies alles nur Vorstudien. Doch unaufdringlich, ja kaum merklich spielt sich die wehmutsvolle Handlung vor der Folie des heillosen kriegerischen Eingreifens der USA im Irak ab. Auch stellt sich die dringliche Frage, ob man unter linksliberalen, egalitären Gesichtspunkten überhaupt abfällig von einem „Emporkömmling“ reden sollte. So erhält das Geschehen nach und nach einen weiteren Horizont und etwas mehr Tiefenschärfe. Immerhin.
Zudem scheint es, als geriete Philip in den „Bannkreis“ Lucys, woraus sich ein gewisser Spannungsbogen ergibt. Doch die Erinnerung an seine nicht nur nachträglich umsonnte Ehe mit Bella hat diesen Mann für alle verbleibende Zeit so gefestigt, dass er am Ende leichten Herzens eine souveräne Entscheidung trifft…
Louis Begley: „Erinnerungen an eine Ehe“. Roman. Suhrkamp Verlag. 222 Seiten. 19,95 Euro.
Die Männer sitzen ums Feuer und singen ein altes Lied in einer fremden Sprache, einer spielt Gitarre dazu. Hin und wieder versteht man sogar ein Wort: Denn die Sprache ist Mittelhochdeutsch und die Geschichte, über die sie singen, erzählt von Siegfrieds Heldentaten und Kriemhilds Rache. Regisseur Roger Vontobel hat für das Schauspielhaus Bochum Hebbels „Die Nibelungen“ inszeniert und das Stück buchstäblich als „Nibelungenlied“ kongenial an seine Ursprünge zurückgeführt.
Die Gesangseinlagen beschwören den mittelalterlichen Mythos herauf und legen die archaischen Grundzüge der Heldengeschichte frei, so dass sie uns heute wieder etwas sagt. Überhaupt: Wie Vontobel es schafft, die Nibelungen-Sage als packende Sex-and-Crime-Story zu erzählen, so dass der Theaterabend trotz fünfeinhalbstündiger Spieldauer keine Sekunde langweilig, sondern extrem kurzweilig und spannend daherkommt, das ist wirklich eine großartige Regieleistung.
Dabei wirkt Vontobels Erzählweise, die mit einer großen Rückblende arbeitet, in der Siegfried und Kriemhilds Vorgeschichte inklusive Drachentötung und Mord entfaltet werden, keineswegs verflachend. Sehr genau erlebt man die Psychologie der Figuren, erkennt ihre Motive, ihre Schuld-, Eifersuchts- und Rachegefühle und kann verfolgen, wie diese Emotionen letztlich in grausame und tödliche Verstrickung führen.
Im Zentrum des Geschehens steht Kriemhild: Jana Schulz legt diese Figur als ein burschikos-naives Mädchen an, das erleben muss, wie ihre reine, große Liebe zu Siegfried durch Gier und Machtkalkül ihrer Brüder und Hagen funktionalisiert und letztlich zerstört wird. Kriemhilds Rache folgt aus gebrochenem Herzen und der Erfahrung, dass ihre engste Familie sie verraten hat. Darum ist sie umso grausamer und gibt sich erst zufrieden, nachdem sie alle in den Tod getrieben hat.
Diese Charakterentwicklung nimmt man der großartigen Schauspielerin jede Sekunde ab, ebenso wie man ihre sinnliche Bühnenpräsenz nur bewundern kann. Die lange Szene, in der sich Kriemhild die Asche Siegfrieds mit Schwamm und Waschkrug vom Körper reibt markiert sinnfällig die Zäsur. Hier wird aus der Trauernden die eiskalte Rächerin, die im Diven-Outfit ihre Erotik gezielt dazu einsetzt, den zweiten Ehemann Etzel (Matthias Redlhammer) ins Mordkomplott einzuspannen.
Doch auch die Handlungsmotive der übrigen Figuren sind klug herausgearbeitet: Hagen (Werner Wölbern) ist mitnichten nur der Bösewicht, der Siegfried aus Mordlust tötet. Als treuer Gefolgsmann und Berater König Gunthers geht es ihm um Machtpolitik: Er will das Haus Burgund in die Zukunft führen und scheut dabei vor keiner List zurück. Siegfried dagegen ist Mitwisser und Störenfried für ihn, denn er setzt Gerechtigkeit über Treue. In Hagens Welt muss er dafür sterben.
Nun der Held selbst, im Drachenlederanzug: Fast blass und verkopft kommt dieser Siegfried (Felix Rech) daher. Seine Macht von Zauberschwert und Tarnkappe ist ihm eher unheimlich, er wollte lieber für sich und Kriemhild ein kleines Glück, statt ein großer Held zu sein. Doch das Heldentum legt ihm Pflichten auf, die er scheut und das wird ihm zum Verhängnis. König Gunther (Florian Lange) dagegen will mehr, als seine Fähigkeiten erlauben: Er ist scharf auf Brunhild (Minna Wündrich), aber sie ist eindeutig eine Nummer zu groß für ihn, das bringt dieser Ehe nur Verdruss. Richtig komisch sind die Szenen, in denen das Vollweib Brunhild den armen Pantoffelhelden mit Verlaub „zusammenscheißt“ – ach hätte er doch ein nettes Mädchen von nebenan geheiratet anstatt dieser kraftstrotzenden Walküre, deren Wildheit niemand bändigen kann, weil sie aus eisigeren Gefilden stammt und das ganze Rheinland ihr einfach zu lieblich ist.
Die politisch heikle Rezeptionsgeschichte des Nibelungenstoffes hat Vontobel sehr dezent integriert: In Ausstattung und Kostüm sind Anklänge an die Mode und Frisuren der vierziger Jahre zu finden, ohne allzu sehr die abgegriffene 3.-Reich-Symbolik zu bemühen. (Kostüme: Tina Kloempken). Auch die Idee, den berüchtigten Hunnenkönig Etzel als kultivierten Klavierspieler im weißen Anzug zu zeigen, hat Charme. So ist nicht von vorneherein klar, wer eigentlich hier die Barbaren sind und die Deutung gerät offener.
Selbst mit der Gewalt im Stück findet Vontobel einen klugen Umgang: Sicher, es fließt Blut, aber die schlimmsten Szenen lässt er hinter dem geschlossenen eisernen Vorhang spielen. So entstehen die Bilder des Schreckens durch bloße Geräuschkulisse im Kopf des Zuschauers – was sie umso eindringlicher macht (Bühne: Claudia Rohner).
Zeit nehmen, unbedingt hingehen: Wenn draußen vor dem Schauspielhaus Bochum ein Lagerfeuer brennt, gibt’s drinnen die Nibelungen zu sehen.
Weitere Infos und Karten:
http://www.schauspielhausbochum.de/spielplan/die-nibelungen/
Ob nach Auschwitz sich noch leben lasse, war eine zentrale Frage, die der Philosoph Theodor W. Adorno gestellt hat. Er gab damit einen Anstoß, über Sinn und Wert des Lebens, über Schuld und Verantwortung angesichts der NS-Gräuel nachzudenken. Was der Vertreter der Frankfurter Schule gesellschaftlich und historisch zu hinterfragen suchte, reflektiert Michel Laub am Beispiel (s)einer Familie.
Der Autor, jüdischer Herkunft, ist Journalist, Jahrgang 1973, und wurde im brasilianischen Porto Alegre geboren. In seinem autobiographischen Roman „Tagebuch eines Sturzes“ erzählt er die Lebensgeschichte seines Großvaters, seines Vaters und seiner selbst. Laub, der in seiner Heimat zu wichtigsten zeitgenössischen Autoren gehört, beschreibt über weite Strecken in einzelnen Sequenzen, Szenen oder Momentaufnahme, was der Angehörige einer jeweiligen Generation erlebt und durchlitten hat.
Das Buch ist in Ich-Form geschrieben. Für den Erzähler ist der Anlass, sich zurückzunehmen und Rückschau zu halten, wahrlich schwierig genug: Er hat ein Alkoholproblem, seine Frau (die mittlerweile 3. Ehe) droht mit dem Ende der Beziehung und der Vater hat gerade von Ärzten erfahren, an Alzheimer erkrankt zu sein.
Da ist das Wort von der persönlichen Krise wohl durchaus erlaubt. Wenn der Schriftsteller nun Verbindungen mit Auschwitz herstellt, mag das im ersten Moment befremdlich erscheinen, im Gesamtkontext der Familie wird es verständlich. Sein Großvater nämlich hat das KZ überlebt und nach dem Krieg in Brasilien ein neues Leben als Geschäftsmann begonnen. Kann man aber hier wirklich von Leben sprechen?
Sein Opa, den er selbst nie kennenlernte, hat nichts über Auschwitz gesagt oder berichtet. Seine Erinnerungen verarbeitete er stattdessen in einem Tagebuch, das er nach Feierabend führte, wozu er sich in sein Arbeitszimmer zurückzog. Treffender wäre wohl das Wort „verbarrikadierte“. Was er niederschrieb, erfuhr seine Familie erst nach seinem Tod und bekam einen Eindruck davon, wie sehr er unter den Erlebnissen im Konzentrationslager zu leiden hatte, in dem auch zahlreiche Verwandte starben. Diese seelischen Qualen waren es schließlich auch, die dazu führten, dass er Selbstmord beging. Sein Sohn, damals 14 Jahre alt, fand den Vater tot im Arbeitszimmer. Das Trauma überwand er nie, und auch sein Sohn, der Erzähler, spürte stets, wie sehr sein Vater unter dem psychischen Druck zu leiden hatte.
Auch wenn kein kausaler Zusammenhang zu dem Geschehen, das den jüngsten Nachfahren aufwühlen soll, besteht, stimmt es doch nachdenklich, dass auch er mit einem schwierigen Ereignis zurechtkommen muss. Hierbei ist er allerdings nicht Opfer, sondern gehört zum Kreis der Täter. Er besucht ein jüdisches Gymnasium. Als der einzige nicht-jüdische Mitschüler in der Klasse bei der eigenen Feier zum 13. Geburtstag entsprechend der Anzahl der Lebensjahre in die Luft geworfen wird, fangen ihn seine Mitschüler beim letzten Mal nicht mehr auf. Joao, so der Name des Jungen, war stets Außenseiter und wurde gemobbt. Mit schweren Verletzungen kommt er ins Krankenhaus und als er nach Monaten in die Schule zurückkehrt, ist der Erzähler der einzige, der sich um ihn kümmert. Das Gewissen hat ihn seit dem Fest geplagt. Eine Freundschaft aufzubauen scheitert indes, trotz mancherlei Bemühungen.
Zurück bleibt der Erzähler mit dem Gefühl des Versagens und des Scheiterns. Überhaupt tut er sich schwer mit dauerhaften Bindungen und versucht, die Gründe herauszufinden. Vater und Großvater sind dabei wichtige Glieder in einer Ursachenkette. Der Titel „Tagebuch eines Sturzes“ wird am Ende zu einer Aussage, die mehr meint als „nur“ das Geschehen um den nicht-jüdischen Jungen.
Michel Laub: „Tagebuch eines Sturzes“. Roman. Klett-Cotta-Verlag, Aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt von Michael Kegler. 176 Seiten. 19,95 Euro.