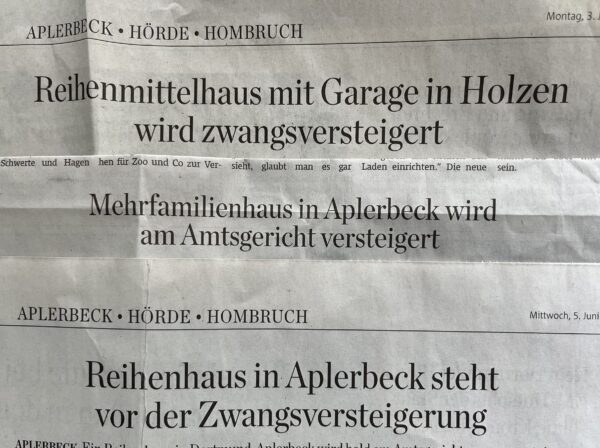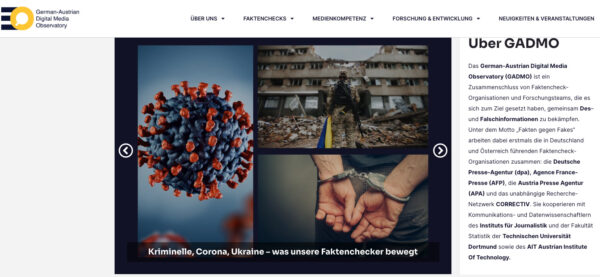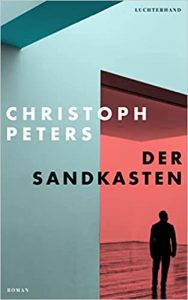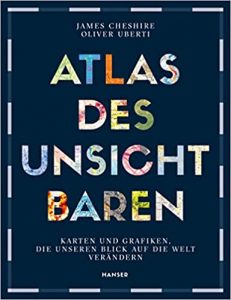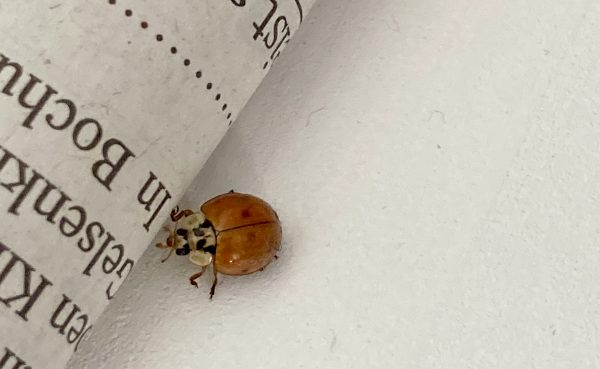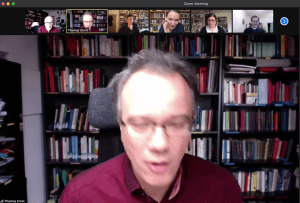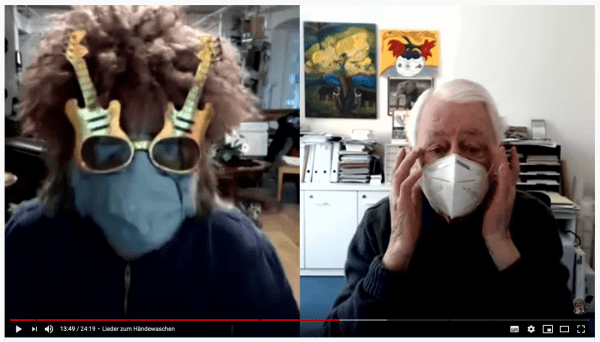Alessando Mendini: „Interno di un interno (Sofa)“, 1990 (Foto: Collection Groninger Museum, Bundeskunsthalle Bonn)
Sind wir zu früh? Über die „Postmoderne“ – um die geht es hier – ließe sich eigentlich doch erst streiten, wenn man sie gut und ganz im Blick hätte. Dafür müßte man sie aber verlassen haben, sich in einer Art Post-Postmoderne befinden mit sachlich-distanziertem Blick auf das, was bisher geschah.
Wenn die Bonner Bundeskunsthalle nun in einer großen Ausstellung eben jene Postmoderne zum Thema macht: „Alles auf einmal: die Postmoderne. 1967 – 1992“, mag der Grund auch eher schlichter Natur sein. Sie sind nicht eher fertiggeworden. Eigentlich war diese oder eine doch recht ähnliche Veranstaltung geplant für das Jahr 2022, in dem nämliche Bundeskunsthalle 30 Jahre alt wurde. 1992 fing das an in Bonn, man erinnert sich, wenn man älter ist.

Sehr postmodern: Die spitzen blauen Türmchen auf dem Dach der Bundskunsthalle (Foto: Bundeskunsthalle Bonn)
Blaue Türmchen
In Sonderheit erinnert man sich aber auch an die damals wiederholt geäußerte Kritik an der Architektur dieser Bundesinstitution, die den bombastischen, triumphal-verspielten, quasi „unsachlichen“ Stil des Gebäudes geißelte. Die blaubunten Spitztürmchen auf dem Dach wurden heftig kritisiert, ebenso die Säulen auf Seiten der Helmut-Kohl-Allee, von denen jede für ein Bundesland stehen sollte, alte wie neue. Manchen Kritikern zeigte das Bauwerk gar Anklänge an nationalsozialistische Überwältigungsarchitektur, und das in etwa zeitgleich entstehende Museum des Bonner Kunstvereins mit seinem pompösen Entree gleich gegenüber tat das Seine (wenn man so will), um dieses Architekturensemble verwerflich erscheinen zu lassen.
Zeiträume
Tja. Das alles, und noch viel mehr, hätte man 2022 mit einer gewissen Schlüssigkeit wieder erzählen können. Doch dann wurde die Schau nicht fertig, Corona vermutlich, und das runde Datum schwand dahin. Um der jetzigen Ausstellung wenigstens ein bißchen Aktualität mitzugeben, hat man neben 1992 auch noch die Jahreszahl 1967 in den Titel geschrieben. So ergeben sich zwei annähernd gleich große Betrachtungszeiträume von 25 und 31 Jahren, 1967 bis 1992 und 1992 bis 2023, und bei allen Vorbehalten gegenüber allzu zeitnaher historischer Betrachtung weisen diese beiden Zeiträume fraglos unterschiedliche Prägungen auf. Eine „Erfindung“ der Bonner Ausstellung sind die beiden Jahreszahlen als Zäsuren der Postmoderne übrigens nicht, man findet sie, geäußert meistens unter Vorbehalt, auch andernorts.

Ettore Sottsass‘ Regal „Carlton“ der italienischen Postmoderne, beschichtet & bedruckt (Foto: Bundeskunsthalle Bonn)
Alles mögliche
Großen Wert legt Kolja Reichert, der die Ausstellung neben seiner Chefin Eva Kraus maßgeblich gestaltete, darauf, daß in Bonn nicht nur Architektur und Design zum Zuge kommen, sondern alle Künste, die Philosophie, der technische Fortschritt, die politischen Bewegungen. Nun gut; doch der Begriff der Postmoderne bezog sich in der ersten Hälfte der 90er Jahre – und da führte man ihn durchaus im Munde – ganz wesentlich auf Architektur und Design.
Gewiß, damals war der Kalte Krieg zu Ende, und Francis Fukuyamas Buchtitel „Das Ende der Geschichte“ machte die Menschen glücklich, weil sie es mit einem Ende von Krieg und Gewalt gleichsetzten. Aber sichtbar wurde Postmoderne vor allem – eben – in Dingen, Architekturen, Veranstaltungen. Nicht das Motto der Moderne „Form Follows Function“ galt fürderhin, sondern, in den Worten Eva Kraus’, „Form Follows Fun“. Man war weitgehend frei in der Gestaltung, bewundernd sprachen die Betrachter von einer Revision der Moderne oder, je nach dem, von Methodenpluralismus.
Ruiniert und verspielt
Ein bißchen Unsicherheit war aber wohl auch mit im Spiel, was die Ausstellung in ihrer Struktur sinnfällig spiegelt. Nach einer ersten, etwas anmaßend mit „Das Erwachen der Medien“ überschriebenen und mit vielen flachen Bildern bestückten Abteilung wird in der zweiten „die Moderne buchstäblich in die Luft gejagt“ (O-Ton Katalog) – in Zeichnungen, Film-Stills und Videos, aber auch (scheinbar) in der (fotografierten) Trümmer-Architektur James Wines‘ für die Supermarktkette „Best“. Doch die Postmoderne bot auch viel Platz für Verspieltheiten wie die pompös-barocken, knallbunt bezogenen Sessel und Sofas Alessandro Mendinis, die weitgehend funktionsfreien, als Raumteiler titulierten vielfarbigen Holzgebilde von Ettore Sottsass, die frei fantasierte und nur scheinbar maßstäblich verkleinerte Ideallandschaft „Piazza d’Italia“ von Charles Moore. Auch eine Arbeit David Hockneys hat man hier einsortiert, „Kerby (After Hogarth), Useful Knowledge“, entstanden 1975, unerwartet allegorisch.

David Hockeys Bild „Kerby (After Hogarth), Useful Knowledge“ (1975), Oil on Canvas (Foto: David Hockey Collection, Museum of Modern Art (MOMA), New York, Pru Cuming Associates Ltd., Bundeskunsthalle Bonn)
Aerobic
Körperkult – Jane Fonda und Aerobic – und bei aller Skepsis auch ein gewisser Machbarkeitswahn sind weitere Stichworte der Schau, dargeboten ganz überwiegend mit flachem Bildmaterial. „Richtige“ Objekte aber sind bei Mode und Design zu bestaunen. Wir begegnen Alessis weltberühmten Salzstreuern und Pfeffermühlen, den putzigen PCs der Siebziger, den wattierten Schultern, den ehrfurchtgebietenden Schnurtelefonen mit Tasten, silbernen Teegeschirren, utopistischen Auto-Karosserien und manchem mehr. Über die Sinnhaftigkeit der Zusammenstellung möge das Publikum befinden. Denn wie gesagt: Wir sind ja viel zu nahe dran, als daß abschließende Urteile möglich wären, und je nach Perspektive mag die Gewichtung unterschiedlich erlebt und gutgeheißen werden.
Dröhnende Thesen
Allerdings irritiert mitunter die dröhnende Thesenhaftigkeit der Schau. Exemplarisches Zitat: „Kultur für alle!, heißt es ab Ende der 1970er-Jahre. Während der Sozialstaat rückgebaut wird, schießen Museen und Bibliotheken aus dem Boden. Die Idee ökonomischer Gerechtigkeit wird ersetzt durch kulturelle Teilhabe. Kultur wird zur Währung, die man haben muß.“ Ein bißchen revolutionär, ein bißchen anklagend, aber nicht zu sehr – vielleicht Kennzeichen des Kritisierens in der Post-Postmoderne, über die uns Nachfolgende in zwanzig, dreißig, vierzig Jahren schreiben werden.

Tea & Coffee von Aldi Rossi (1983) (Foto: Collection Groninger Museum, John Stiel, Bundeskunsthalle Bonn)
Schlechtes Beispiel
Als ein architektonisches Exempel der Kulturbauten in den Siebzigerjahren wird übrigens das 1977 eröffnete Centre Pompidou in Paris genannt; nur ganz leise sei vermerkt, daß dieses Haus in seiner Modernität (von Postmoderne sollte man sicherlich nicht reden, eher folgt ja hier ganz im Sinne der Moderne die Form der Funktion) in der Pariser Museumslandschaft nach wie vor ein Solitär ist. Das meiste, der Louvre vorneweg, ist gravitätisch und, wenn wir in diesem Begrifflichkeiten bleiben wollen, eher „vormodern“.
Blicken wir einmal noch in die Ausstellung. Medienpräsenz und Mediennutzung veränderten sich in den genannten Zeiträumen dramatisch, erzählt sie uns, die Clubszene expandierte, „Women of Colour“ erfanden die Identitätspolitik. Außerdem gab es Helmut Kohl und, nicht zu leugnen, das Erstarken einer neuen Rechten. Alles richtig.
Die Grünen
Es gab aber auch, und dazu findet sich wenig bis nichts in Katalog und Ausstellung, das Erstarken der Atomkraftgegner, der ökologischen Bewegung zunächst („Tunix“), der grünen Parteien späterhin in Deutschland und anderswo. Das geschah nicht nach dem Ende der Moderne, sondern wesentlich nach der Ernüchterung und der Selbstauflösung maoistischer Parteien wie KBW und KPD-AO. Auch die RAF hätte ungefähr hier ins Bild gehört, doch die Ausstellung bleibt da eigentümlich unpolitisch. Wie gesagt, bei der kurzen Betrachtungsdistanz noch erlaubt, aber nicht völlig zufriedenstellend. Doch vielleicht lohnt gerade dies den Besuch: Eigenes Erleben, eigene Erinnerung neben das zu stellen, was Ausstellungsmachern wichtig war.
Übrigens: „Anything Goes“, eine der vielen Zwischenzeilen dieser Schau, war 1934 schon Titel eines Musicals von Cole Porter. Was die Botschaft allerdings nicht schmälert.
- „Alles auf einmal. Die Postmoderne, 1967 – 1992″
- Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH (Bundeskunsthalle), Bonn
- Bis 28. Januar 2024
- www.bundeskunsthalle.de